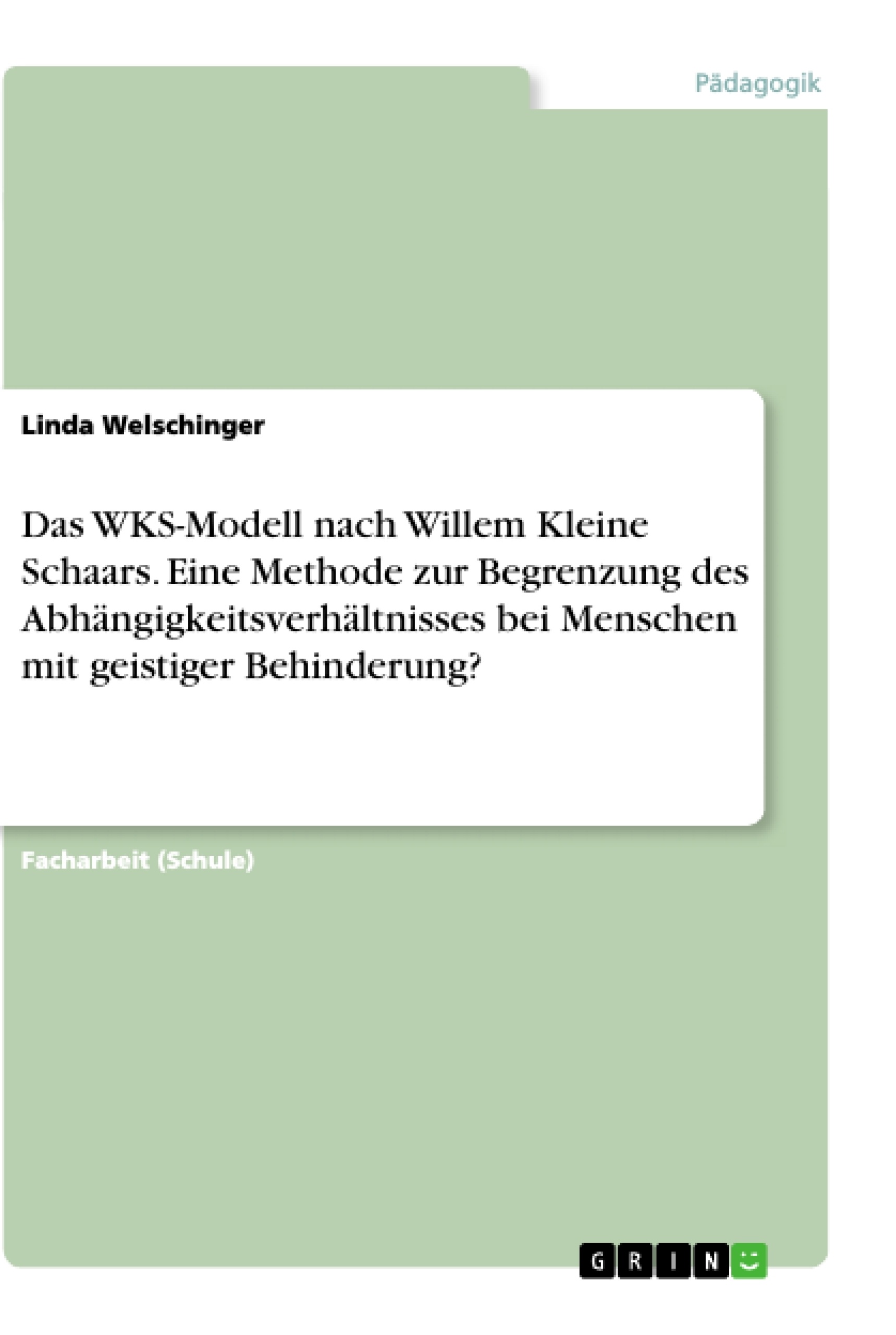Die folgende Arbeit befasst sich mit dem Betreuungsmodell des niederländischen Pädagogen Willem Kleine Schaars.
Infolge des 2017 in Kraft getretenen Bundesteilhabegesetzes, welches für Menschen mit Beeinträchtigung mehr Teilhabe und Selbstbestimmung vorsieht, wird der Blick der ausgebildeten sowie werdenden Erzieherinnen und Erzieher neben der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zunehmend auf Menschen mit Behinderung gerichtet.
Wie dieser Fokus durch das besprochene Modell erzielt werden kann, wird in dieser Arbeit thematisiert.
Das WKS-Modell nach Willem Kleine Schaars. Eine Methode zur Begrenzung des Abhängigkeitsverhältnisses bei Menschen mit geistiger Behinderung?
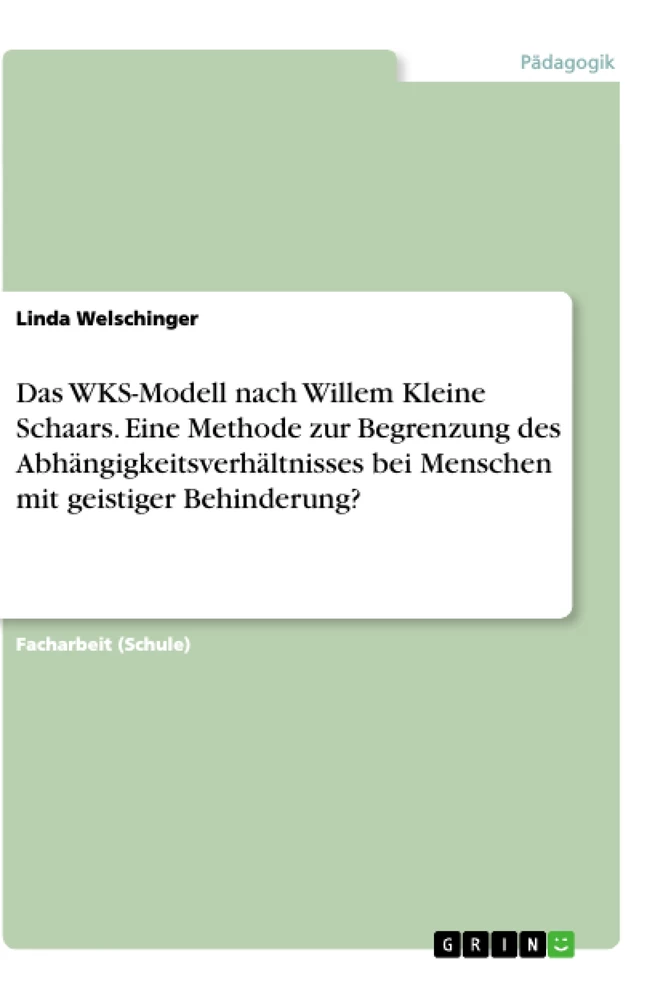
Facharbeit (Schule) , 2018 , 11 Seiten , Note: 0,7
Autor:in: Linda Welschinger (Autor:in)
Pädagogik - Heilpädagogik, Sonderpädagogik
Leseprobe & Details Blick ins Buch