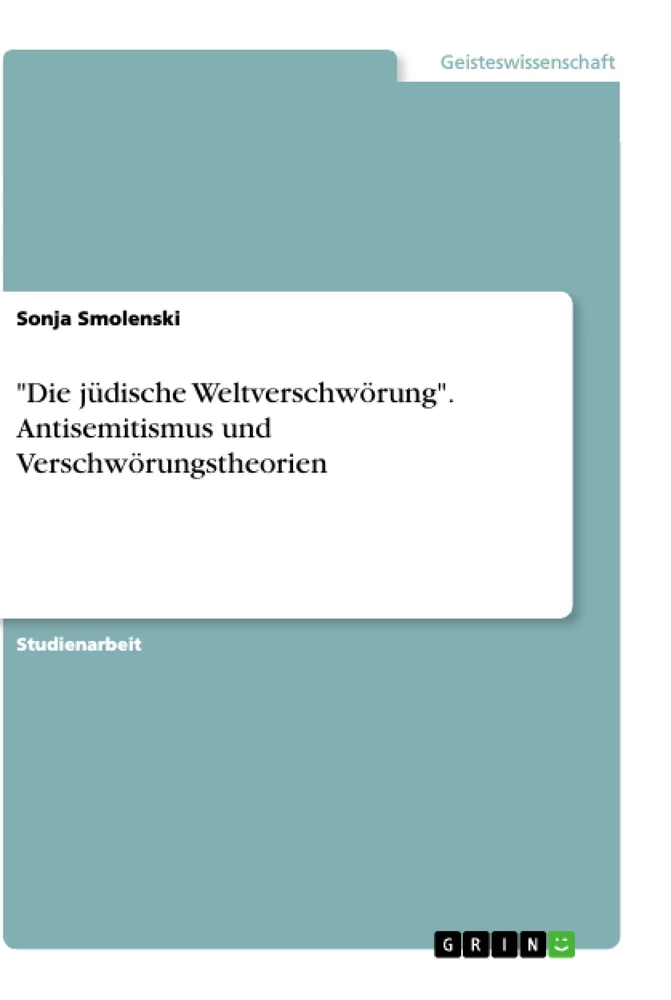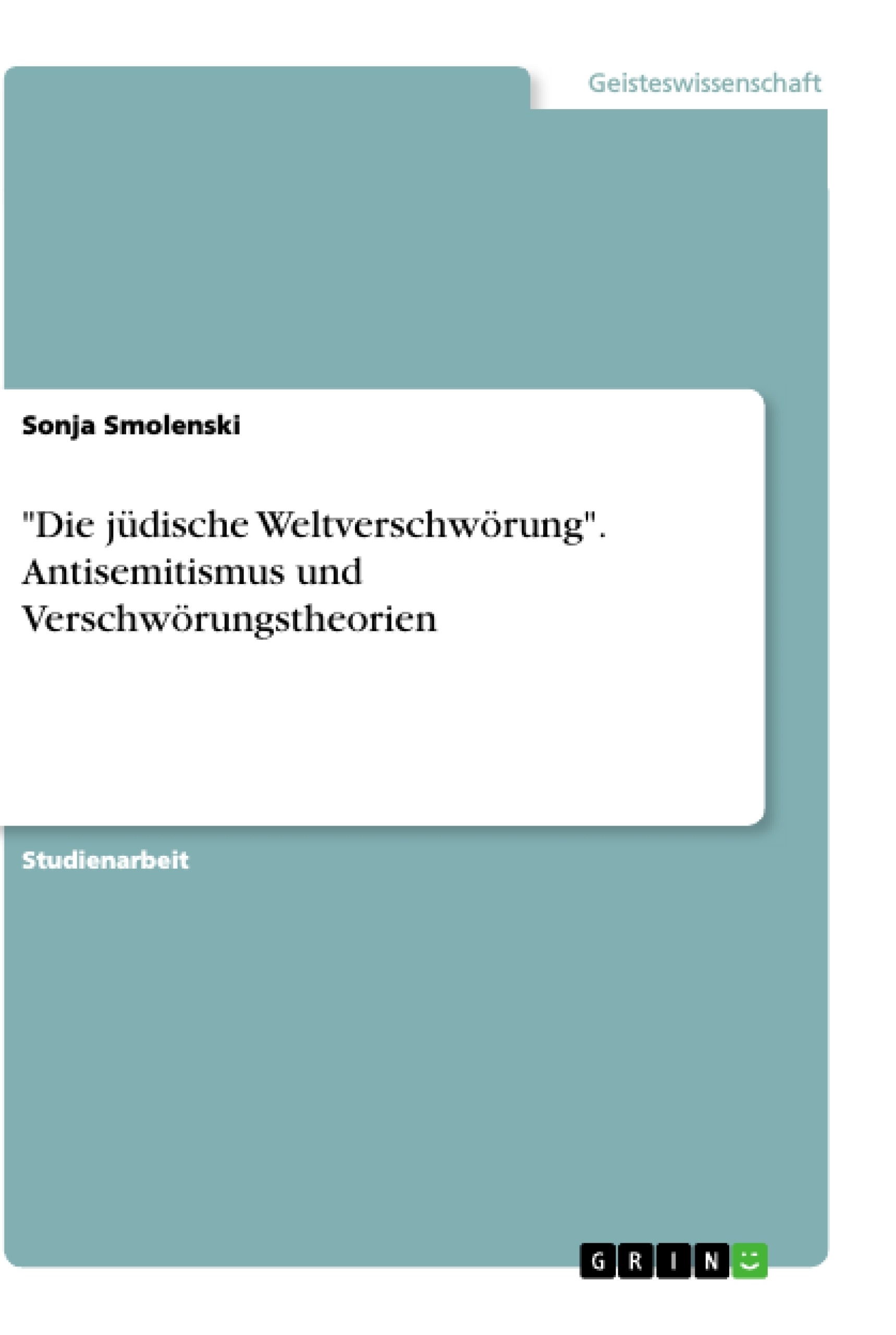Diese Arbeit befasst sich mit antisemitischen Verschwörungsideologien in der Neuzeit, und geht konkret auf die sogenannte "jüdische Weltverschwörung" ein. Es wird aufgezeigt, wie antisemitische Feindbilder durch Verschwörungsideologien geschaffen, und stetig neu instrumentalisiert werden. Ziel ist es, nicht nur die Verschwörungstheorien durch Fakten zu widerlegen, sondern auch auf ihre Dynamik und Ideologie einzugehen. Hierfür wird zunächst der Begriff der Verschwörungstheorie definiert, und ein Überblick geschaffen, warum diese populär sind. Anschließend wird ein kurzer historischer Überblick über antisemitische Ressentiments und die Anfänge antisemitischer Verschwörungsideologien gegeben, um im Hauptteil dann auf antisemitische Verschwörungstheorien in der Neuzeit ab dem 21. Jahrhundert einzugehen.
Seit 2010 wurden knapp 12000 antisemitische Straftaten in Deutschland vom Bundeskriminalamt erfasst. Das bedeutet, dass es mindestens vier Mal pro Tag in der Bundesrepublik Deutschland zu einem antisemitischen Vorfall kommt. Hierbei gehen Kritiker*innen von einer noch weitaus höheren Dunkelziffer aus, da viele Straftaten nicht gemeldet werden. Aus den Statistiken geht hervor, dass 94% der Delikte auf rechte Täter*innen zurück zu führen seien. Die Polizei stuft grundsätzlich jede antisemitische Straftat zunächst als rechtsmotiviert ein, selbst wenn sie keiner expliziten Gruppierung zuzuordnen sind.
Dabei ist Antisemitismus kein Randphänomen der extremen Rechten in Deutschland, sondern seit langem auch Bestandteil der bürgerlichen Mitte. Dies beweist die Studie "Die enthemmte Mitte", die seit 2002 von der Universität Leipzig regelmäßig politische Einstellungen der Bundesbürger*innen abfragt. So stimmten 2016 mehr als 10% der Bevölkerung der Aussage zu, "auch heute noch wäre der Einfluss der Juden zu groß". Diese judenfeindlichen Aussagen werden durch die Verbreitung von Verschwörungsideologien, die ein sogenanntes "Weltjudentum" hinter politischen und wirtschaftlichen Strukturen vermuten, verbreitet. Die Art von Verschwörungsmythos tritt seit Jahrhunderten in unterschiedlichen Narrativen auf, nur die Elemente werden an den aktuellen Zeitgeist angepasst – das Feindbild bleibt unterdessen stets dasselbe: Jüdinnen und Juden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffsdefinition, Erklärung und Funktionen von Verschwörungstheorien
2.1 Begriffsdefinition und Erklärung des Begriffs der Verschwörungstheorie
2.2 Psychologische Funktionen von Verschwörungstheorien
3. Historischer Überblick: Antisemitische Verschwörungstheorien von der Antike bis zur Neuzeit
4. Moderne Form antisemitischer Verschwörungstheorien: Die jüdische Weltverschwörung
4.1 Das antisemitische Manifest: „ Die Protokolle der Weisen von Zion“
4.2 Antisemitische Weltbilder in der NS-Zeit
4.3 „New World Order“und „jüdisches Bankenwesen”
4.4 Antizionistischer Antisemitismus
5. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Seit 2010 wurden knapp 12.000 antisemitische Straftaten in Deutschland vom Bundeskriminalamt erfasst. Das bedeutet, dass es mindestens vier Mal pro Tag in der Bundesrepublik Deutschland zu einem antisemitischen Vorfall kommt. Hierbei gehen Kritiker*innen von einer noch weitaus höheren Dunkelziffer aus, da viele Straftaten nicht gemeldet werden. Aus den Statistiken geht hervor, dass 94% der Delikte auf rechte Täter*innen zurück zu führen seien (vgl. Reisin, 2018). Die Polizei stuft grundsätzlich jede antisemitische Straftat zunächst als rechtsmotiviert ein, selbst wenn sie keiner expliziten Gruppierung zuzuordnen sind (vgl. Krone, 2018).
Dabei ist Antisemitismus kein Randphänomen der extremen Rechten in Deutschland, sondern seit langem auch Bestandteil der bürgerlichen Mitte. Dies beweist die Studie „Die enthemmte Mitte“, die seit 2002 von der Universität Leipzig regelmäßig politische Einstellungen der Bundesbürger*innen abfragt. So stimmten 2016 mehr als 10% der Bevölkerung der Aussage zu, „auch heute noch wäre der Einfluss der Juden zu groß“ (Die enthemmte Mitte, 2016). Nicht nur in Deutschland sind antisemitische Verschwörungsglauben weit verbreitet. In Ungarn stimmten gar 44% der befragten Bürger*innen diesem Satz zu, 49% glauben, „ dass Juden eine entscheidende Rolle in internationalen Finanzinstitutionen anstreben“ (vgl. Verseck, 2018)
Diese judenfeindlichen Aussagen werden durch die Verbreitung von Verschwörungsideologien, die ein sogenanntes „ Weltjudentum “ hinter politischen – und wirtschaftlichen Strukturen vermuten, verbreitet. Die Art von
Verschwörungsmythos tritt seit Jahrhunderten in unterschiedlichen Narrativen auf, nur die Elemente werden an den aktuellen Zeitgeist angepasst – das Feindbild bleibt unterdessen stets dasselbe: Jüdinnen und Juden (vgl. Pipes, 1998:140).
Die nachfolgende Arbeit soll sich mit antisemitischen Verschwörungstheorien in der Neuzeit befassen, und konkret auf die sogenannte „ jüdische Weltverschwörung “ eingehen. Es soll aufgezeigt werden, wie antisemitische Feindbilder durch Verschwörungstheorien geschaffen wurden, und stetig neu instrumentalisiert werden. Ziel ist es, nicht die Verschwörungstheorien nur durch Fakten zu widerlegen, sondern auf ihre Dynamik und Ideologie einzugehen. Hierfür wird zunächst der Begriff der Verschwörungstheorie definiert, und ein Überblick geschaffen, warum diese populär sind. Anschließend wird ein kurzer historischer Überblick über antisemitische Ressentiments und die Anfänge antisemitischer Verschwörungstheorien gegeben, um im Hauptteil dann auf antisemitische Verschwörungstheorien in der Neuzeit ab dem 21. Jahrhundert einzugehen.
2. Begriffsdefinition, Erklärung und Funktion von Verschwörungstheorien
Die vorliegende Arbeit wird sich wissenschaftlich mit nicht-wissenschaftlichen Annahmen auseinandersetzen, und Bezeichnungen wiedergeben, die von Anhänger*innen von Verschwörungstheorien verbreitet werden. Diese vermeintlichen Termini werden in der verschwörungsideologischen Szene in pseudo-wissenschaftlichen Kontexten wiedergegeben, um einen Eindruck von Sachlichkeit zu vermitteln. Deswegen werden diese Begriffe nachfolgend in Anführungszeichen und kursiv gesetzt, um deutlich zu machen, dass es sich weder um etablierte noch fundierte Bezeichnungen handelt, sondern Wortkonstruktionen sind, die Synonyme und Metaphern für antisemitische Weltbilder transportieren.
2.1 Definition und Erklärung des Begriffs der Verschwörungstheorie
Der deutsche Duden definiert Verschwörungstheorien folgendermaßen:
„ Vorstellung, Annahme, dass eine Verschwörung, eine verschwörerische
Unternehmung Ausgangspunkt von etwas sei “
(Der Duden, 2018).
Eine Verschwörungstheorie beinhaltet stets die Annahme, dass sich eine verborgene Gruppe zusammengeschlossen hat, die gemeinsam einen Plan verfolgen, einer anderen Gruppe zu schaden (vgl. Rieger, 2018). Die meisten Verschwörungstheorien sind eine Mischung aus falschen Behauptungen und verdrehten Fakten, und bauen auf Feindbilder und Stereotypen auf (vgl. Kaufmann, 2017). Die populärsten Verschwörungstheorien beschuldigen als „geheime“ Akteur*innen Gruppierungen wie die „ Freimaurer “, „ die Juden “ und/oder die USA und Israel.
Aus wissenschaftlicher Perspektive ist der Begriff der Verschwörungstheorie unpassend, da keine tatsächliche Theorie vorliegt, die durch Erkenntnisse belegt wurde. Verschwörungstheoretiker*innen gehen von einem geschlossenen Weltbild aus, und widersetzen sich realen Fakten. Die Weltanschauung basiert auf Fiktion, die nicht durch Logik oder Rationalität widerlegt werden kann. Sowohl eine wissenschaftliche als auch sachliche Auseinandersetzung ist in weiten Teilen der Verschwörer*innen-Szene nicht möglich, da Beweise durch eine umgedrehte Wirklichkeitsperspektive ausgeschaltet werden, beispielsweise durch sogenannte Scheinargumente, wie dass Medienlandschaften per se einer „ Lügenpresse “ angehören. Deswegen wäre der Begriff Verschwörungsmythos oder Ideologie passend, jedoch hat sich der Begriff der Verschwörungstheorie sowohl im Volksmund als auch im literarischen Gebrauch durchgesetzt, und wird deswegen in der nachfolgenden Arbeit ebenfalls verwendet (vgl. Jaecker, 2005: 14).
2.2 Psychologische Funktionen von Verschwörungstheorien
In der Geschichte der Menschheit tauchen über Jahrhunderte hinweg Verschwörungstheorien auf. Die Popularität steigt vor allem dann, wenn sich die Gesellschaft in einer Krise befindet und/oder sich gesellschaftliche Strukturen ändern. Im Zeitalter der Globalisierung und der Demokratisierung des Internets, in der jeder Mensch die Möglichkeit hat, seine Meinung im Internet darzustellen, verbreiten sich Verschwörungsmythen zahlreicher und schneller. Verschwörungstheoretiker*innen finden Zustimmung in sozialen Netzwerken, und eine Plattform, um diese zu teilen.
In diesem Kapitel soll geklärt werden, warum Verschwörungstheorien so populär sind, und welchen Reiz sie für Menschen ausmachen. Die soziologische Forschung geht von gesellschaftlichen und individuellen Faktoren für die Popularität von Verschwörungstheorien aus (vgl. Amadeu-Antonio-Stifung: 17).
Die Amadeu-Antonio Stiftung listet hierfür in ihrem Forschungsbericht „No World Order – Wie antisemitische Verschwörungstheorien die Welt verklären“ vier Funktionen auf (2015: 9):
- Di e sinnstiftende Funkti on:
Verschwörungstheorien erklären sehr komplexe Zusammenhänge einfach und verständlich. Die menschliche Psychologie neigt dazu, unerwartete Ereignisse in der Welt deuten und erklären zu wollen, insbesondere wenn diese negativ sind, wie beispielsweise Epidemien, Wirtschaftskrisen oder Naturkatastrophen. Dies ermöglicht ein Gefühl von Vorhersehbarkeit und die fiktive Sicherheit, Vorgänge auf der Welt selbst kontrollieren zu können. Ähnlich verhält es sich bei Religionen, die Naturkatastrophen als „Beweis des Zorn Gottes“ ansehen, der durch Frömmigkeit oder Opfergaben durch den Menschen beeinflusst werden kann. Dies gibt ein Gefühl der abstrakten Selbstbestimmung wieder (vgl. Götz-Laufenberg, 2017).
Aus pädagogischer Sicht sind die Popularität von Verschwörungstheorien so zu erklären, dass Menschen im Normalfall im Kindesalter die Ambiguitätstoleranz erlernen. Das Wort beschreibt die Fähigkeit, mit inneren Konflikten und Widersprüchen umgehen zu können. Erhalten Kinder keinen Raum, um Selbstvertrauen zu entwickeln, und zu erlernen, mit eigenen Problemen umzugehen, tritt schnell Überforderung in Form von Wut und Panik auf. Dies kann im Erwachsenenalter dazu führen, dass keine Konfliktfähigkeit ausgeprägt wurde und diese Personen anfälliger werden dafür, Widersprüchlichkeiten durch banale Erklärungsmuster zu deuten – in Form einer Verschwörungstheorie und Feindbildern, zum Beispiel. Dies hilft gegen die emotionale Überforderung und schafft gleichzeitig das Gefühl von Macht und Überlegenheit. Es gibt Menschen eine fiktive Kontrolle über ihr Leben zurück (vgl. Amadeu-Antonio- Stiftung: 3-6). Während der Pestepidemie im Mittelalter wurde beispielsweise die jüdische Bevölkerung beschuldigt, die Brunnen vergiftet zu haben. Somit wurde ein Erklärungsnarrativ geschaffen, dass damals etwas Unbegreifliches fassbarer gemacht hat, und die Schuld des Einzelnen auf eine andere Gruppe übertragen hat.
- Identitätsfunktion:
Die identitätsstiftende Funktion ist für die Popularität von Verschwörungstheorien zentral, denn sie ermächtigt hilflose, überfor- derte Individuen Teil einer vermeintlich „starken“ Gruppierung zu wer- den. Verschwörungstheorien stellen Weltbilder vereinfacht in schwarz- weiß dar, und erzeugen Wir-Die-Konstruktionen. Es existieren immer die „bösen“ Verschwörer*innen (in dem Fall pauschal „ die Juden “) und die „guten“ Anhänger*innen der Verschwörungstheorie, die diese Verschwörung aufzudecken glauben und damit „allwissend“ und überle- gen sind. Es ermöglicht eine simple Einteilung in Gut und Böse, und so- mit sich selbst zu einer „guten“ Gruppe zu zählen, die frei ist von jegli- cher Schuld. Anhänger*innen von Verschwörungstheorien finden eine Identität in Konstruktionen wie „dem Volk“ (s. Abbildung 1), dem sie nun angehören und können einer anderen Gruppierung die Schuld an gesellschaftlichen oder eigenen Missständen geben. Außerdem stellt es eine irrtümlich angenommene Ordnung in der Welt für sie her, und gibt erneut das Gefühl der Selbstkontrolle zurück. Durch die Bestätigung in sozialen Netzwerken beispielsweise erhalten sie Anerkennung, die ihnen ansonsten in der Gesellschaft möglicherweise nicht wiederfährt und werden Teil einer Gemeinschaft, der sie sonst nicht angehören (Amadeu-Antonio-Stiftung, 2015: 6). Verschwörungstheorien sind heut- zutage einfach zugänglich durch das Internet. In wenigen Sekunden er- hält man bei seiner Recherche Erklärungen für die Terroranschläge des 11.Septembers, hinter denen der US-Geheimdienst und Israel stecken würden (vgl. Meyer-Thoene, 2018). Das heutige Zeitalter ist geprägt durch den wachsenden technischen Fortschritt, der zumindest ober- flächlich für einige Teile der Weltbevölkerung eine Liberalisierung von Werten und Gesellschaftsstrukturen ermöglicht hat. Es hat zur Folge, dass traditionelle Konstruktionen, wie Nationalstaaten und Geschlechter- rollen, zunehmend hinterfragt werden. Gleichzeitig fühlen sich Teile der Bevölkerung bedroht, da ihre gewohnten Identitätszugehörigkeiten hin- terfragt werden. Identitätsstiftende Verschwörungstheorien stellen eine Zuflucht dar, um diese Rollen und Denkmuster (fiktiv) aufrechterhalten zu können.
Die Grafik verbildlicht, wie sich das Selbst – und Fremdbild von Anhä- nger*innen von Verschwörungstheorien in pauschal „gut“ und „böse“ un- terteilt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1 Auswahl allgemeiner Zuordnungen von »gut« und »böse« in Verschwörungsideologien (Quelle: Amadeu-Antonio-Stiftung.(2015). https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/ver- schwoerungen-internet.pdf S.21)
- Manipulationsfunktion
Verschwörungstheorien werden verwendet, um Schuldige für Prozesse auszumachen, und eine Gegenstimmung zu erzeugen. Populist*innen und rechte Ideolog*innen bedienen sich Feindbildern, die es leicht machen, Bevölkerungsgruppen gegeneinander auszuspielen. Ein wiederkehrendes Beispiel ist „ das Volk “ das gegen eine „ Elite “ kämpft. Manipuliert werden damit heutzutage sogar Wahlkämpfe. So wie bei den Kongresswahlen der USA im November als Präsident Donald Trump die Karawane geflüchteter Menschen aus Latein- amerika als eine „ Invasion “ bezeichnete, unter die sich auch Terrorist*innen gemischt hätten, und dies angeblich durch die demokratische Partei unterstützt wurde, um die Republikanische Partei zu schwächen (vgl. Pitzke, 2018). Im Mittelalter führten diese Art von Verschwörungstheorien, die gezielt eingesetzt wurden, um die Bevölke- rung zu manipulieren, zu Pogromen, Verfolgungen und legitimierten Morden. Mehr als 50.000 Menschen (davon 80% Frauen) wurden durch Hexenverfolgungen, die durch Verschwörungstheorien des katholischen Klerus angefacht wurden, bis zum Ende des 17.Jahrhunderts verbrannt. Die Hexenverbrennungen und die Verfolgung jüdischer Menschen fan- den dann statt, wenn die Gesellschaft unter Hunger und Epidemien litt und bot eine gelegene Möglichkeit um von politischen Missständen ab- zulenken(vgl. Aufmkolk, 2018).
- Legitimationsfunktion
Verschwörungstheorien werden letztendlich dazu verwendet, Gewalt gegen die betroffenen Gruppierungen zu rechtfertigen. Durch eine verdrehte Perspektive, die eine Gruppe als pauschal „böse“ identifiziert, wird jegliche Unterdrückung als legitim und gerecht empfunden. Da den „ V erschwörer*innen “ selbst ein Maß an Grausamkeit angedichtet wird, scheinen gewalttätige „Gegenaktionen“ als „Lösung“ akzeptiert zu werden. Das Ausmaß der Unterdrückung reicht im Extremfall bis zu der Massenvernichtung der betroffenen Bevölkerungsgruppe. Ein aktuelles Beispiel ist der Anschlag auf die Tree-of-Life -Synagoge der Pittsburgh Gemeinde in den Vereinigten Staaten, bei dem ein bekennender Antise- mit elf Menschen während des Sabbat-Feiertages mit den Worten „ Alle Juden müssen sterben “ erschoss. Zuvor kündigte der Attentäter seine Tat in einem rechten sozialen Netzwerk an, und schrieb „ Ich kann nicht sitzen bleiben und zusehen, wie meine Leute abgeschlachtet werden. (…)“ (vgl. Tagesschau, 2018). Es wird deutlich, dass der Täter davon ausging seine Tat wäre die „gerechte Rache“ an der jüdischen Bevölke- rung für eine vermeintliche Verschwörung gegen „ seine Leute “. Die Per- spektive von Anhänger*innen von Verschwörungstheorien ist bis zu dem Pensum verdreht, dass sie sich motiviert sehen, Hass und Gewalt gegen betroffene Personen anzuwenden und sich dies problemlos in ihr sub- jektives Empfinden von Gerechtigkeit fügt (vgl. Antonio-Amadeu-Stif- tung: 23).
Wenn diese Verschwörungsmythen pauschal Jüdinnen und Juden – oder in der Neu- zeit den Staat Israel – als Schuldige ausmachen handelt es sich um antisemitische Verschwörungstheorien.
[...]