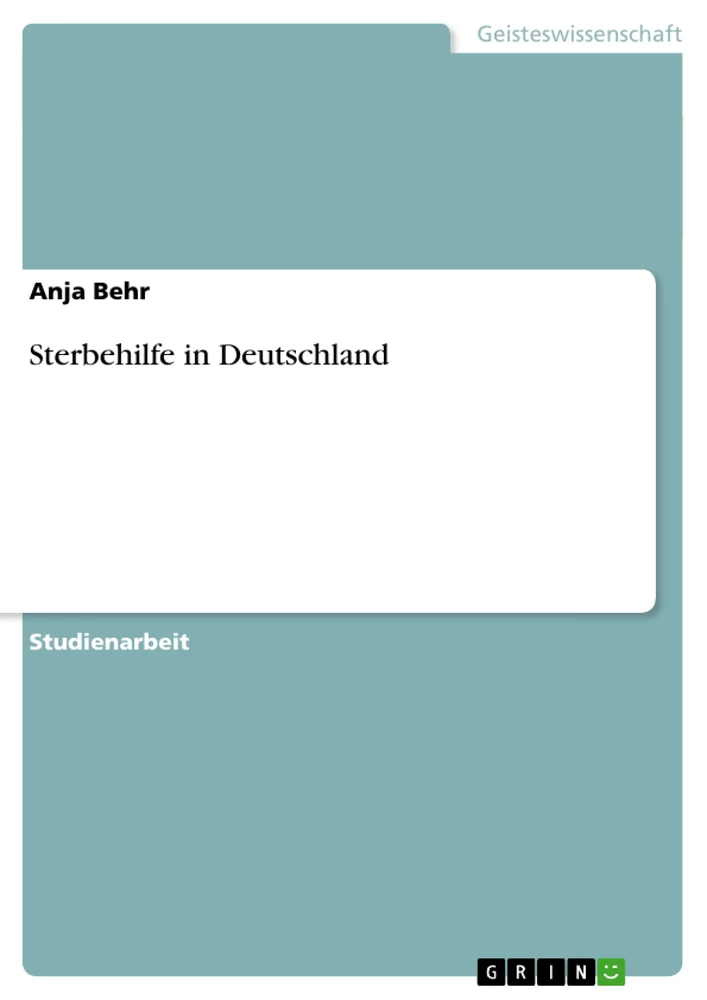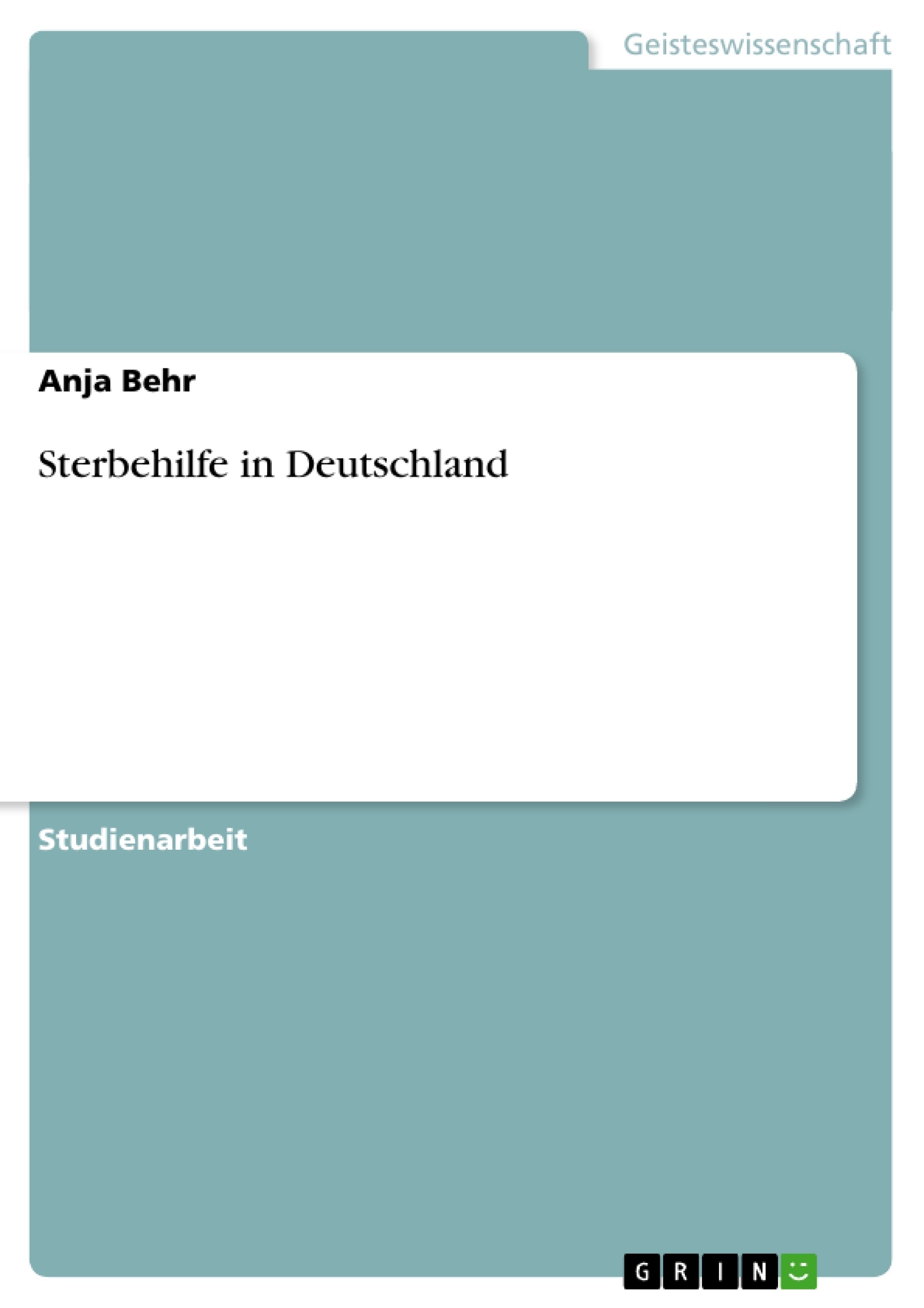Durch die großen Fortschritte der Medizin und damit auch durch das gestiegene Lebensalter hat die Diskussion über Sterbehilfe (= Euthanasie) in den letzten Jahren in Europa erhebliche Ausmaße angenommen. Die furchtbaren Erfahrungen, die viele Menschen während der Zeit des Dritten Reiches machen mussten, verhinderten vor allem in Deutschland sehr lange eine Diskussion über diese Thematik. Seitdem die Niederlande und Belgien im Jahr 2002 die aktive Sterbehilfe legalisiert haben, wird auch in Deutschland dieses Thema wieder mehr in der Öffentlichkeit diskutiert.
Im Nationalsozialismus wurde der Begriff der Euthanasie (griech. Ableitung vom „leichten Tod“) mit dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses zur Tötung „lebensunwerten Lebens“ missbraucht. Aufgrund dessen wird gerade in Deutschland nur noch selten von diesem Begriff Gebrauch gemacht. Man spricht allgemein von Sterbehilfe. Allerdings gibt es nicht die Sterbehilfe sondern man unterscheidet verschiedene Formen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Begriffliche Klärungen
2. Die Rechtslage in Deutschland
2.1. Ärztliche Sicht
2.2. Juristische Sicht
2.3. Patientenautonomie
3. Sterbehilfe im Ausland
3.1. Niederlande
3.2. Belgien
3.3. Schweiz
3.4. Dänemark
4. Ausblick
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Durch die großen Fortschritte der Medizin und damit auch durch das gestiegene Lebensalter hat die Diskussion über Sterbehilfe (=Euthanasie) in den letzten Jahren in Europa erhebliche Ausmaße angenommen. Die furchtbaren Erfahrungen, die viele Menschen während der Zeit des Dritten Reiches machen mussten, verhinderten vor allem in Deutschland sehr lange eine Diskussion über diese Thematik. Seitdem die Niederlande und Belgien im Jahr 2002 die aktive Sterbehilfe legalisiert haben, wird auch in Deutschland dieses Thema wieder mehr in der Öffentlichkeit diskutiert.
Im Nationalsozialismus wurde der Begriff der Euthanasie (griech. Ableitung vom „leichten Tod“) mit dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses zur Tötung „lebensunwerten Lebens“ missbraucht. Aufgrund dessen wird gerade in Deutschland nur noch selten von diesem Begriff Gebrauch gemacht. Man spricht allgemein von Sterbehilfe. Allerdings gibt es nicht die Sterbehilfe sondern man unterscheidet verschiedene Formen.
1.1. Begriffliche Klärungen
a) Indirekte Sterbehilfe
Bei der indirekten Sterbehilfe handelt es sich um die Gabe von Schmerzmitteln (z.B. Morphium), die als Nebenwirkung die Lebensdauer eines Menschen herabsetzen können. Hierbei wird der möglicherweise früher eintretende Tod in Kauf genommen.
b) Direkte Sterbehilfe
Bei der direkten Sterbehilfe unterscheidet man zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe. Die aktive Sterbehilfe ist die gezielte Tötung zur Verkürzung der Leiden eines anderen Menschen. Passive Sterbehilfe liegt dann vor, wenn lebensverlängernde Maßnahmen, wie Beatmung, künstliche Ernährung oder die Gabe von Medikamenten, unterlassen oder abgebrochen werden.
c) Suizidbeihilfe
Wenn ein Dritter an einer fremden Selbsttötung mitwirkt, handelt es sich um Suizidbeihilfe. Die Selbsttötung wird hierbei vom Patienten selbst durchgeführt.
2. Die Rechtslage in Deutschland
2.1. Ärztliche Sicht
Das Selbstbestimmungsrecht eines Menschen über den eigenen Körper wird mit den Artikeln 1 und 2 des Grundgesetzes durch die geschützte Würde und Freiheit erfasst. Dieses Recht zur Selbstbestimmung gilt auch am Lebensende. Da viele Menschen Angst vor einem langdauernden, qualvollen Sterben haben, kann die Durchsetzung dieses Rechtes auch in der Forderung nach einer Sterbehilfe liegen. Viele Ärzte fühlen sich damit oft überfordert, da es ihre Verpflichtung ist, Leben zu erhalten und nicht zu töten. Allerdings kann die Verhinderung oder Verzögerung des Todes eine Maßnahme darstellen, die nicht der Würde des Menschen entspricht.[1]
Die Entscheidung, ob ein Leben erhalten werden soll, kann aber nicht allein vom Arzt gefällt werden. Deshalb hat die Bundesärztekammer im November 1998 Grundsätze zur ärztlichen Sterbebegleitung erlassen. Darin heißt es: „Es ist Aufgabe des Arztes, unter Beachtung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten Leben zu erhalten, Gesundheit zu schützen und wiederherzustellen, sowie Leiden zu mindern und Sterbenden bis zum Tod beizustehen.“[2]
Die Verpflichtung zur Lebenserhaltung besteht aber nicht unter allen Umständen. Allerdings darf die Entscheidung hierzu nicht von wirtschaftlichen Erwägungen abhängig gemacht werden. Eine Basisverpflegung des Patienten muss immer gewährleistet sein, auch wenn nur noch eine Symptombekämpfung stattfindet.[3]
In den Grundsätzen der Bundesärztekammer wird betont, dass aktive Sterbehilfe verboten ist, selbst dann, wenn der Patient danach verlangt. Weiterhin darf der Arzt auch nicht zu einer Selbsttötung des Patienten beitragen. Maßnahmen zur Lebensverlängerung dürfen unterlassen oder abgebrochen werden, wenn der Patient zustimmt. Wenn der Patient nicht einwilligungsfähig ist, wird – falls vorhanden – der Patientenverfügung eine große Bedeutung zugeschrieben.[4]
2.2. Juristische Sicht
Das Thema Sterbehilfe ist in keinem deutschen Gesetz geregelt, auch nicht im Strafrecht. Deshalb kann nur auf die bisherige Rechtsprechung zurückgegriffen werden.
Eine fachgerechte Schmerz- und Symptombehandlung unter Inkaufnahme einer Lebensverkürzung, also indirekte Sterbehilfe, ist nicht strafbar. Dies wird mit dem Art. 1 des Grundgesetzes begründet, wonach einem Patienten ein Tod in Würde und Schmerzfreiheit ermöglicht werden muss, wenn er dies wünscht.[5]
Aktive Sterbehilfe, also die gezielte Tötung von Patienten, ist in Deutschland verboten. Wird die aktive Sterbehilfe ohne Wissen und Wollen des Patienten geleistet, kommt der Tatbestand des Mordes nach § 211 StGB in Betracht. „Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln (…) einen Menschen tötet.“[6] Der Mörder muss mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe rechnen. Wenn der Sterbehilfe Leistende nicht wegen der genannten Mordmerkmale sondern aus reinem Mitleid handelt, kommt eine Bestrafung wegen Totschlags gemäß § 212 StGB in Betracht. Hier ist eine Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren zu erwarten. Hat ein Patient ausdrücklich um Sterbehilfe gebeten, dann liegt eine Tötung auf Verlangen nach §216 StGB vor. Dies wird mit einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft.[7]
Die passive Sterbehilfe ist nur dann zulässig und straffrei, wenn die ärztliche Behandlung das Recht eines Menschen auf menschenwürdiges Sterben verletzen würde und wenn der Patient die passive Sterbehilfe wünscht. Ob und wie lange ein Patient ärztlich behandelt werden will, kann entweder durch eine direkte Äußerung oder durch eine Patientenverfügung übermittelt werden. Schwierig wird die Sache, wenn der Patient sich nicht mehr äußern kann oder nicht entscheidungsfähig ist und auch keine Patientenverfügung vorliegt. In solch einem Fall muss der Arzt den mutmaßlichen Willen des Patienten ermitteln. Zur Ermittlung werden frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen des Patienten, seine religiöse Überzeugung, seine sonstigen persönlichen Wertvorstellungen, seine altersbedingte Lebenserwartung und sein Erleiden von Schmerzen herangezogen. Im Zweifel aber hat immer der Schutz des menschlichen Lebens Vorrang.[8]
Aufgabe eines Arztes ist es auch, einen Suizid im Rahmen der ärztlichen Möglichkeiten zu verhindern. Wenn sich aber ein Patient trotz aller ärztlichen Bemühungen entschließt, sein Leben zu beenden, so soll keine ärztliche Verpflichtung bestehen, gegen den ausdrücklichen Willen des Patienten lebenserhaltend einzugreifen. Suizidbeihilfe ist deshalb auch nicht strafbar, solange die letzte Entscheidung über die Herbeiführung des Todes beim Patienten verbleibt.[9]
[...]
[1] Vgl. Oehmichen, 1995, S. 274
[2] http://www.bundesaerztekammer.de/10/0039Sterbebegleitung.pdf
[3] Vgl. http://www.bundesaerztekammer.de/10/0039Sterbebegleitung.pdf
[4] Ebd.
[5] Vgl. http://www.patiententestament.com
[6] http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/stgb/, Bundesministerium der Justiz, §211 StGB
[7] Vgl. http://www.patiententestament.com
[8] Ebd.
[9] Vgl. http:/www.bmj.bund.de, Bericht der Arbeitsgruppe