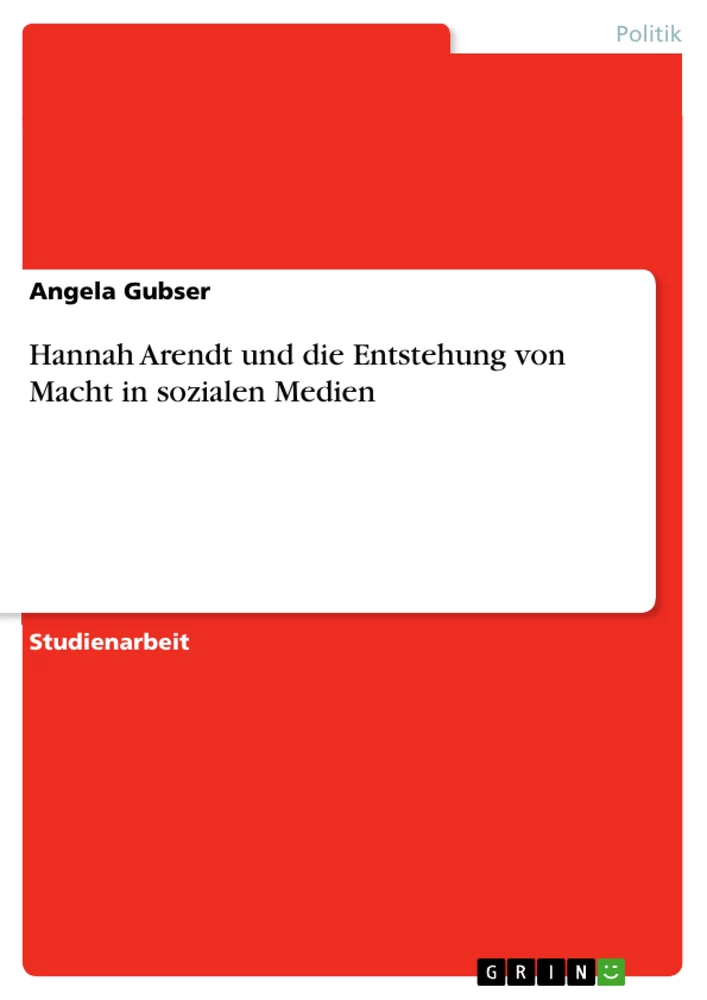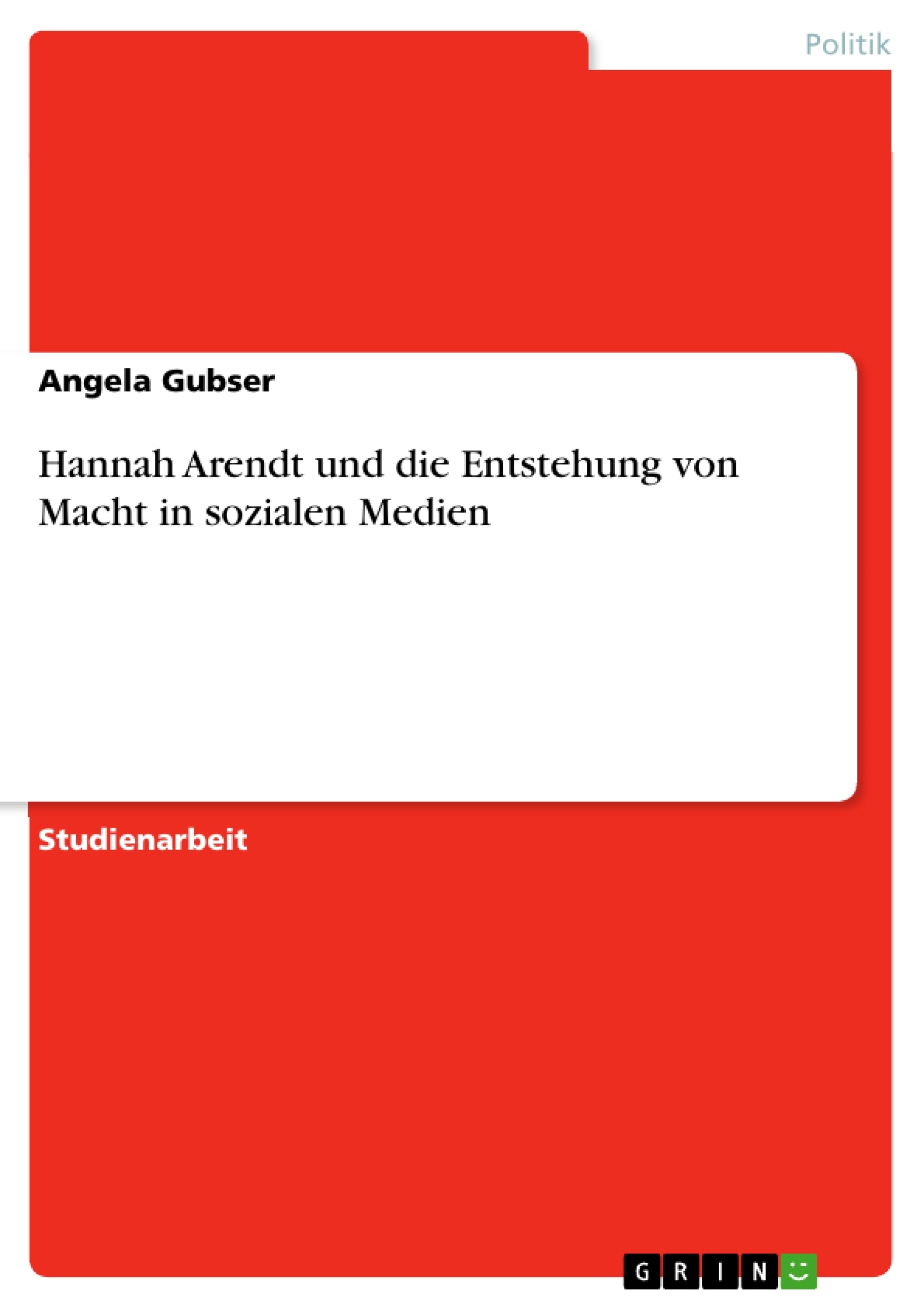In den letzten Jahren kam es zu einem stetig wachsenden Aufkommen von Onlinekampagnen, die mit der Nutzung sozialer Medien einhergehen. Solche Kampagnen werden unter anderem unter dem Begriff Slacktivism zusammengefasst, der als risikoarme und kostengünstige Handlung über soziale Medien definiert wird. Deren Zweck ist es, das Bewusstsein für ein Anliegen zu stärken, Veränderungen hervorzurufen oder Befriedigung zu gewähren. Über die Effektivität solcher Kampagnen herrscht jedoch seit geraumer Zeit eine rege Debatte.
In dieser Seminararbeit steht die Debatte um solche politischen Handlungen online und deren Effektivität im Zentrum. Die Debatte wird dabei von denjenigen geprägt, die der Effektivität solcher Handlungen skeptisch gegenüberstehen. Um diesen Kritikpunkt zu klären, soll Hannah Arendts Konzeption von Macht als Grundlage dienen. Genauer gesagt soll die Möglichkeit, politische Macht durch die Nutzung von sozialen Medien zu schaffen, ergründet werden. Macht nach Arendt ist von der Fähigkeit der Bevölkerung gemeinsam politisch aktiv zu handeln, gekennzeichnet. Mit neuen Plattformen und Tools, die in einem vernetzten globalen Kontext verfügbar sind, werden die Grenzen von Nationalstaaten überschritten und öffentliche Räume erweitert. Daher wird es auch notwendig, Arendts Konzept in einem erweiterten Kontext zu betrachten. Das Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, dass solche Onlinekampagnen durchaus geeignet sind, um mit politischem Handeln und der damit verbundenen Erzeugung von Macht in Einklang zu stehen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Politische nach Hannah Arendt
2.1 Politisches Handeln.
2.2 Die Entstehung des öffentlichen Raums
2.3 Der kommunikative Machtbegriff
3. Das Phänomen Slaktivism
3.1 Definition
3.2 Slaktivism als Form des politischen Handelns
3.3 Der öffentliche Raum und Slaktivism
3.4 Die Entstehung von Macht bei Slaktivism
4. Zusammenfassung und Fazit
5. Literaturverzeichnis