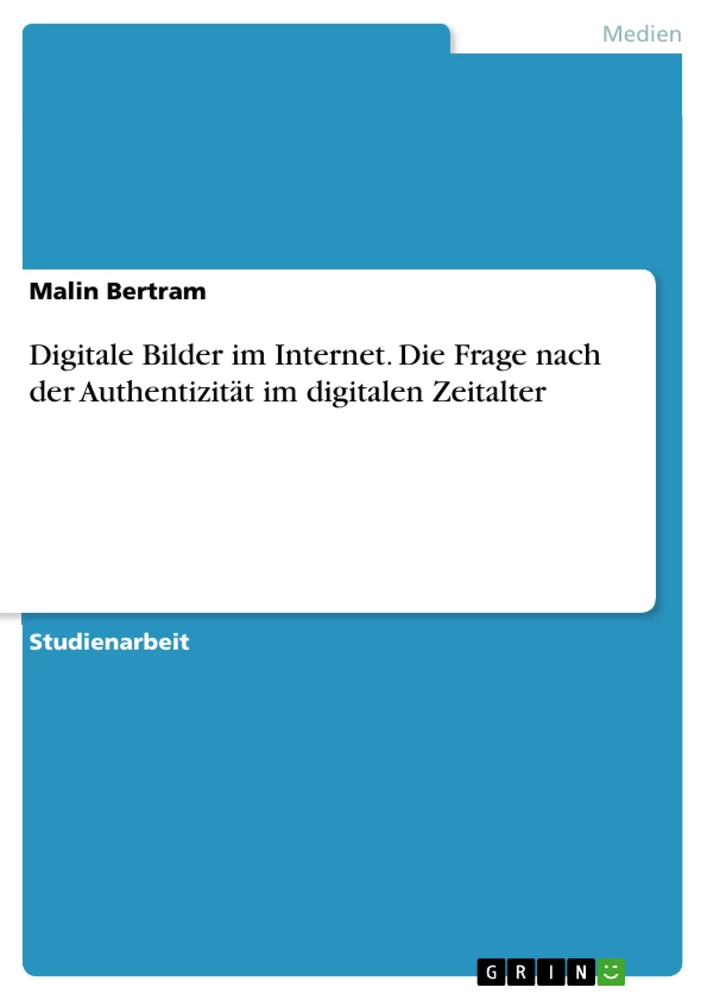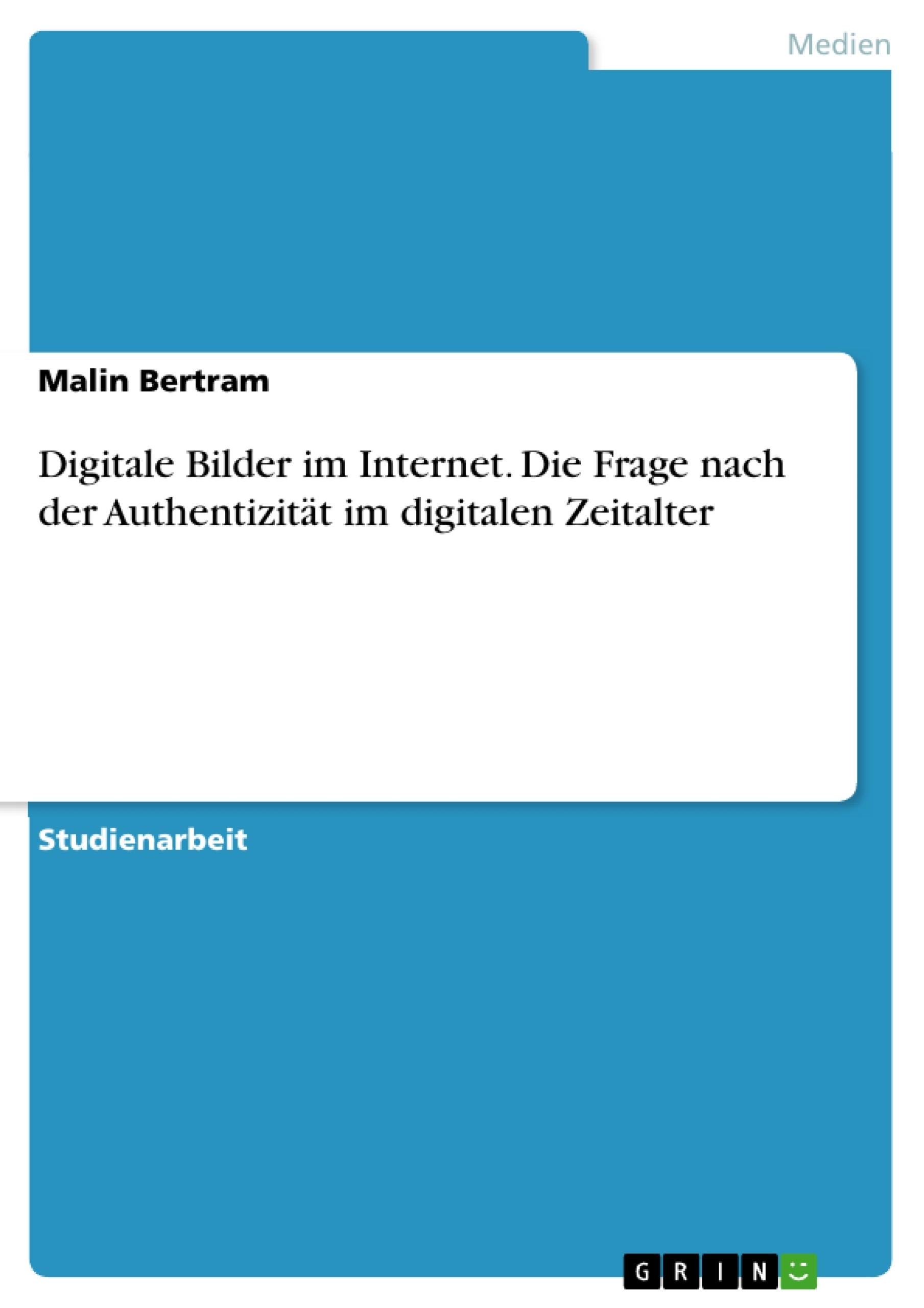Makellose Haut, meterlange Beine und 90-60-90 Körper. Was so perfekt klingt, ist zum Teil der Schein der sozialen Medien – das sagt zumindest Bloggerin und Influencerin Louisa Dellert. Diese versucht durch ihren kreierten Hashtag #FürMehrRealitätAufInstagram auf die ,,digitalen Schönheitsoperationen“ anderer Menschen aufmerksam zu machen und möchte gegen die Bildmanipulationen appellieren. Es stellt sich die Frage: Wie authentisch sind Fotografien im digitalen Zeitalter? Fokus wird hier auf die Bildmanipulation gelegt.
1. Einleitung
2. Die Geschichte der Fotografie
3. Das soziale Netzwerk Instagram
4. App Fotografie
5. Begriffserklärungen
5.1 Authentizität
5.2 Alles inszeniert und nichts authentisch?
5.3 Authentizität im Zeitalter digitaler Bilder und der Bildmanipulation
5.4 Realität
6. Empirischer Teil - #FürMehrRealitätAufInstagram
6.1 Beispiel Alexis Ren
6.2 Bloggerin Louisa Dellert
7. Fazit
8. Anhang
9. Bibliografie
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Geschichte der Fotografie
3. Das soziale Netzwerk Instagram
4. App Fotografie
5. Begriffserklärungen
5.1. Authentizität
5.2. Alles inszeniert und nichts authentisch?
5.3. Authentizität im Zeitalter digitaler Bilder und der Bildmanipulation
5.4. Realität
6. Empirischer Teil - #FürMehrRealitätAufInstagram
6.1. Beispiel Alexis Ren
6.2. Bloggerin Louisa Dellert
7. Fazit
8. Anhang
9. Bibliografie