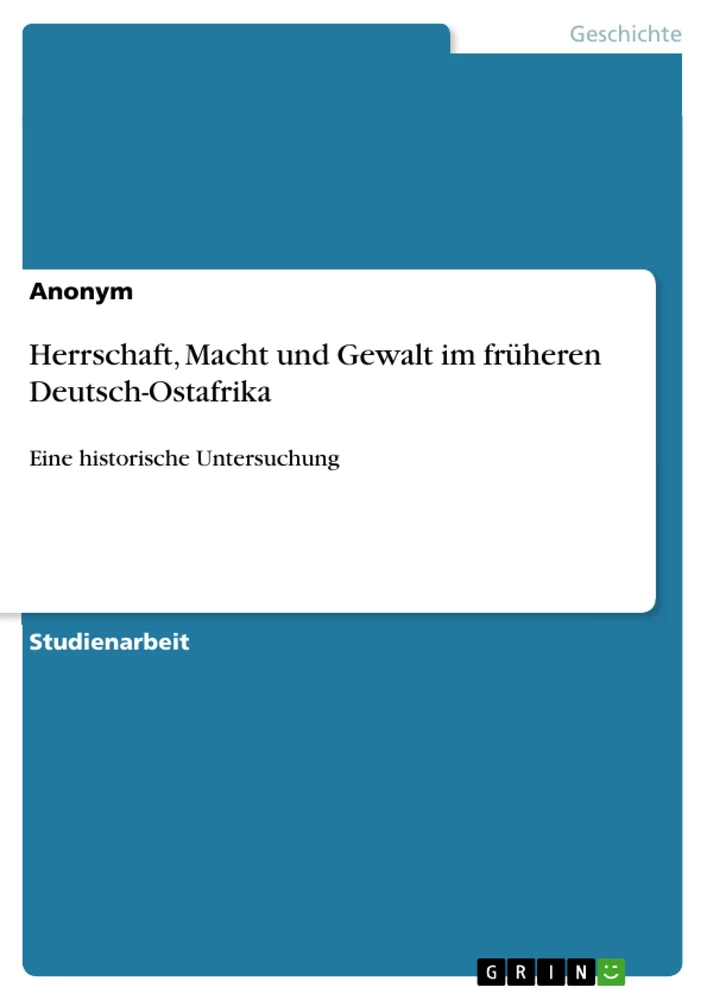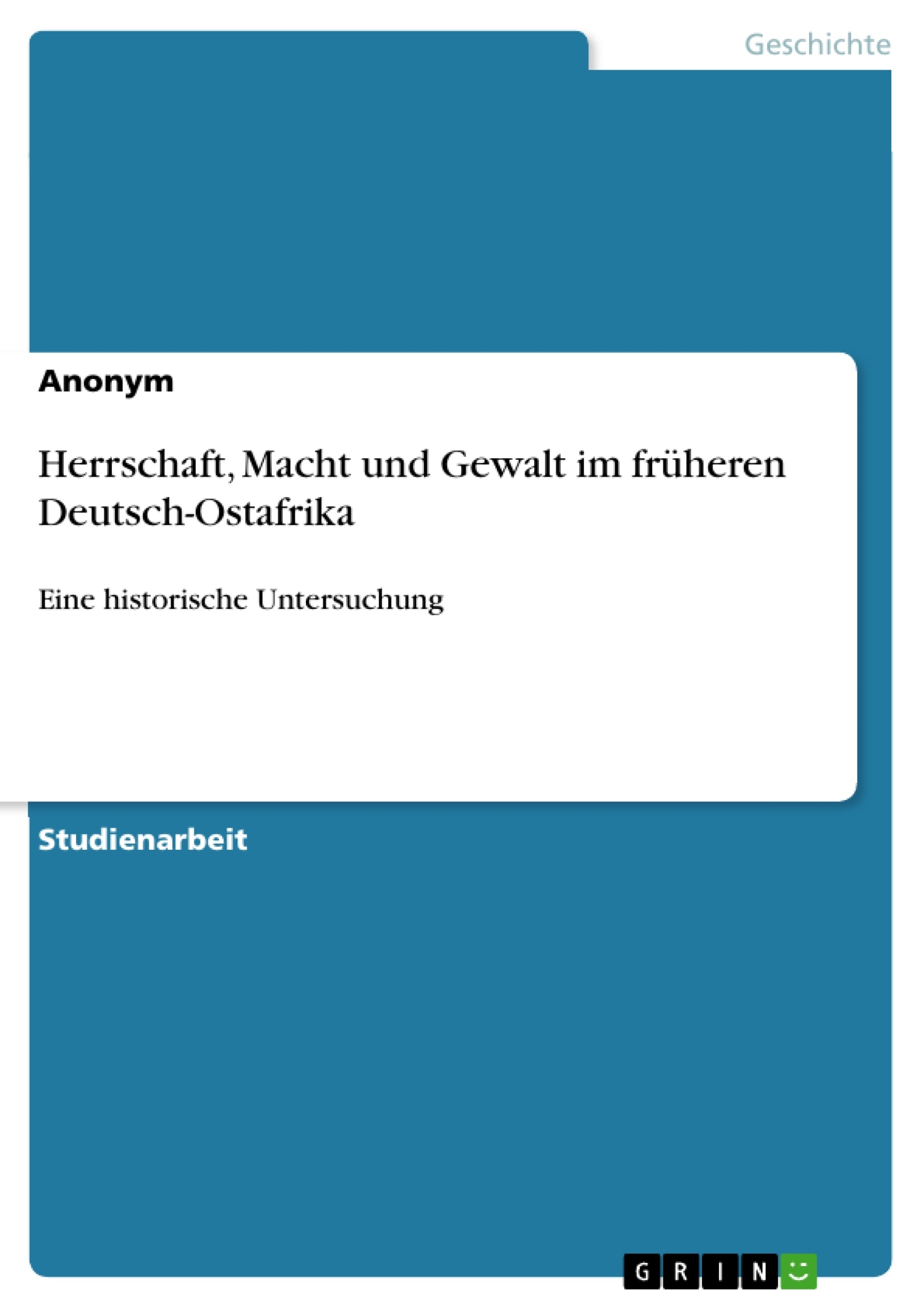Die vorliegende Arbeit zeigt größtenteils die institutionalisierte Herrschaft und manifestierte Macht innerhalb eines kolonialen Kontextes auf. Konkret geht es dabei um das frühere, sogenannte Deutsch-Ostafrika.
Wie häufig in kolonialen Kontexten ist der herkömmliche Herrschaftsbegriff, welcher ein Maß von Legitimität beinhaltet, hier nicht gegeben. Das zeigt die Unrechtmäßigkeit des indirekten Arbeitszwangs und die Willkür, mit der Gesetze geändert wurden sobald erneut ein tiefgreifender Arbeitermangel auftrat.
In der relativ kurzen Zeitspanne von 30 Jahren, die das Kolonialreich Deutschlands andauerte, standen vor allem ökonomische Gewinne im Mittelpunkt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daher mit der Verstrickung der wirtschaftlichen Interessen sowie der Ausbeutung und Unterdrückung der afrikanischen Gesellschaft. Institutionalisierte Macht spielt dabei eine wichtige Rolle. Diese Arbeit stellt die Kolonialbevölkerung nicht als hilflose Objekte institutionalisierter Gewalt dar, sondern verdeutlicht die Willkür der Verwaltung und die makaberen Auffassungen der deutschen Kolonialherren über das kostbarste Gut dieser Kolonie, den schwarzen Körper als Produktionskraft. Des Weiteren wird die Kehrtwende aufgezeigt, in der ein Teil der afrikanischen Bevölkerung sich dem homogenen Machtgefüge teilweise entzieht.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Hinführung zu Foto Nr
3. Einbettung des Fotos
3.1 Die Polizeitruppe
3.2 Koloniale Wirtschaftspolitik
3.2.1 Das System der Zwangsarbeit
3.2.2 Die Prügelstrafe
3.2.3 Die reformistische Phase unter Dernburg und Rechenberg
4. Bezug zum Portfolio
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis