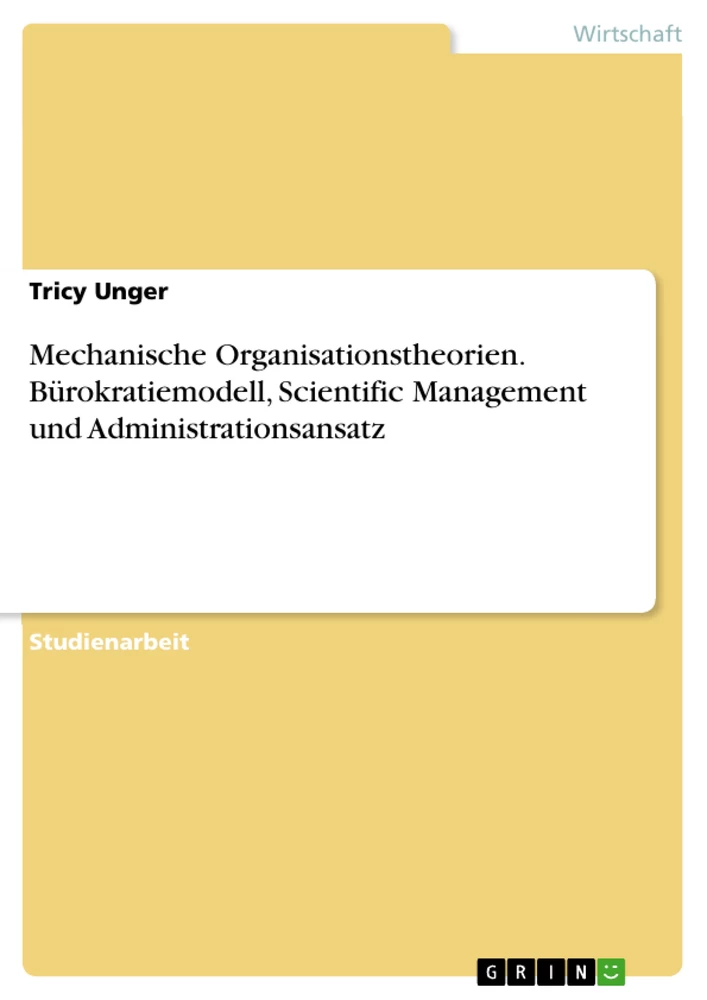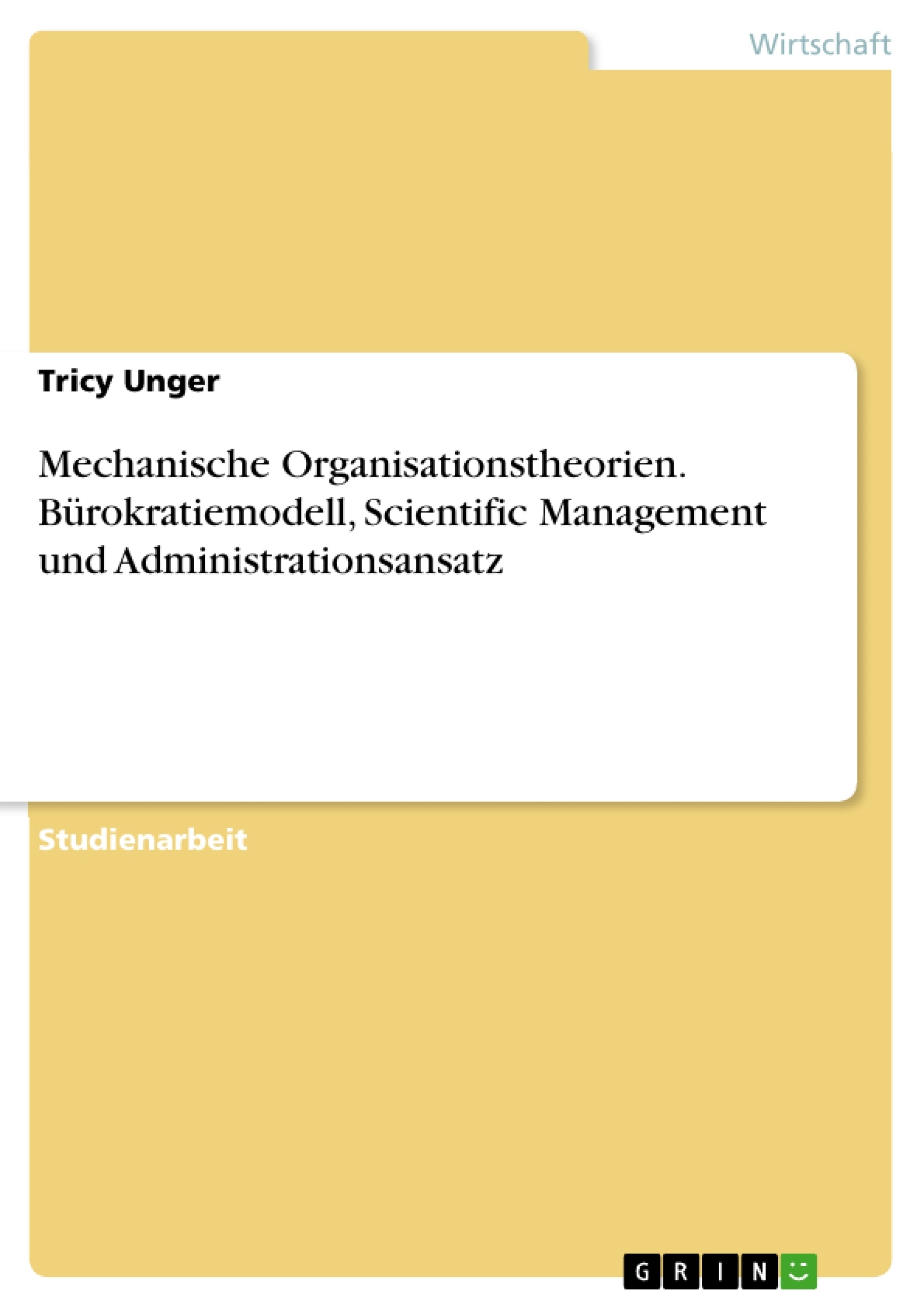Am 10. September 2015 veröffentlichte „The Economist“ einen Artikel in der Schumpeter-Kolumne mit dem Titel „Digital Taylorism“. Knapp 100 Jahre nach der Erarbeitung des Arbeitswissenschaftlichen Ansatzes von Frederick Taylor scheinen seine Prinzipien zur Unternehmensführung und -gestaltung aktueller denn je. Die neue Version, basierend auf den ursprünglichen Gedanken Taylors, wird angereichert durch die Möglichkeiten der digitalen Technologien und kann somit für eine noch größere Anzahl an Mitarbeitern angewandt werden (vgl. The Economist, 2015). Um die Chancen und Risiken dieser Weiterentwicklung verstehen zu können, bedarf es allerdings einem Verständnis für Taylors Ansatz, welcher zu den klassischen Organisationstheorien gehört. Da dieses Feld gleichwohl von weiteren Theoretikern geprägt wurde, soll im Rahmen dieser Arbeit nicht nur der Arbeitswissenschaftliche Ansatz, sondern ebenfalls das Bürokratiemodell von Weber und die Administrationstheorie von Fayol vorge-stellt werden.
Das Primärziel dieses Assignments ist die Beantwortung der Forschungsfrage: „Welche Charakteristika weisen die mechanischen Organisationstheorien Bürokratiemodell, Scientific Management und Administrationsansatz auf?“ Ein Teilziel dessen ist die Einordnung der mechanischen Ansätze innerhalb der Organisationstheorien. Darauf basierend ist ein weiteres Unterziel die Darstellung der drei genannten Ansätze und praktische Erläuterung an jeweils zwei Beispielen.
Bei der Erarbeitung handelt es sich um eine literaturbasierte Analyse. Die Hausarbeit ist in drei wesentliche Teile untergliedert. Zu Beginn werden die mechanistischen, die handlungstheoretischen und die soziologischen Theorien vorgestellt und voneinander abgegrenzt.
Darauf aufbauend beschäftigt sich der Hauptteil mit ausgewählten Ansätzen der mechanistischen Organisationstheorien. Es wird der Bürokratieansatz nach Max Weber, der arbeitswissenschaftliche Ansatz von Frederick Taylor und Henri Fayol´s Administrativer Ansatz vorgestellt. Im Rahmen dessen wird jeweils anfangs ein kurzer biografischer Überblick des Vertreters gegeben. Danach werden die Forschungsinhalte der jeweiligen Modelle vorgestellt. Um eine Überleitung in den praktischen Bereich zu ermöglichen, erfolgt im Anschluss die Darstellung von jeweils zwei praktischen Anwendungsbeispielen. Den dritten Teil des Assigments bildet die kritische Würdigung sowohl des mechanischen Ansatzes an sich als auch der einzelnen Theorien.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Einordnung der mechanischen Organisationstheorien
3. Der Bürokratieansatz
3.1 Vertreter – Max Weber
3.2 Charakteristika
3.3 Anwendungsbeispiele
4. Der arbeitswissenschaftliche Ansatz
4.1 Vertreter – Frederick Winslow Taylor
4.2 Charakteristika
4.3 Anwendungsbeispiele
5. Der administrative Ansatz
5.1 Vertreter – Henri Fayol
5.2 Charakteristika
5.3 Anwendungsbeispiele
6. Kritische Würdigung
7. Fazit
Literaturverzeichnis.