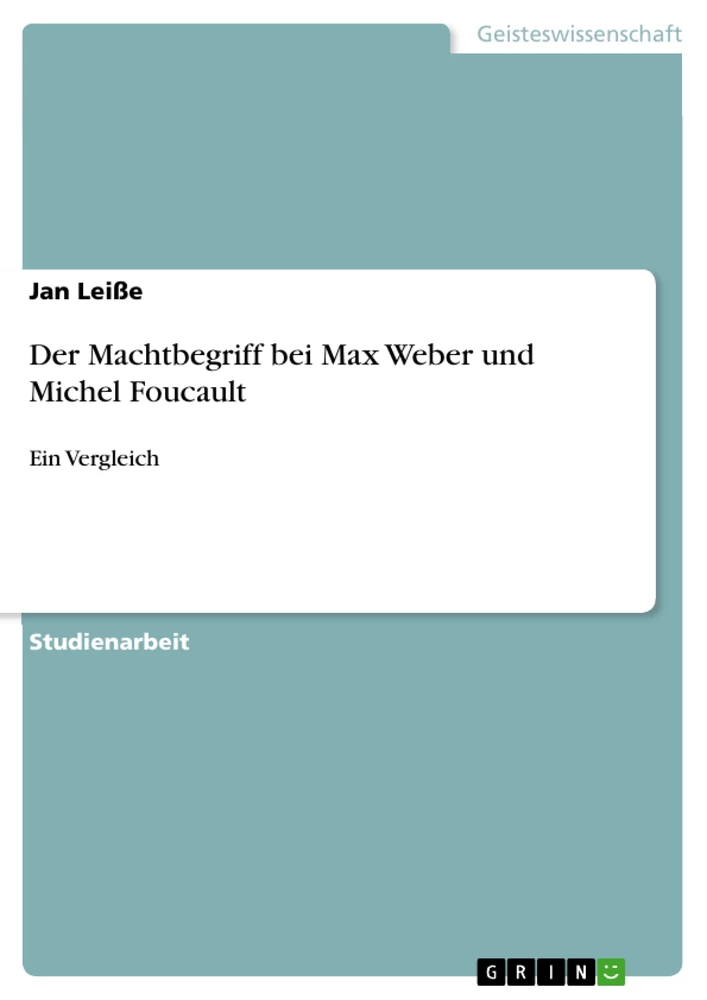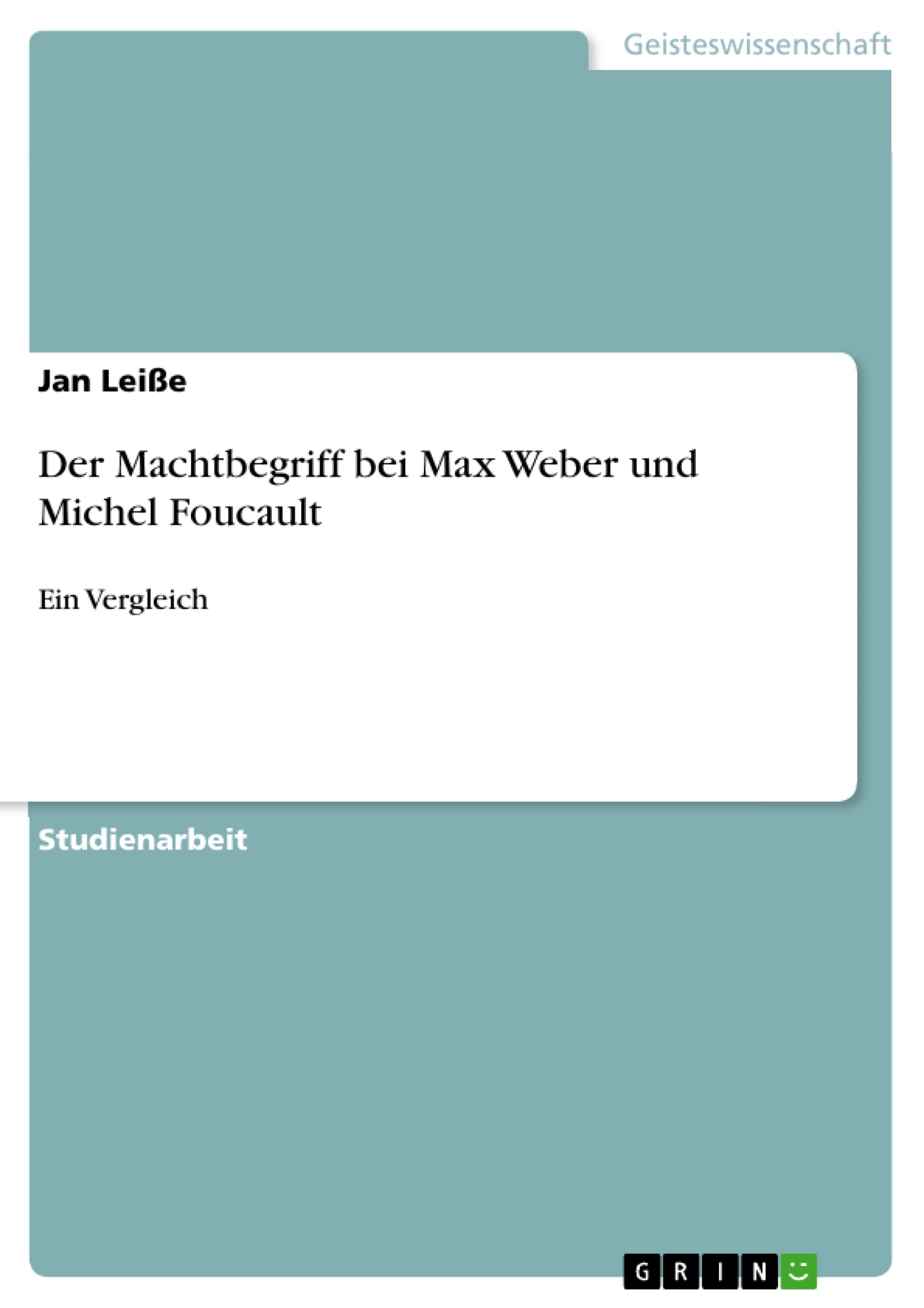Die Hausarbeit behandelt den Machtbegriff in den Werken von Michel Foucault und Max Weber. Dabei wird die Mehrdimensionalität des Begriffes bei Foucault ebenso wie die methodischen und interdisziplinären Vorgehensweisen der Autoren behandelt. Bei Weber werden außerdem die Begriffe von Normen und Sitten untersucht, um eine Vergleichbarkeit mit Foucaults Werk möglich zu machen.
Eine der zentralen Fragen der Soziologie bleibt, was Gesellschaften bestimmt. Denn die Soziologie ist, nach Weber, eine „Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will“ und dies bleibt unmöglich, ohne die gesellschaftlichen Umstände des Handelnden Individuums zu kennen. Fragt man also was die Gesellschaft bestimmt, was sie formt, kommt man um die Frage der Macht nicht herum. Denn die Frage nach dem Was fragt auch nach dem Wer und so zeigt sich, dass seit jeher jedem Motiv, welches als Gesellschaften bestimmend bezeichnet wurde, die Kultur, die Politik, die Religion, eine Machtstruktur zuzuordnen ist. Spätestens mit Marx hat die Frage nach der Macht oder der Herrschaft auch namentlich eine dominantere Rolle in der Soziologie eingenommen.
Und so ist es interessant zu schauen, wie sich das Verständnis und der Ansatz der Untersuchung der Macht in der Soziologie verändert hat. Anhand der Perspektiven von Max Weber, auf dessen Definition von Macht und Herrschaft sich bis heute bezogen wird und Michel Foucaults, welcher mit seinen Untersuchungen der wohl modernste Vertreter der „Machtfrage“ ist und welcher mit seinen Werken eine ganze Generation diese sich stellen ließ.
Beide sind hierbei Grenzgänger der Wissenschaft, Max Weber als Soziologe, Sozialhistoriker, Nationalökonom und Jurist ebenso interdisziplinär wie Michel Foucault als Historiker, Psychologe, Philosoph und Soziologe. Gerade dies macht ihre Perspektive auf ein so allesumfassendes Thema so interessant, ebenso wie die historischen Veränderungen, die zwischen ihnen liegen. Der antiautoritäre und linksintellektuelle Zeitgeist, der Foucaults Umfeld prägte ist weit entfernt von Max Webers bürgerlich-liberalem Umfeld der Jahrhundertwende, umso interessanter ist die Frage nach möglichen Gemeinsamkeiten und Vereinbarkeiten. Inwiefern ähneln sich also die Machtbegriffe bei Max Weber und Michel Foucault und wo sind methodologische und theoretische Gegensätze aufzufinden?
Inhalt
1. Einleitung
2. Der Machtbegriff in Webers verstehender Soziologie
2.1. Webers als „Arbeitsdefinition“
2.2. Theoretischer Ansatz
2.3. Macht und Herrschaft
2.4. Ordnung, Sitte und Beziehung
3. Der Machtbegriff in Foucaults Werken
3.1. Eingrenzung des Werkes
3.2. Machtbeziehungen, Machtnetze und positive Macht
3.3. Macht, Wissen und Diskurs
3.4. Macht und Individuum
4. Ansatz und Anspruch beider Autoren
4.1. Ebenen der Untersuchung
5. Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Definitionen
6. Mögliche Vereinbarkeit
7.Fazit