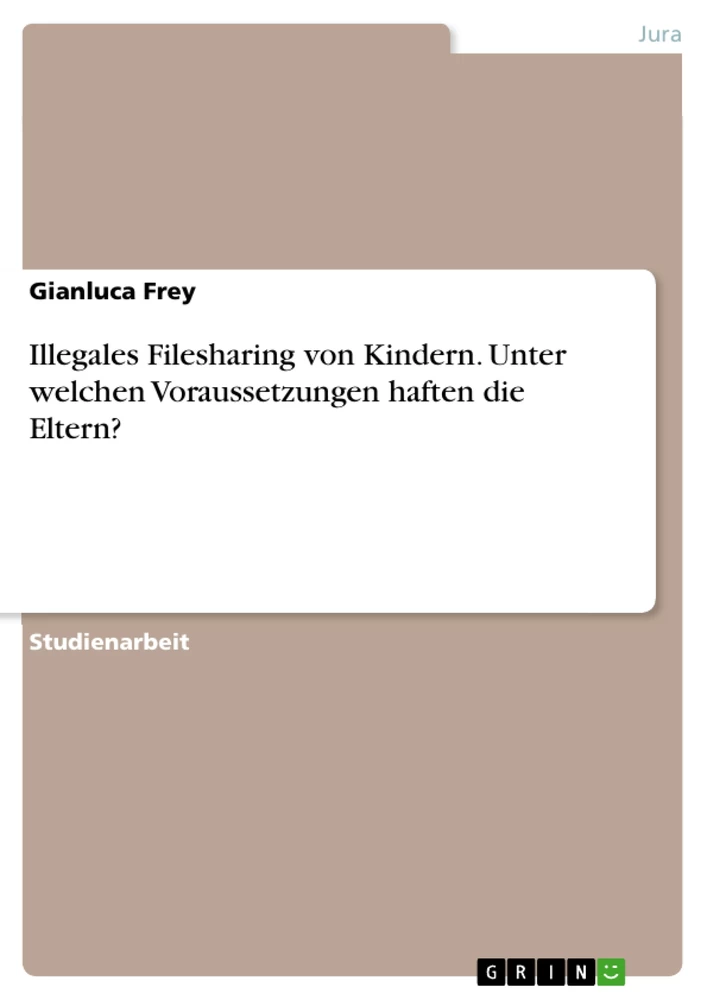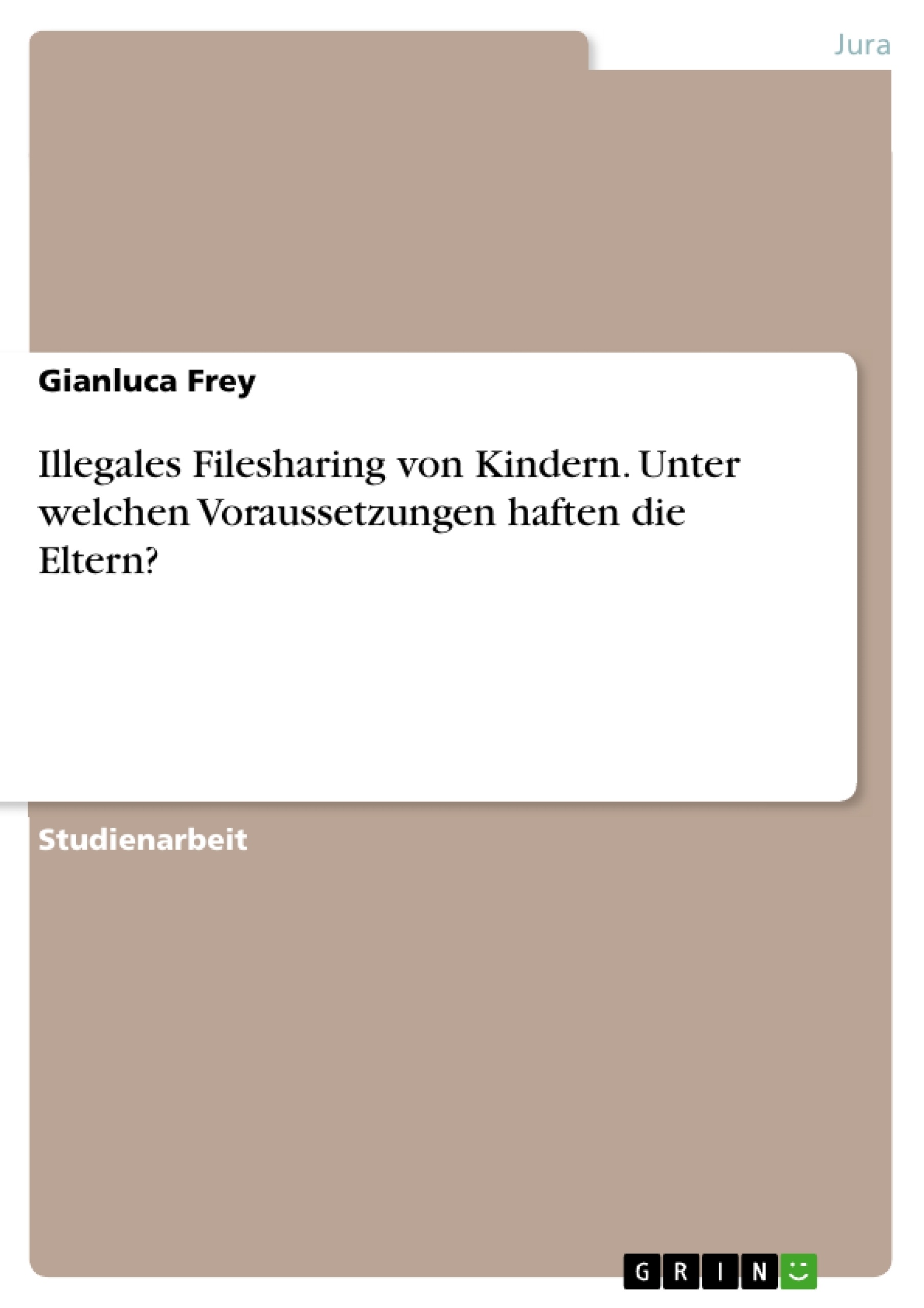Die Haftung der Eltern für illegales Filesharing ihrer Kinder ist in der Öffentlichkeit zu einem heiklen und stark diskutierten Thema geworden. Auf der anderen Seite zeigen aber auch viele Zeitungsartikel, dass es zu dieser Frage keine einheitliche Antwort gibt und dass eine kontroverse Diskussion zu dieser Haftungsfrage nicht nur im gesellschaftlichen, sondern auch im rechtlichen Bereich vorherrscht. Dieses Thema wird in der vorliegenden Arbeit behandelt.
Heutzutage gehört der kabellose Internetanschluss in privaten Haushalten zum nicht mehr wegzudenkenden Inventar. Dabei wird dieser in einem privaten Haushalt meist nur einfach installiert und wie selbstverständlich unter allen, insbesondere unter Familienmitgliedern, geteilt. Was hierbei jedoch in den Hintergrund tritt ist, dass derjenige, der den privaten Internetanschluss einrichtet, die Gefahr trägt, für eventuelle Urheberrechtsverletzungen anderer Anschlussnutzer haftbar gemacht zu werden. In einem familialen Haushalt werden dies meistens die Eltern sein. Für die Rechteinhaber bleibt im Zuge der Anonymität des Internets kaum eine andere Möglichkeit, als zu versuchen, den Anschlussinhaber ausfindig zu machen und diesen zur Haftung zu ziehen. Dabei entstehen Haftungssituationen, in denen die Eltern als Haftungsadressat in Betracht kommen, obwohl die unmittelbare Verletzungshandlung nicht von ihnen ausgeht, sondern oftmals von den eigenen Kindern. Dies ist dem Umstand geschuldet, da der Rechteinhaber nicht hinter den Internetanschluss blicken kann un den unmittelbar Verletzenden unmittelbar identifizieren kann.
Unter dem Vorgang des illegalen Filesharings versteht man, dass jemand eine Datei innerhalb sogenannter "Tauschbörsen" zum Download zur Verfügung stellt, obwohl jemand anderes ein ausschließliches Verwertungsrecht an dieser Datei hat. Viele wissen bei der Nutzung von Tauschbörsen nicht, dass auch wenn man dort nur Dateien herunterlädt, diese automatisch von einem selbst wieder hochgeladen werden, wodurch erst die Rechtsverletzung entsteht. Zu einem viel diskutierten Thema ist das illegale Filesharing zudem durch die massenhaften Abmahnungen geworden, wo Forderungen, teilweise von mehreren hundert Euro für eine Rechtsverletzung, verlangt wurden. Wann der elterliche Anschlussinhaber, auch wenn er selbst nicht der unmittelbare Täter der Urheberrechtsverletzung ist, haftet, wurde im Laufe der Zeit durch Gerichte und Literatur beantwortet.
INHALTSVERZEICHNIS
A. EINLEITUNG
B. HAFTUNG DER ELTERN ALS MITTELBARE STORER UND NACH § 832 BGB
I. ,MILDE" BESTREBUNGEN
1. Haftung fiir volljahrige Kinder
a. Eigenverantwortlichkeit volljahriger Kinder
b. Schutz der Familie Art. 6 Abs. 1 GG
2. Haftung fiir minderjahrige Kinder
a. Rechtsprechung
b. Literatur
II. ,STRENGE" BESTREBUNGEN
1. Belehrungspflichten
2. Uberwachungs- und Kontrollpflichten
3. ,Hamburger Linie"
a. Entscheidungen des LG Hamburg
b. Bestatigung durch andere Gerichte und Literatur
III. ANSICHT DES BGH UND ENTWICKLUNG DER RECHTSPRECHUNG
1. Morpheus
a. Priif- und Verhaltenspflichten
aa. Vorhersehbarkeit der Verletzungshandlung
bb. Wertung des § 1626 Abs. 2 BGB
cc. Ausma6 der Gefahr fiir Rechtsgiiter Dritter
b. Ubertragung auf die Storerhaftung der Anschlussinhaber
2. BearShare
3. Tauschborse
IV. AUSWIRKUNGEN DER ANDERUNG DES TMG
C. DIE TATERSCHAFTLICHE HAFTUNG DES ELTERLICHEN ANSCHLUSSINHABERS
I. TATSACHLICHE VERMUTUNG
II. ANFORDERUNGEN AN DIE SEKUNDARE DARLEGUNGSLAST
1. Nachforschungspflicht
2. Mitteilungspflicht
3. Konsequenzen fiir die Haftung des elterlichen Anschlussinhabers
a. Befragungen der Kinder
b. Untersuchung von Computern
c. Nachforschungspflichten gegeniiber Minderjahrigen .
4. EuGH-Entscheidung im Vorlageverfahren des LG Miinchen I
a. Sachverhalt
b. Vorlagefragen des LG Miinchen
c. Beantwortung der Vorlagefragen
D. ZUSAMMENFASSUNG UND STELLUNGNAHME