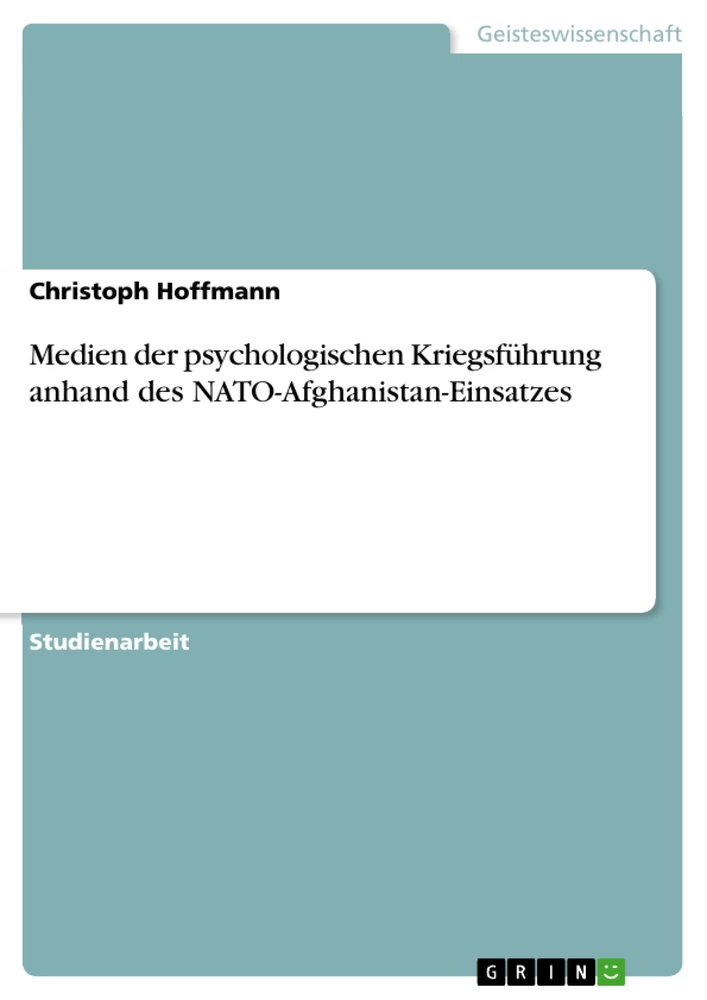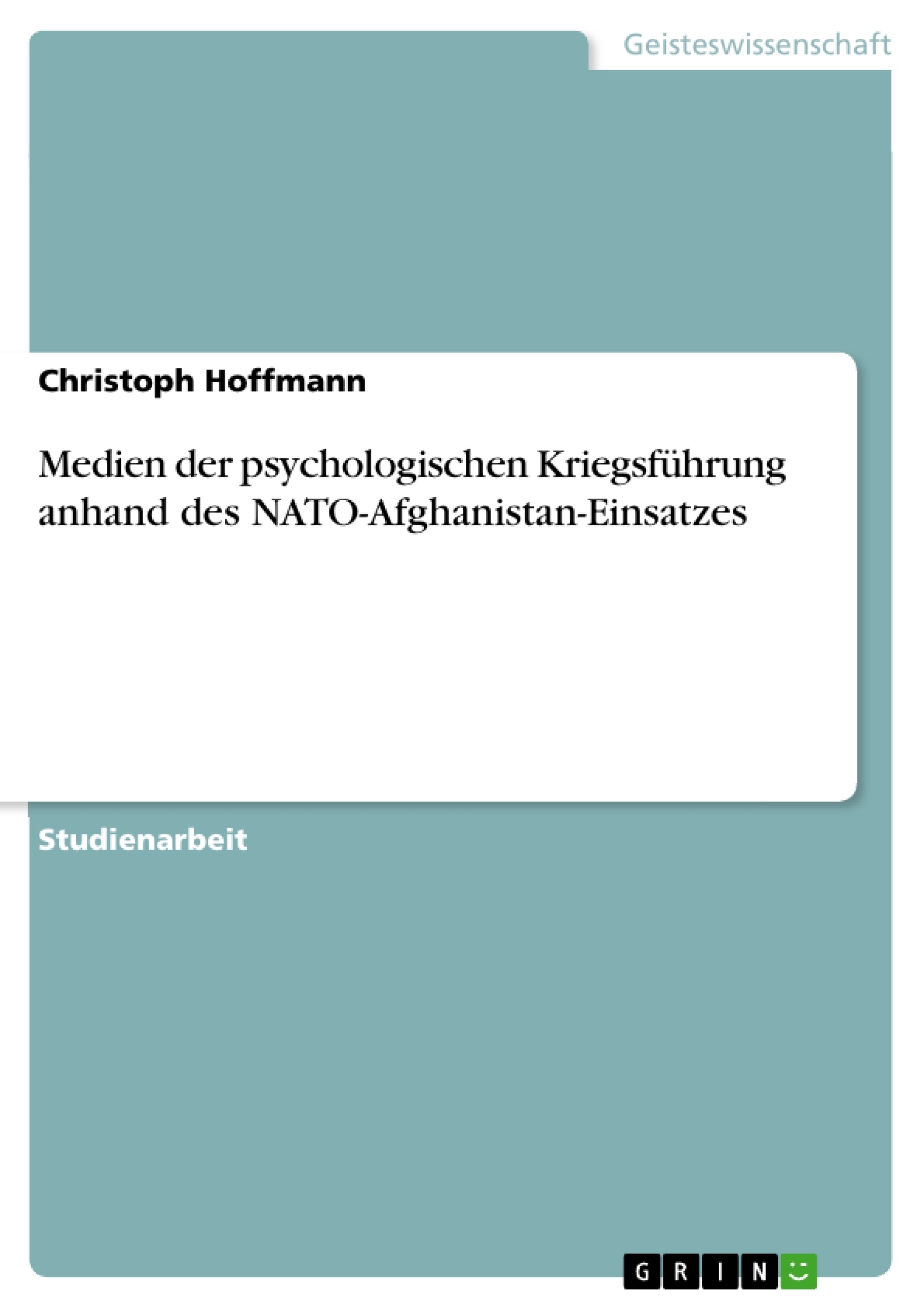Das Thema dieser Seminararbeit behandelt das Wirksamwerden von psychologischen Operationen (PSYOPS) im Rahmen des NATO-Afghanistan-Einsatzes. In den nachstehenden Kapiteln wird sowohl die Entstehung des Begriffes ‚PSYOPS‘ als auch die verschiedenen Medien mit denen PSYOPS-Einheiten arbeiten erläutert. Im dritten Kapitel liegt der Fokus besonders auf den Medien Rundfunk und Fernsehen und dem Einsatz von Flugblättern. Hierbei wird bereits der Konnex zu einer der bekanntesten NATO-Missionen – ‚Operation Enduring Freedom‘ durch ausgewählte Beispiele gelegt. In Kapitel vier werden die Aufgaben und Einsatzmittel der NATO-PSYOPS-Kräfte in Afghanistan beschrieben und anhand einzelner Armeen des internationalen Bündnisses aufgezeigt. Abschließend wird im fünften Kapitel die Analyse einzelner in Afghanistan verwendeter Flugblätter thematisiert, um dadurch die Wirksamkeit psychologischer Kriegsmittel durch Anschauungsmaterial zu verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffsbestimmung
2.1 Entstehung des Begriffes
3. Medien in der psychologischen Kriegsführung
3.1 Rundfunk
3.2 TV und Video
3.3 Flugblätter
4. PSYOPS in Afghanistan
4.1 ‚Operation Enduring Freedom‘
4.2 Aufgaben von PSYOPS innerhalb der ISAF
5. Analyse eingesetzter PSYOPS-Flugblätter
6. Conclusio
7. Abkürzungsverzeichnis
8. Abbildungsverzeichnis
9. Quellenverzeichnis