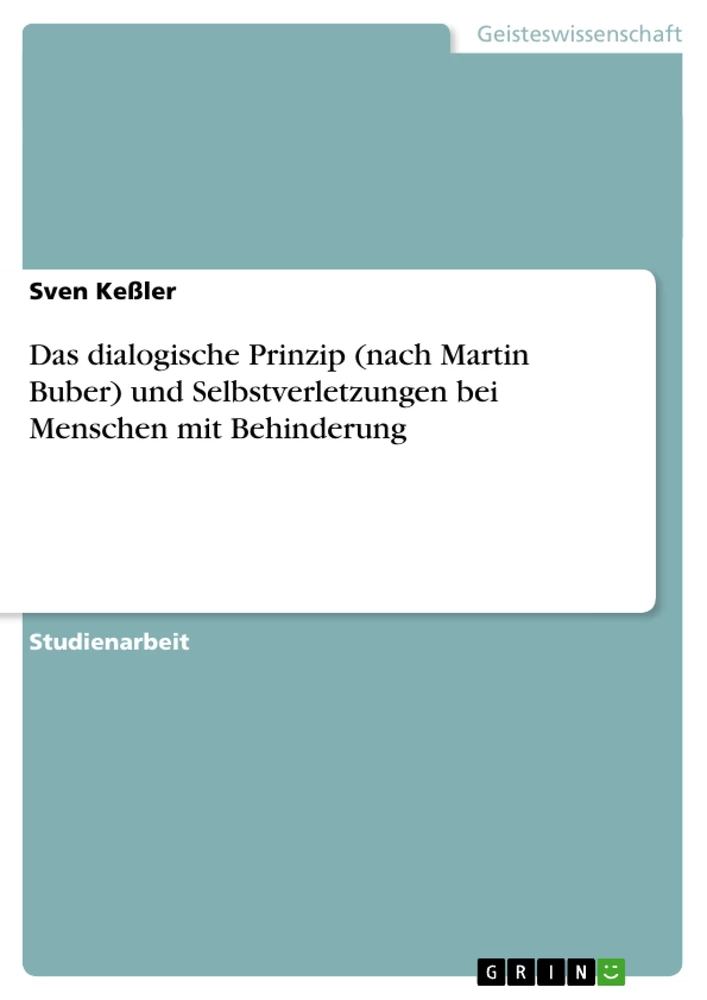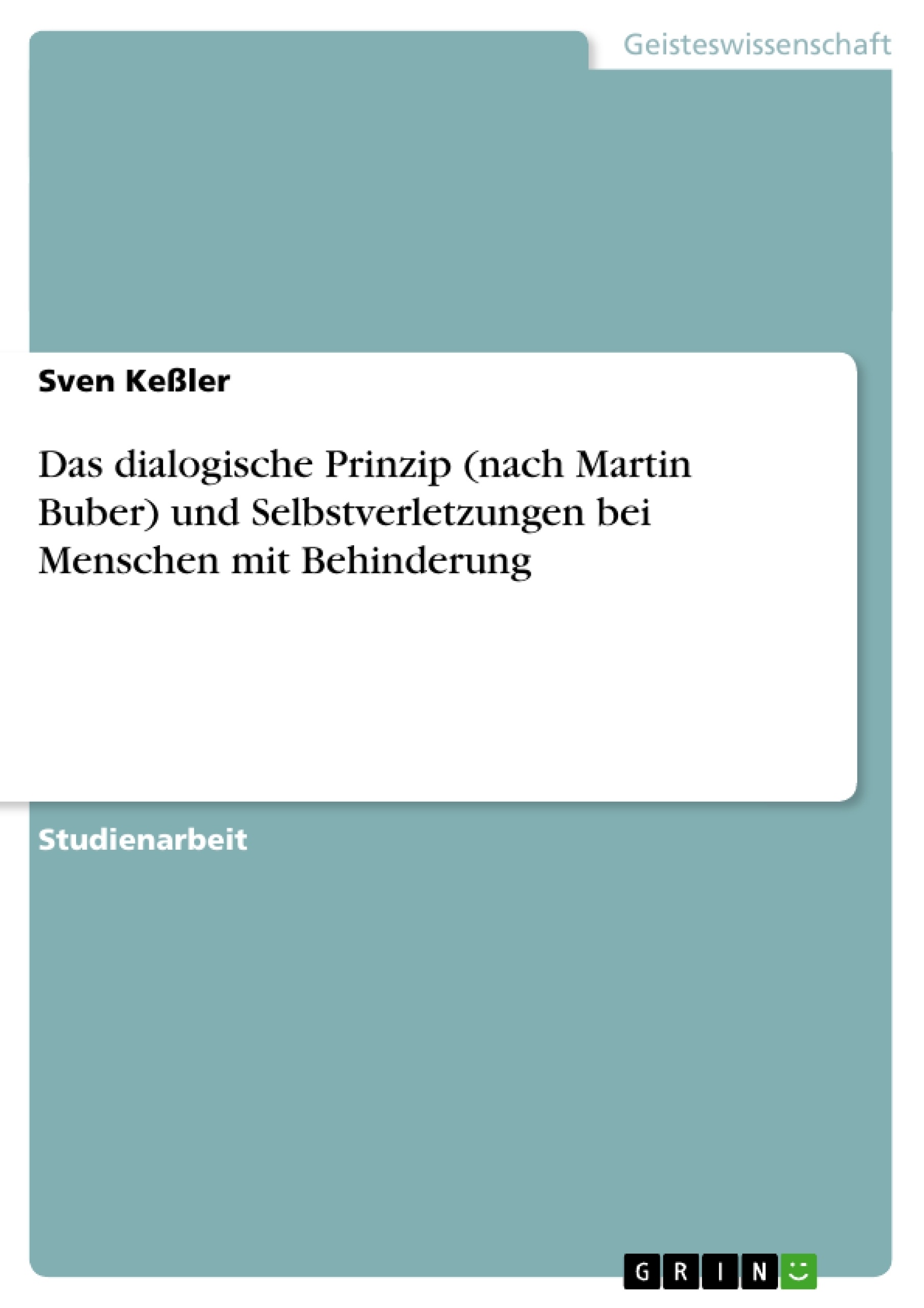„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“
„Der Mensch wird am Du zum Ich.“ (Martin Buber)
In meiner letzten Praxisphase in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen von Juni bis Oktober 2004 stieß ich in einer Zeitschrift auf diese beiden Zitate von dem Philosophen Martin Buber. Sie regten mich dazu an, mehr über den Verfasser und sein Werk zu lesen, um Einzelheiten über seine Gedanken zu erfahren. Dabei fiel mir sein Thema „das Dialogische Prinzip“ auf. Ich habe die theoretischen Auffassungen auf die Gruppe, in der ich gearbeitet habe, übertragen und festgestellt, dass ein Mann völlig gegensätzlich zu den Auffassungen Bubers gelebt hat bzw. z.T. immer noch lebt. Dieser Mann zeigt häufig Autoaggressionen, indem er sich z.B. am Kopf Verletzungen beibringt.
In dieser Arbeit mit dem Thema „Das dialogische Prinzip (nach Martin Buber) und Selbstverletzungen bei Menschen mit Behinderung“ behandele ich die Fragen, was nach Buber der Mensch ist und was erforderlich ist, damit sich der Mensch verwirklichen kann. Diese Fragen setze ich anschließend mit dem Leben von Herrn Schmidt in Beziehung und beantworte auch die Frage, warum es bei ihm zu selbstverletzendem Verhalten kommt.
Unter 2. werde ich zunächst einen Überblick über das Leben und die Werke von Martin Buber geben, um ihn als Verfasser zu kennzeichnen. Daraufhin folgen seine philosophischen Gedanken zum dialogischen Prinzip. Anschließend beschreibe ich unter 3. den „Fall“ aus meiner Praxisphase (Herr Schmidt). Dabei gehe ich zunächst zum besseren Verständnis des „Falls“ allgemein auf das Problem Selbstverletzungen bei behinderten Menschen ein. Es folgt eine Darstellung der Person von Herrn Schmidt und seiner Lebenssituation.
Zum Schluss werde ich unter 4. die theoretischen Erörterungen zum dialogischen Prinzip auf den „Fall“ aus der Praxis übertragen.
Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung und Motiv für die Themenwahl
2. Martin Buber
2.1 Sein Lebenslauf
2.2 Seine Werke
2.3 Wurzeln des dialogischen Prinzips
2.4 Das dialogische Prinzip
2.4.1 Das anthropologische Problem in unserem Zeitalter
2.4.2 Urdistanz und Beziehung
2.4.3 Die beiden Grundworte
2.4.3.1 Das Grundwort „Ich-Es“
2.4.3.2 Das Grundwort „Ich-Du“
2.4.4 Phänomene der „Ich-Du-Beziehung“
2.4.4.1 Anerkennung und Bestätigung der „Anderheit“
2.4.4.2 Unmittelbarkeit und Ausschließlichkeit
2.4.4.3 Gegenseitigkeit, Zwischen und Umfassung
2.4.4.4 Vergegenwärtigung und Erschließung
2.4.4.5 Dialogische Verantwortung
2.4.4.6 Aktualität und Latenz der Dialogik
3. Ein „Fall“ aus der Praxis
3.1 Selbstverletzungen bei Menschen mit einer Behinderung
3.2 Person und Lebenssituation eines Bewohners (Herr Schmidt)
4. Das dialogische Prinzip in Übertragung auf den „Fall “
4.1 „Vergegnung“
4.2 Das erzieherische Verhältnis zwischen den Mitarbeitern und Herrn Schmidt
4.3 Dialogische Gestalttherapie
5. Quellenverzeichnis
1. Einleitung und Motiv für die Themenwahl
„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“
„Der Mensch wird am Du zum Ich.“ (Martin Buber)
In meiner letzten Praxisphase in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen von Juni bis Oktober 2004 stieß ich in einer Zeitschrift auf diese beiden Zitate von dem Philosophen Martin Buber. Sie regten mich dazu an, mehr über den Verfasser und sein Werk zu lesen, um Einzelheiten über seine Gedanken zu erfahren. Dabei fiel mir sein Thema „das Dialogische Prinzip“ auf. Ich habe die theoretischen Auffassungen auf die Gruppe, in der ich gearbeitet habe, übertragen und festgestellt, dass ein Mann[1] völlig gegensätzlich zu den Auffassungen Bubers gelebt hat bzw. z.T. immer noch lebt. Dieser Mann zeigt häufig Autoaggressionen, indem er sich z.B. am Kopf Verletzungen beibringt.
In dieser Arbeit mit dem Thema „Das dialogische Prinzip (nach Martin Buber) und Selbstverletzungen bei Menschen mit Behinderung“ behandele ich die Fragen, was nach Buber der Mensch ist und was erforderlich ist, damit sich der Mensch verwirklichen kann. Diese Fragen setze ich anschließend mit dem Leben von Herrn Schmidt in Beziehung und beantworte auch die Frage, warum es bei ihm zu selbstverletzendem Verhalten kommt.
Unter 2. werde ich zunächst einen Überblick über das Leben und die Werke von Martin Buber geben, um ihn als Verfasser zu kennzeichnen. Daraufhin folgen seine philo-sophischen Gedanken zum dialogischen Prinzip. Anschließend beschreibe ich unter 3. den „Fall“ aus meiner Praxisphase (Herr Schmidt). Dabei gehe ich zunächst zum besseren Verständnis des „Falls“ allgemein auf das Problem Selbstverletzungen bei behinderten Menschen ein. Es folgt eine Darstellung der Person von Herrn Schmidt und seiner Lebenssituation.
Zum Schluss werde ich unter 4. die theoretischen Erörterungen zum dialogischen Prinzip auf den „Fall“ aus der Praxis übertragen.
2. Martin Buber
2.1 Sein Lebenslauf
Martin Buber[2] wurde am 8.2.1878 in Wien in einer jüdischen Familie geboren[3]. Nach der Scheidung seiner Eltern zog er zu seinem Großvater nach Lwow (Lemberg) in Galizien[4]. 1892 siedelte er zu seinem wiederverheirateten Vater in Lemberg über. Mit achtzehn Jahren studierte Buber Philosohie und Kunstgeschichte an der Universität in Wien. Ein Jahr später setzte er sein Studium in Leipzig fort, wo er sich u.a. mit der Mystik der Renaissance und der Reformationszeit beschäftigte. 1898 schloß er sich in Berlin dem Zionismus an und gründete eine zionistische Ortsgruppe sowie einen Verein jüdischer Studenten. Im folgenden Jahr führte er sein Studium in Zürich fort und begegnete dort im Rahmen seines Germanistikstudiums seiner späteren Frau Paula Winkler. 1901 avancierte er zum Herausgeber der Zeitschrift „Die Welt“ (Wien), dem Zentralblatt der zionistischen Weltorganisation. 1902 gründete er zusammen mit Freunden den Jüdischen Verlag. Ab 1904 beschäftigte er sich intensiv mit der deutschen Mystik, die u.a. die Grundlage für sein Dissertationsthema „Beiträge zur Geschichte des Individuationsproblems“ war. 1916 zog Buber von Berlin nach Heppenheim um und arbeitete dort als freier Schriftsteller. Im Dezember 1923 nahm Buber einen Lehrauftrag für Religionswissenschaft und jüdische Ethik an der Universität in Frankfurt am Main an. Dieser wurde 1930 in eine Honorarprofessur für allgemeine Religionswissenschaft umgewandelt. Diese Professur legte er direkt nach der Machtergreifung Hitlers nieder. Im selben Jahr wurde ihm auch die Lehrbefugnis entzogen. Weiterhin gründete er in diesem Jahr eine Mittelstelle für jüdische Erwachsenenbildung, in der er Bibelkurse abhielt. Trotz zunehmender administrativer Behinderung setzte er diese fort. 1938 (das Jahr der Reichskristallnacht) wanderte er nach Palästina aus. Er wurde Professor für Sozialphilosophie an der Hebräischen Universität in Jerusalem. 1949 baute Buber das „Seminar für Erwachsenenbildung“ in Jerusalem auf. In den folgenden Jahren bis zu seinem Tod am 13.6.1965 erhielt Buber noch zahlreiche Preise und Ehrungen[5] und hielt in aller Welt Vorträge.
2.2 Seine Werke
Martin Buber[6] ist neben der Übersetzung der Bibel vom Hebräischen ins Deutsche bekannt geworden als Herausgeber und Interpret von Schriften des Chassidismus[7] („Die Erzählungen der Chassidim“ (1949), „Die Geschichte des Rabbi Nachnam“ (1906), „Die Legende des Baal-Schem“ (1908) u.a.). Aufgrund von Bubers Begegnung mit dem Chassi-dismus, die schon in seiner Jugend geschah, entwickelte er seine Dialogphilosophie. Ihm ging es dabei stets um die Existenz des Menschen in Beziehungen (zu Gott und zu anderen Menschen). 1919 brachte Buber bezüglich dieses Themas sein Werk „Ich und Du“ heraus. Es folgten schließlich weitere Werke, wie z.B. „Zwiesprache“ (1932), „Die Frage an den Einzelnen“ (1936), „Urdistanz und Beziehung“ (1951) und „Begegnung“ (1960). Alle diese Werke tragen zu Bubers dialogischem Prinzip bei.
2.3 Wurzeln des dialogischen Prinzips
Martin Bubers Weg zum dialogischen Prinzip beginnt im Hause seines Großvaters in seinen Kindheitsjahren. Dieser legte Wert auf jüdische Traditionen. Deshalb wurde Buber schon früh mit der hebräischen Sprache, Wissen über die Bibel und das Judentum konfrontiert. Weiterhin begegnete er in diesem Entwicklungsstadium auch dem Chassi-dismus. Die religiöse Bewegung der Chassidim kam gegen 1750 in der Ukraine auf und hatte viele Anhänger; ihr Gründer war der Rabbi Baal Schem Tow.[8] Ihm ging es darum, für die wenig gebildeten und unter trostlosen Verhältnissen lebenden Juden eine neue jüdische Lebensform zu schaffen, die ihnen die Möglichkeit einer leicht fasslichen religiösen Lebensgestaltung geben sollte. Sie wandte sich vom reinen Gesetzesglauben ab, der bei den osteuropäischen Juden weit verbreitet war. Die Chassidim bildeten einzelne Gemeinden, an deren Spitze jeweils der Zaddik stand. Das Verhältnis war von einer Wechselwirkung gekennzeichnet. Der Zaddik soll seinen Chassidim den unmittelbaren Umgang mit Gott erleichtern, aber nicht ersetzen. Die Bewegung war durch ein tiefes religiöses Gefühl, Gottessehnsucht, Frömmigkeit, Demut, Freude, Tanzen vor Gott und Liebe geprägt. Kerngedanke des Chassidismus ist die Gegenwart Gottes, der sich in jeder Sache und in jedem Wesen befindet.
Damit wird die Begegnung mit Gott in den Vordergrund gestellt.[9] Bubers Begegnungen und Erfahrungen mit der Gemeinschaft in einer chassidischen Gemeinde trugen zu seiner Frage nach der Existenz des Menschen und damit dem dialogischen Prinzip bei.[10] Weiterhin beeinflussten ihn andere Philosophen bei seinem Verständnis des dialogischen Prinzips.
Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872) hat in seinem Buch „Philosophie der Zukunft“ schon die Einheit von Ich und Du angesprochen und auf die Bindung des Menschen an den Mitmenschen aufmerksam gemacht, die Buber in seinen philosophischen Gedanken als entscheidende Anregung übernahm.[11] Auch Sören Kierkegaard (1813-1855), der als Vater der Existenzphilosophie bezeichnet wird, wirkte schon während Bubers Studienzeit auf ihn ein. Gedanken, dass der Mensch ein Einzelner, eine gültige Person vor Gott werden müsse, findet sich bei Buber in „Die Frage an den Einzelnen“ wieder.[12] Außerdem wurde Martin Buber durch Fragen nach dem Menschsein von Friedrich Nietzsche (1844-1900) beeinflusst. Durch ihn kam er auch zwischen 1899 und 1900 mit der „Neuen Gemeinschaft“ in Kontakt, einem Kreis lebensbejahender Menschen, der von der Sehnsucht nach einer großen und erfüllten Zeit getragen war. Die Dynamik des dortigen dialogischen Geschehens haben seine Gedanken zur „Ich-Du-Beziehung“ bestätigt, die beim dialogischen Prinzip eine wichtige Rolle spielt.[13]
2.4 Das dialogische Prinzip
Für Martin Buber vollendet sich das „menschliche Sein“ nicht in einem narzistischen Umgang mit sich selbst[14], sondern nur in Verbundenheit mit anderen Menschen. Für ihn ist wirkliches Leben Begegnung. Begegnung zwischen zwei Menschen, zwischen einem „Ich“ und einem „Du“, die im Dialog zueinander stehen. Es geht ihm um eine mutuelle (wechselseitige) Begegnung zwischen dem „Ich“ und dem „Du“. Das „Ich“ steht zum „Du“ in einer „Ich-Du-Beziehung“, ebenso wie das „Du“ zum „Ich“ in einer „Ich-Du-Beziehung“ steht.
Aufgrund dieser „Mutualität“[15] (Wechselseitigkeit) spricht Buber vom dialogischen Prin-zip. Er hat das dialogische Prinzip als Ganzes nicht klar definiert, vielmehr kreist er mit seinen Gedanken und Begriffen um das „Dialogische Leben“[16].
Im Folgenden werden deshalb die Einzelthemen dargestellt, um einen Überblick über das dialogische Prinzip als Ganzes zu bekommen.
2.4.1 Das anthropologische Problem in unserem Zeitalter
Immer wieder wird zu klären versucht, worin das Wesen des Menschen besteht und verschiedene Philosophen versuchen eine Antwort auf dieses Problem zu geben. Martin Buber, dem es um eine „Erhellung der menschlichen Existenz“[17] geht, „akzentuiert be-hutsam auf die Frage, was der Mensch sei, dass „wir“ der Antwort näher kommen“[18].Er meint, dass das anthropologische Problem erst in unserem Zeitalter aufgekommen ist.[19] Er begründet dies zum einen aus soziologischer Sicht, indem er von der Vereinsamung des Menschen spricht. Wenn „ein Mensch in die Stille, in die eigentliche Wirklichkeit seines Lebens einkehrt, erfährt er die Tiefe der Einsamkeit.“[20] Allein „in ihr erfährt er, mit dem Grunde seines Daseins konfrontiert, die Tiefe der menschlichen Problematik.“[21]
Für Buber liegt der Grund für diese Vereinsamung in dem fortschreitenden Zerfall der alten organischen Gemeinschaftsformen, in denen die Menschen in unmittelbarer Beziehung zueinander lebten. Die Zugehörigkeit zu diesen Gemeinschaftsformen versteht er als „Schicksal und vitale Überlieferung“.[22] Als Beispiel bringt er für diese Gemeinschaftsformen, die er gutheißt, die „Familie, Werkgenossenschaft, Dorf- und Stadt-gemeinde“ an.[23] Diese bisherigen Gemeinschaftsformen boten dem Menschen eine „Heimatlichkeit des Lebens und ein Ruhen in der direkten Verbundenheit“ mit anderen Menschen. Sie gaben ihm also eine „soziologische Sicherheit“[24]. Buber lehnt jedoch insgesamt die neuen Gemeinschaftsformen, wie z.B. den Verein, die Gewerkschaft, die
Partei ab, da sie zwar das Leben des Menschen ausfüllten, jedoch letztendlich die Einsamkeit, wie Buber sagt, durch sie nur betäubt werde.[25]
Zum anderen begründet er das anthropologische Problem aus geistesgeschichtlicher Sicht,
indem er von dem Menschen spricht, der im Laufe der Zeit immer tiefer in eine Krise geraten ist. Damit meint er die Beziehung des Menschen zu neuen Dingen und Verhält-
nissen.[26] Für ihn stellt sich die Frage nach dem Wesen des Menschen. Nach Buber kann sie nur beantwortet werden, wenn man den Menschen „in der Ganzheit (seiner) Wesensbeziehungen zum Seienden“[27] betrachtet. Für Buber ist deshalb das Entscheidende für die Beantwortung der Frage, was der Mensch sei, dass „wir ihn als das Wesen verstehen lernen, in dessen Dialogik, in dessen gegenseitig präsentem Zu-zweien-Sein sich die Begegnung des Einen mit dem Anderen jeweils verwirklicht und erkennt.“[28] Er legt also großen Wert auf die Verbundenheit des Menschen mit dem Menschen.
[...]
[1] In der vorliegenden Arbeit nenne ich aus Datenschutzgründen nicht seinen wirklichen Namen, sondern werde ihn als Herrn Schmidt bezeichnen.
[2] Wenn nichts anderes angegeben wird, beziehe ich mich auf: STÖGER, P., 2003, S. 11-44
[3] vgl.: http://www.christen-und-juden.de/html/buber.htm, 8.10.04
[4] Gehörte damals zu Polen, heute: Ukraine
[5] u.a.: Friedenspreis des deutschen Buchhandels in Frankfurt, Erasmuspreis in Amsterdam, philosophisches Ehrendoktorat an der Universität Heidelberg, Kulturpreis der Stadt München
[6] vgl.: http://www.christen-und-juden.de/html/buber.htm, 8.10.04
[7] siehe dazu unter 2.3
[8] vgl.: FABER, W., 1967, S. 17
[9] vgl.: ANZENBACHER, A., 1965, S. 19-21
[10] vgl.: http://www.christen-und-juden.de/html/buber.htm, 8.10.04
[11] vgl.: FABER, W., 1967, S. 20
[12] ebenda, S. 21
[13] ebenda, S. 24
[14] ebenda, S. 52
[15] http://www.konflikt-dialog.de/das-dialogische-prinzip-nach-buber.html, 8.10.04
[16] FABER, W., 1967, S. 10
[17] ebenda, S. 49
[18] ebenda, S. 48
[19] vgl.: BUBER, M., 1982, S. 81
[20] BUBER, M., 1982, S. 83
[21] ebenda, S. 83
[22] ebenda, S. 82
[23] vgl.: BUBER, M., 1982, S. 82
[24] BUBER, M., 1982, S. 82
[25] vgl.: BUBER, M., 1982, S. 82
[26] ebenda, S. 83
[27] BUBER, M., 1982, S. 158
[28] ebenda, S. 169