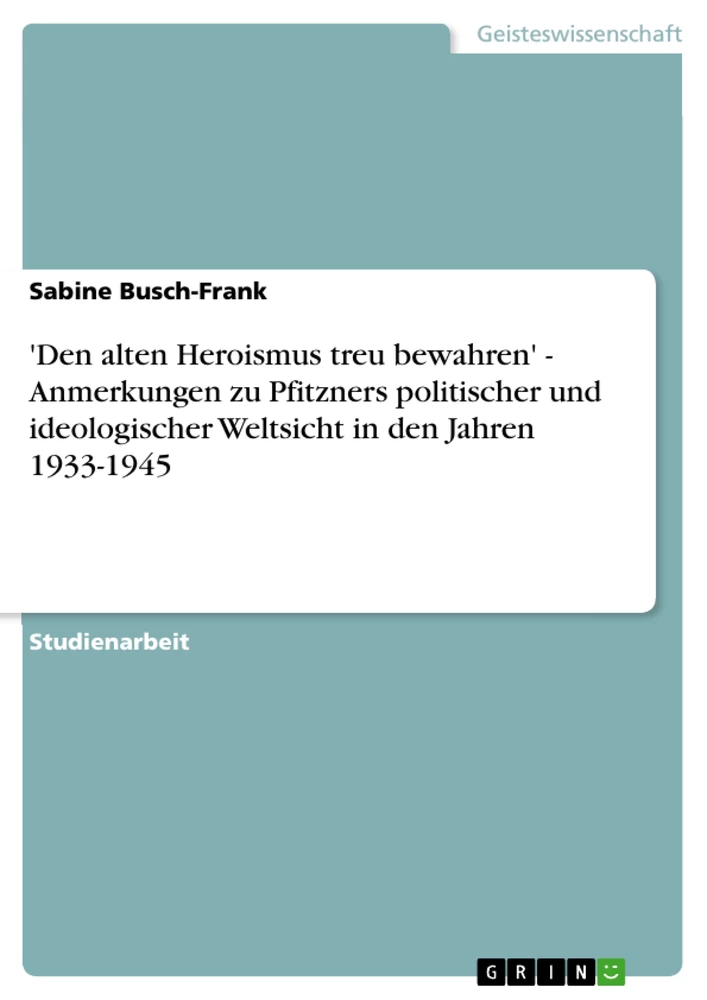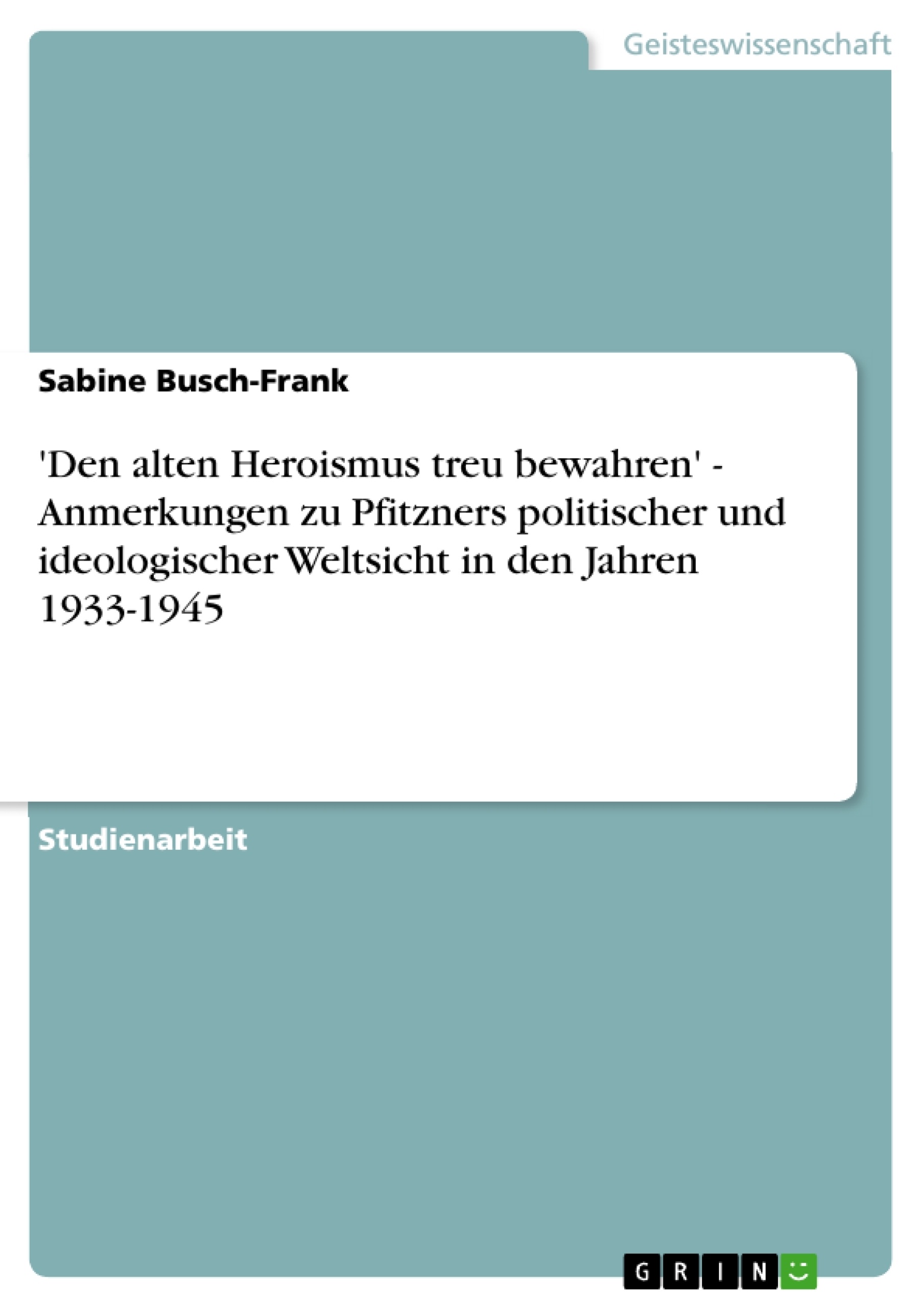Die Autorin legte mit ihrer Dissertation „Hans Pfitzner im Nationalsozialismus“ die bisher umfassendste und aktuellste Untersuchung zu diesem zeitgeschichtlich-theaterwissenschaftlichen Thema vor. In diesem Beitrag finden sich einige ihrer wichtigsten Thesen zu der Thematik als Extrakt im Rahmen eines Fachreferats.
Hans Pfitzner (1869-1949) geriet als Komponist wegen seiner Zeitgenossenschaft mit dem Dritten Reich, seinen antisemitischen Schriften und seiner schwierigen, stets den Fehdehandschuh werfenden Persönlichkeit nach dem zweiten Weltkrieg zunehmend in Vergessenheit. Seine Musik, die zweifellos ihre Qualitäten hat, wurde so immer mehr an den Rand des Repertoires gedrängt. Höchste Zeit für eine klare, unvoreingenommene und quellenkritische Untersuchung zur Person, Biographie und politischen Orientierung der schwierigen Komponistenpersönlichkeit Hans Pfitzners, der zu Lebzeiten stets als zeitgleicher Antipode Richard Strauss`, ja oft sogar als wahrer geistiger Erbe Richard Wagners genannt wurde.
„Den alten Heroismus treu bewahren“
Anmerkungen zu Pfitzners politischer und ideologischer Weltsicht in den Jahren 1933-1945
1. Ein politischer Komponist?
Auf die Frage nach seiner Einschätzung der deutschen Zukunft antwortete Pfitzner im Jahr 1926/27 den Süddeutschen Monatsheften: „[…] das, was jetzt noch in unserem Volke in guten Sinne deutsch genannt werden kann, wird – wie schon früher in der Geschichte – den alten Heroismus treu bewahren und auch ohne Hoffnung weiterkämpfen und sich treu bleiben.“[1]
Einen Komponisten nach seiner politischen Einschätzung zu befragen, zumal einen, der von sich sagt, er habe von Politik keine Ahnung, könnte befremden – um so mehr, wenn diese Befragung durch ein Magazin geschieht, dem der Interviewte als Mitherausgeber voran steht. Pfitzner aber hatte seit spätestens der Weimarer Zeit eine Politisierung der Kunst beobachtet und sich diese Anschauung auch zu Eigen gemacht. So schrieb er 1932: „Es ist keine Frage, daß Kunst jetzt gleich Politik ist oder [so] behandelt wird. Die internationale, zersetzende Linkspresse stützt und fördert ihre Lieblinge skrupellos und verhält sich bewußt vernichtend allem gegenüber, was Deutsch und noch potent ist.“[2]
Dieses Bewußtsein Pfitzners als kämpfender Künstler in den Wirren seiner Zeit soll im Folgenden zum Anlaß genommen werden, schlaglichtartig das ideologisch-politische Verhalten des Komponisten während des „Dritten Reiches“ zu beleuchten.
2. Vorbemerkungen zu Pfitzners biographischer Situation
Nach den Ausführungen des in diesem Band an anderem Ort nachzulesenden Artikels von Prof. Dr. Jens Malte Fischer ist es hier nicht mehr notwendig, Pfitzners Weltsicht zu Beginn des NS-Regimes in Deutschland zu umreißen, wohl aber, eine kurze Bestandsaufnahme seiner Lebensumstände im März 1933 vorzunehmen. Dabei ist die politische Situation jener Jahre bekannt: Am 30.1.1933 wurde Adolf Hitler von Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt, die NSDAP als Folge des Reichstagsbrandes am 23.3.1933 durch das Ermächtigungsgesetz zur bestimmenden politischen Macht in Deutschland. Wer von nun an in Deutschland leben und arbeiten wollte, mußte mit dieser Partei und ihren politischen Zielen rechnen.
Hans Pfitzner war damals 63 Jahre alt und war 1929 „auf Lebenszeit“ an die Akademie der Tonkunst nach München berufen worden. Er wohnte im eigenen Haus in Schondorf am Ammersee, hatte nach dem Tod seiner ersten Frau 1926 eine wenig glückliche Beziehung mit seiner Kompositionsschülerin Lilo Martin begonnen und war als Dirigent, Solist, Begleiter oder auch Regisseur seiner Werke viel auf Reisen. Sein Familienverbund befand sich in Auflösung: Mit dem Bruder hatte er schon lange gebrochen, sein schwerkranker Sohn Paul war in einer psychiatrischen Klinik in München untergebracht, die anderen beiden noch lebenden Kinder befanden sich im Prozeß der Berufsfindung, der viele Komplikationen mit sich brachte. Agnes (damals 24 Jahre) hatte in jener Zeit das von ihrem Vater mißtrauisch beäugte Violinstudium aufgegeben und begonnen, sich der Medizin zuzuwenden. Der Sohn Peter (26) hatte nach einer abgebrochenen kaufmännischen Lehre, einer Episode als Schiffsjunge, zeitweiligen Germanistik- und Jura-Studien und der Tätigkeit als u.a. Bayreuther Regieassistent gerade auf den dringenden Wunsch des Vaters sein juristisches Studium wieder aufgenommen und war Rechtsreferendar in München. Das Leben Hans Pfitzners war von privater Unzufriedenheit, mangelnder Geborgenheit, wohl aber auch von unstetem Reisen und Einsamkeit gezeichnet.
3. Pfitzners Wirken zur Zeit des Nationalsozialismus
Was Pfitzners Wirken betrifft, waren aber die stärksten Pflöcke längst in den Boden gerammt: Pfitzners Alterswerk wird meist[3] bereits mit dem op. 37 des 57-Jährigen angesetzt, dem Orchesterlied Lethe (1926). Als op. 38 folgt dann als Markstein des Spätwerkes das Dunkle Reich (1929/30). In den Jahren des Nationalsozialismus war Pfitzners Produktivität erschlafft, sein Schaffen wuchs nach dem 1932 entstandenen op. 36a (das sich auf sein früheres Werk, das Streichquartett op. 36 bezieht und daher die Kontinuität der Opuszahlen bricht) noch bis op. 57. Hinter diesen 16 Ziffern verbergen sich aber nicht mehr die großen oder gar abendfüllenden Werke, sondern es war schon seit ca. 1935 überwiegend Klavier- oder Kammermusik sowie Liedschaffen, die dem „Meister der Inspiration“ zufielen.
Im Werkverzeichnis finden sich für die Jahre zwischen 1933 und 1945:
- Das Konzert für Violoncello und Orchester G-Dur, op. 42
- Das Duo für Violine und Violoncello mit kleinem Orchester oder Klavier, op. 43
- Kleine Symphonie G-Dur, op. 44
- Elegie und Reigen für Orchester, op. 45
- Symphonie C-Dur, op. 46
- 5 Klavierstücke, op. 47
- fons salutifer, op. 48 (Nach Text von Erich Guido Kolbenheyer)
- 2 Männerchöre, op. 49 nach Gedichten von Franck und Uhland
- Streichquartett c-moll, op. 50
- 6 Studien für Pianoforte, op. 51
- Konzert für Violoncello und Orchester a-moll, op. 52
- 3 Gesänge für Männerchor und kleines Orchester, op. 53 (Nach Text von Werner Hundertmark)
- Krakauer Begrüßung für Orchester, op. 54
- Sextett für Klavier, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabaß und Klarinette, op. 55
Zu Pfitzners Altersschaffen bemerkt Reinhard Ermen:
„[Pfitzner] hört nach der Komposition des ‚Hauptwerks‘ nicht auf zu produzieren, und doch setzt er mit dem ‚Palestrina‘ den ‚letzten Stein‘. Pfitzner widmet sich der Reproduktion, weil er erkennt, daß eine Gattung, die nicht mehr stark genug ist, sich schaffend zu regenerieren, auf die Pflege besonders angewiesen ist.“[4]
Über diesen Standpunkt ließe sich trefflich streiten – scheinen doch die Schaffung von Neuem und die Pflege von Bewährtem in den meisten Künstlerbiografien Hand in Hand zu gehen. Im Zusammenhang mit dem hier zugrunde gelegten Themenkreis der Politik und Ideologie bei Hans Pfitzner lassen nur drei Werke aus dem schmalen Verzeichnis jener Jahre aufhorchen: Das Lob der Karlsbader Wasser, fons salutifer, fällt durch seinen umstrittenen – weil für antisemitische und nationalistische Tendenzen bekannten – Textdichter Kolbenheyer auf. Die beiden anderen Werke, die Indizien für eine politische Dimension belegen könnten, stammen aus dem Jahr 1944: Die Drei Gesänge für Männerchor mit Begleitung eines kleinen Orchesters, op. 53 sowie die Krakauer Begrüßung, op. 54.
[...]
[1] Hans Pfitzner, [Umfrage über „Deutsche Zukunft“], in: Süddeutsche Monatshefte vom November 1926, S. 203, wieder veröffentlicht in Bernhard Adamy (Hrsg.) Sämtliche Schriften, Bd. 4, Tutzing 1987, S. 318. Die Umfrage über die deutsche Zukunft wurde bei 51 „führenden“ Deutschen vorgenommen und war aufgeteilt in zwei Fragen: Erstens, ob die Leistungen der deutschen Nachkriegsgeneration zurückgingen, zweitens, ob die deutsche Jugend nicht mehr an ihrer Ausbildung, an der Selbständigkeit der deutschen Kultur und der Erhaltung des Deutschtums interessiert sei.
[2] Brief Hans Pfitzner an Tim Klein vom 30.4.1932, Österreichische Nationalbibliothek Wien.
[3] So beispielsweise von Wilhelm Mohr, Hans Pfitzners Sextett Opus 55 in: Mitteilungen der Hans Pfitzner-Gesellschaft, Heft 7, Oktober 1960, S. 2-12. Pfitzner selbst setzte es allerdings bei op. 43 an. Vgl. dazu den Brief Hans Pfitzners an Felix Wolfes vom 11.7.1946, veröffentlicht in Bernhard Adamy (Hrsg.) Hans Pfitzner Briefe, Tutzing, 1991, Nr. 936, S. 1006.
[4] Reinhard Ermen, Musik als Einfall. Hans Pfitzners Position im ästhetischen Diskurs nach Wagner, Aachen 1986, S. 148f.