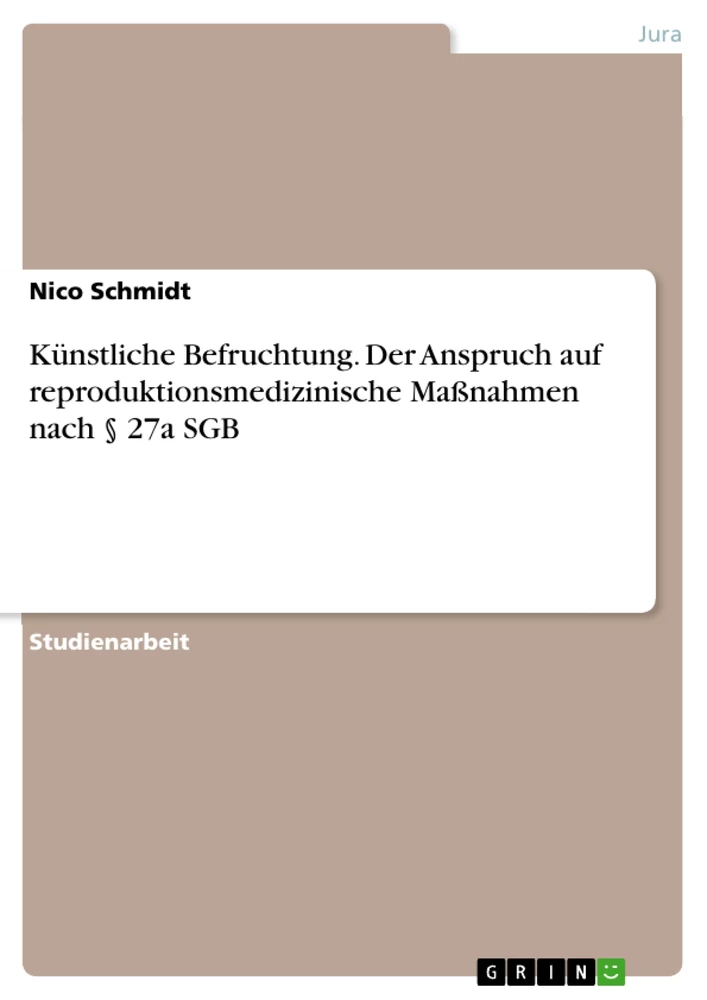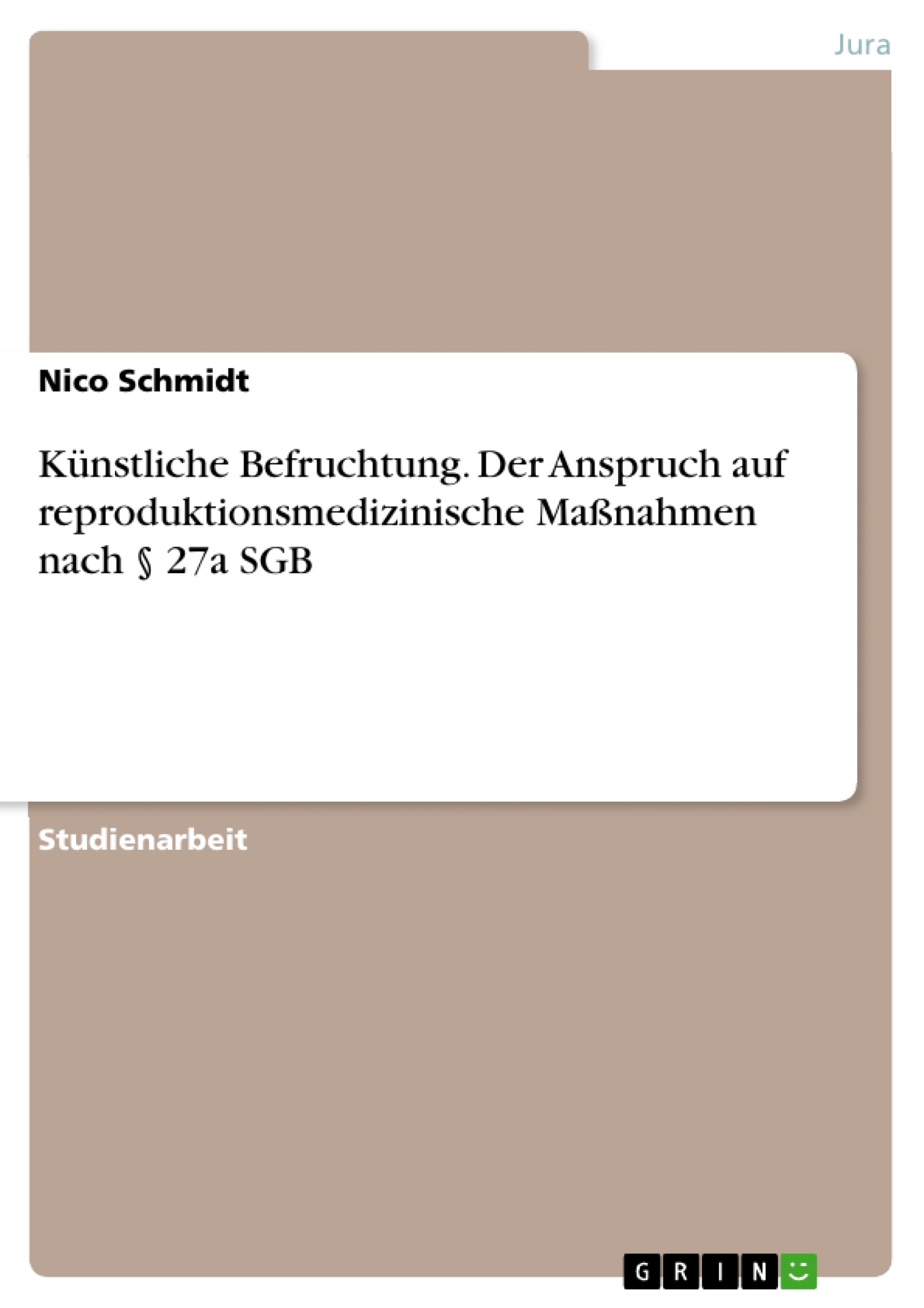Diese Seminararbeit setzt sich mit dem Anspruch auf reproduktionsmedizinische Maßnahmen nach § 27a SGB V auseinander. Der Fokus liegt auf den verfassungsrechtlichen Problemen der einzelnen Voraussetzungen. Ebenfalls wird der neu eingeführte Anspruch auf Kryokonservierung rechtlich eingeordnet sowie eine Bewertung des derzeitigen Regelungsentwurfs der Fraktion Bündnis 90/ Grünen vorgenommen.
Weltweit leiden Paare aus den verschiedensten Gründen an Kinderlosigkeit. In Deutschland ist fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 Jahren ungewollt kinderlos. Dabei ist neben Stress und ungesunder Lebensweise die Sterilität von Mann oder Frau die Hauptursache. Hierfür wenden sich betroffene Paare meist verzweifelt an Ärzte und Biologen, um sich, wenn möglich, im Wege einer künstlichen Befruchtung doch noch den Kinderwunsch zu erfüllen.
Diese Möglichkeit ist jedoch mit hohen Kosten verbunden, weshalb sich die Frage der Kostenübernahme zulasten der gesetzlichen Krankenversicherungen stellt. Der Gesetzgeber hat mit § 27a SGB V einen Anspruch geschaffen, nach dem die Kosten für eine etwaige künstliche Befruchtung zum Teil übernommen werden. Um die teilweise Kostenübernahme beanspruchen zu können, müssen jedoch eine Vielzahl an Voraussetzungen erfüllt sein. Es handelt sich um einen restriktiv gearteten Anspruch, der nur einem bestimmten Teil der Gesellschaft zusteht.
Der Kinderwunsch besteht sowohl bei verheirateten als auch unverheirateten sowie gleichgeschlechtlichen Paaren, jedoch steht ein Anspruch auf Leistungen nach § 27a SGB V nur verheirateten Paaren zu. Hier stellt sich das verfassungsrechtliche Problem der Gleichbehandlung nach Art. 3 GG. Ist es gerechtfertigt, diesen Anspruch nur verheirateten Paaren zuzugestehen?
Inhaltsverzeichnis
A Einleitung
B Regelungsübersicht/Systematik
C Medizinische Maßnahmen
I. Kryokonservierung
II. Aufbewahrung Eierstockgewebe
D Leistungsvoraussetzungen
I. AllgemeineVoraussetzung
II. Erforderlichkeit der Maßnahmen nach ärztlicher Feststellung
III. Grenze des minimalen Alters
1. Grundrechte aus Art. 6 Abs. 1, Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG
2. AllgemeinerGleichbehandlungsgrundsatz
3. MedizinischeSichtweise
4. Soziale Sichtweise
IV. Beschränkung Höchstaltersgrenzen
V. HinreichendeErfolgsaussicht
VI. Bestehende Ehe
1. AllgemeinerGleichbehandlungssatz
2. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung
VII. Homologe Insemination
1. Gleichgeschlechtliche Paare
2. AllgemeinerGleichheitssatzArt. 3Abs. 1 GG
3. Entwurf Bündnis 90/ Grünen