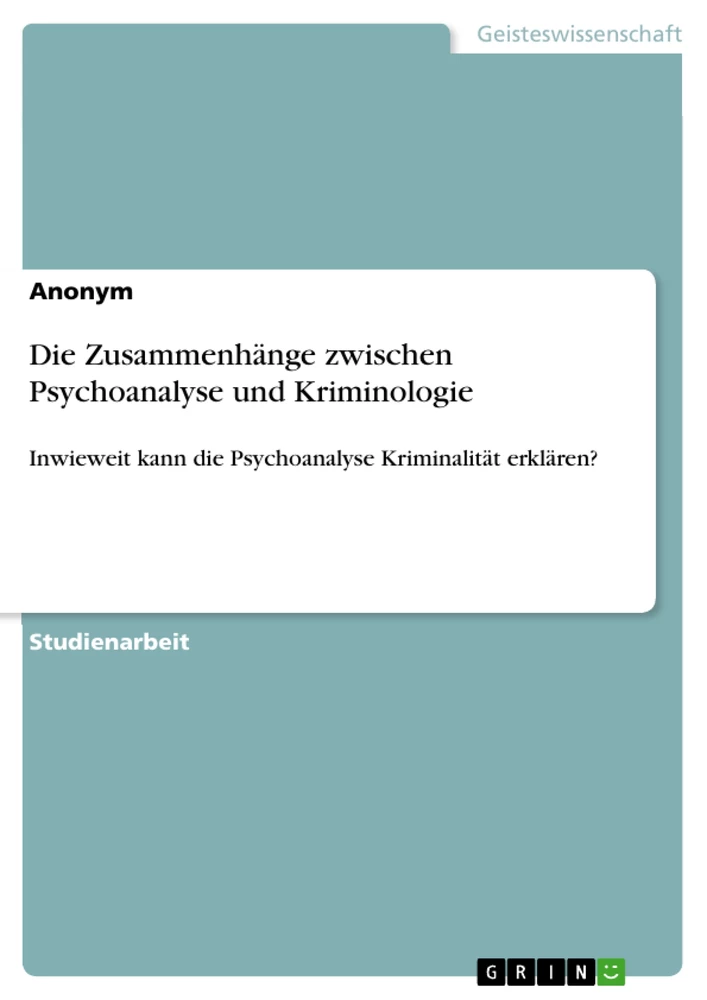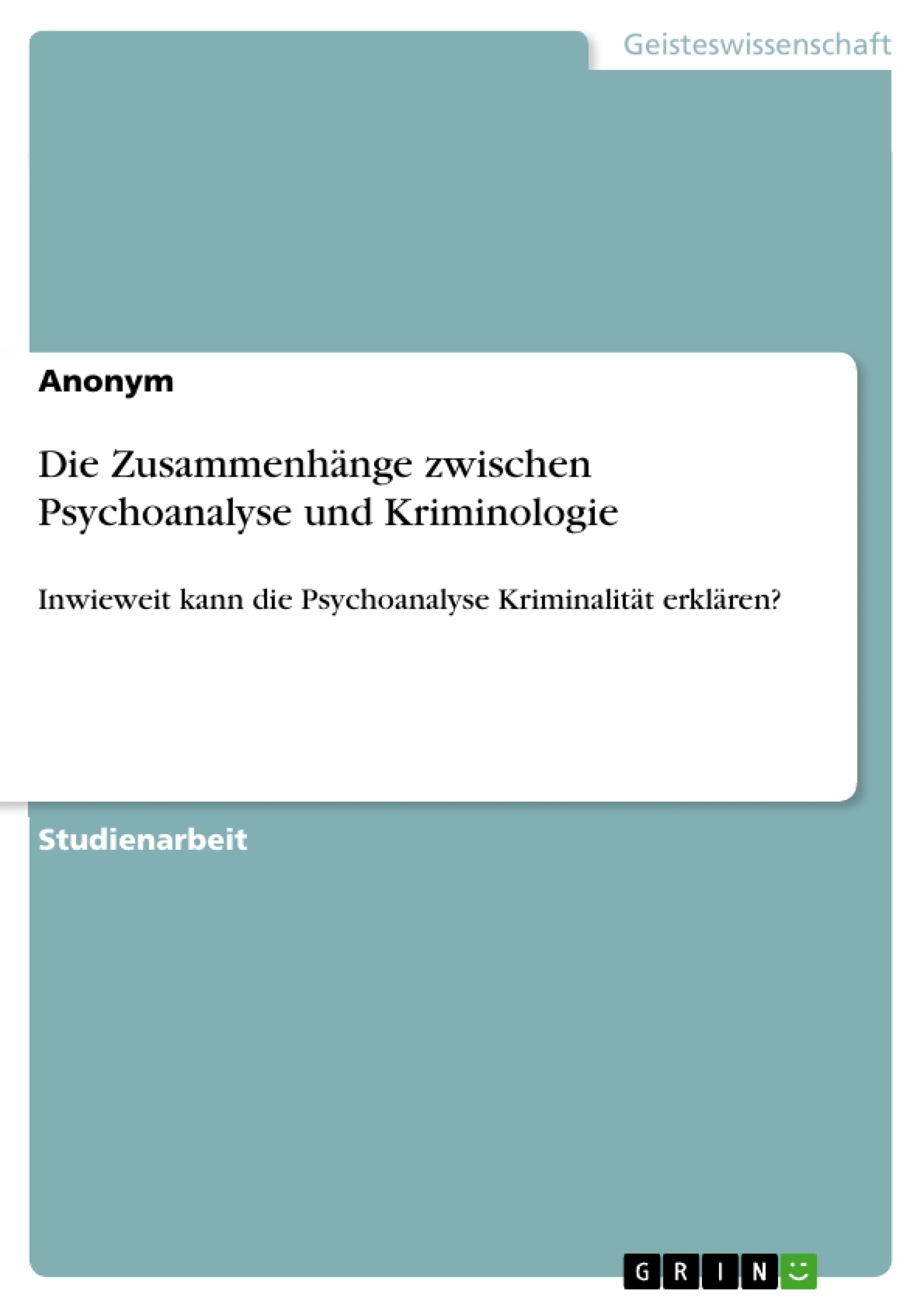Kriminalitätstheorien versuchen zu erklären, warum Menschen kriminell werden. Sind es unsere Gene, die Chemie im Hirn, soziale Faktoren oder die Aussicht auf einen materiellen Gewinn? Warum begehen Menschen Verbrechen?
Der psychoanalytische Ansatz versucht Kriminalität mit einem Zusammenhang zwischen der Kindheitsentwicklung und -erfahrungen, dem Bewusstsein und Impulsen zu erklären. Denn die Psychoanalyse sagt aus, dass in jedem Menschen das Potenzial steckt andere zu beschränken, zu schaden und wehzutun. Diese aggressiven Impulse zu unterdrücken oder in Schach zu halten wird durch die erlernten Fähigkeiten in der Kindheit gelenkt.
Zu Beginn wird ein Überblick über die Begrifflichkeiten und Grundlagen der Kriminologie verschafft. Des Weiteren werden die Grundlagen der Psychoanalyse nach Freud dargestellt und erklärt. Im Anschluss darauf werden das Strafrecht und die Psychoanalyse miteinander konfrontiert, sowie abschließend eine die Schlussfolgerung gezogen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Überblick der Kriminologie
2.1 Definition von Kriminologie
2.2 Grundlagen der psychoanalytischen Kriminologie
3 Grundlagen der Psychoanalyse
3.1 Das Es
3.2 Das Ich
3.3 Das Über-Ich
4 Konfrontation des Strafrechts mit der Psychoanalyse
4.1 Triebe und Verbrechen
4.2 Narzisstische Störungen
4.3 Psychopathie
5 Schlussfolgerung
6 Literaturverzeichnis