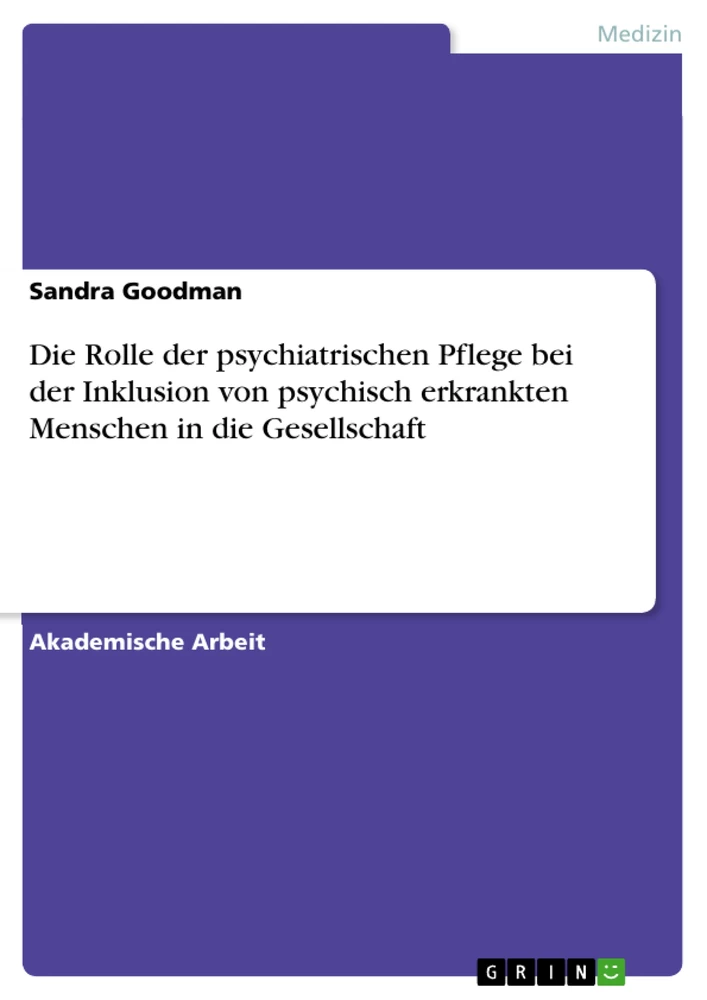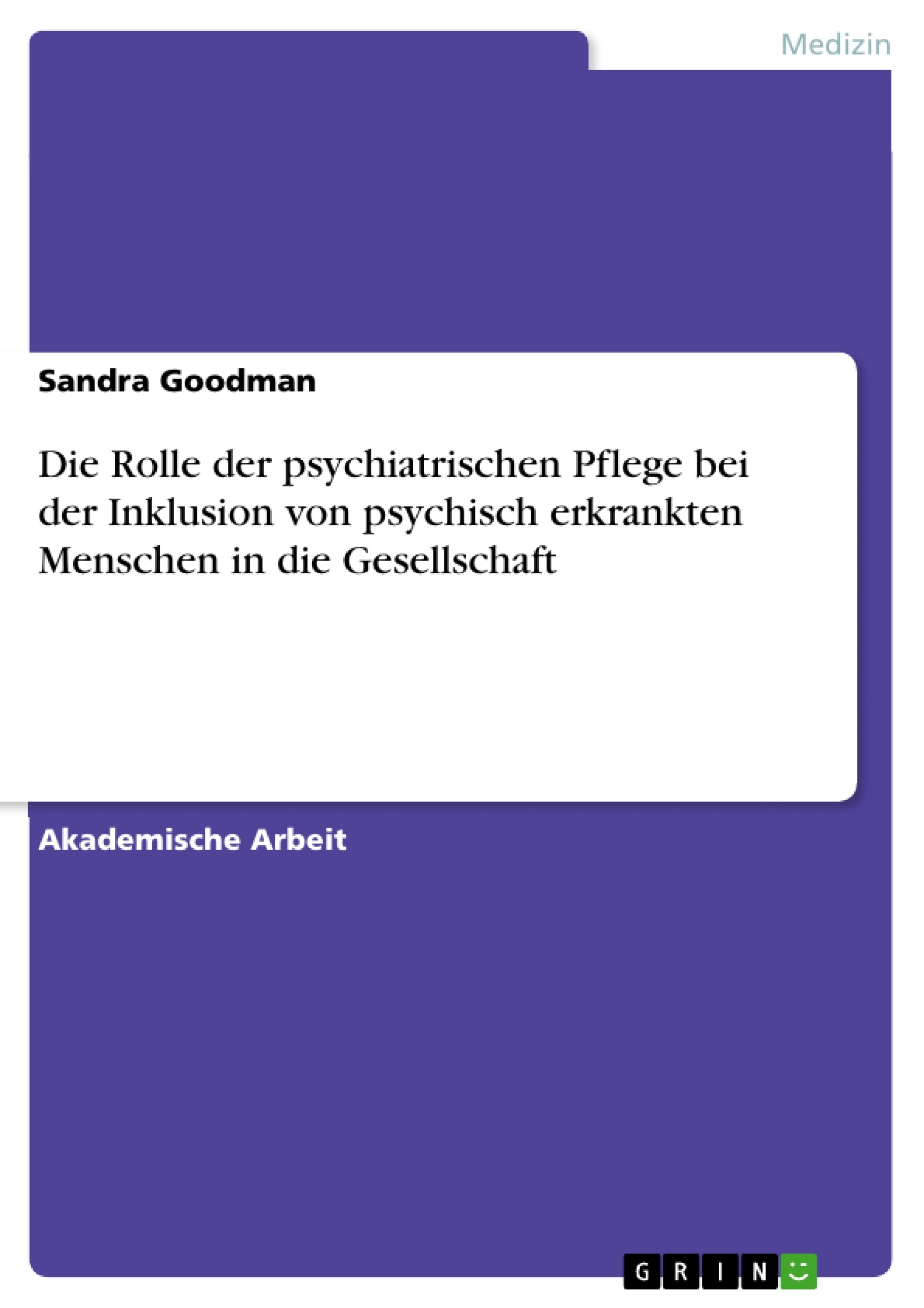Jeder Mensch hat das Recht auf Inklusion bzw. auf die Zugehörigkeit zum gesellschaftlichen Leben, so steht es in der UN-Behindertenkonvention. Diese Aussage gilt auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Menschen mit psychischen Erkrankungen sind teilweise in der Gesellschaft angekommen, sie sind aber teilweise auch von Stigmatisierung bedroht. Die Psychiatrische Pflege unterstützt, betreut und hilft diesen Menschen bei der Eingliederung in das gesellschaftliche Leben.
Aus dem deutschsprachigen und englischsprachigen Raum liegen einige Publikationen zur Inklusionsarbeit von Menschen mit psychischen Erkrankungen in der Psychiatrie vor. Das Ziel dieser Literaturübersicht ist es, einen Überblick über die Rolle der Psychiatrischen Pflege bei der Integration psychisch erkrankter Menschen zu schaffen. Es wurde eine systematische Literatursuche in den Datenbanken PubMed, Aktion psychisch Kranke und der Zeitschrift Pflegewissenschaft durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Abstract
Summary
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Einleitung
Problemstellung
Fragestellung
Zielsetzung
1. Methodik
2 Theoretischer Hintergrund
2.1 Stützpunkte der Arbeit und deren Definitionen
2. 2 Inklusion und I ntegration
2.3 Integration
2.4 Inklusion
2.5 Ziel und Aufgaben der Inklusion
3 Einführung in die Definition von psychiatrische Erkrankungen
3.2 Klassifikation psychischer Erkrankung
3.3 Folgen von psychischen Erkrankungen
4 Ergebnisse
5 Psychiatrische Pflege im Zusammenhang mit der Inklusion
5.1 Die Aufgaben der psychiatrischen Pflege
5.2 Die Rolle der psychiatrischen Pflege bei der Inklusion psychisch erkrankter Menschen in der Gesellschaft
5.3 Unterstützung beim selbstbestimmten Wohnen
5.4 Teilhabe an Arbeit und Beschaftigung
5.5 Die Rolle der psychiatrischen Pflege bei der Inklusion psychisch erkrankter Menschen in der Gesellschaft aus Sicht von Dirk Richter
6 Schlussfolgerung
7 Literaturverzeichnis
Anhang
I. Systematische Literaturrecherche
II. Literaturrecherche: National Bibliothek
III. Literaturrecherche: Katalog Plus der Frankfurt University
IV. Literaturrecherche: PubMed
V. Literaturrecherche: Pflegewissenschaft Zeitschrift
VI. Literaturrecherche Aktion Psychisch Kranke
VII. Literaturrecherche: Internet