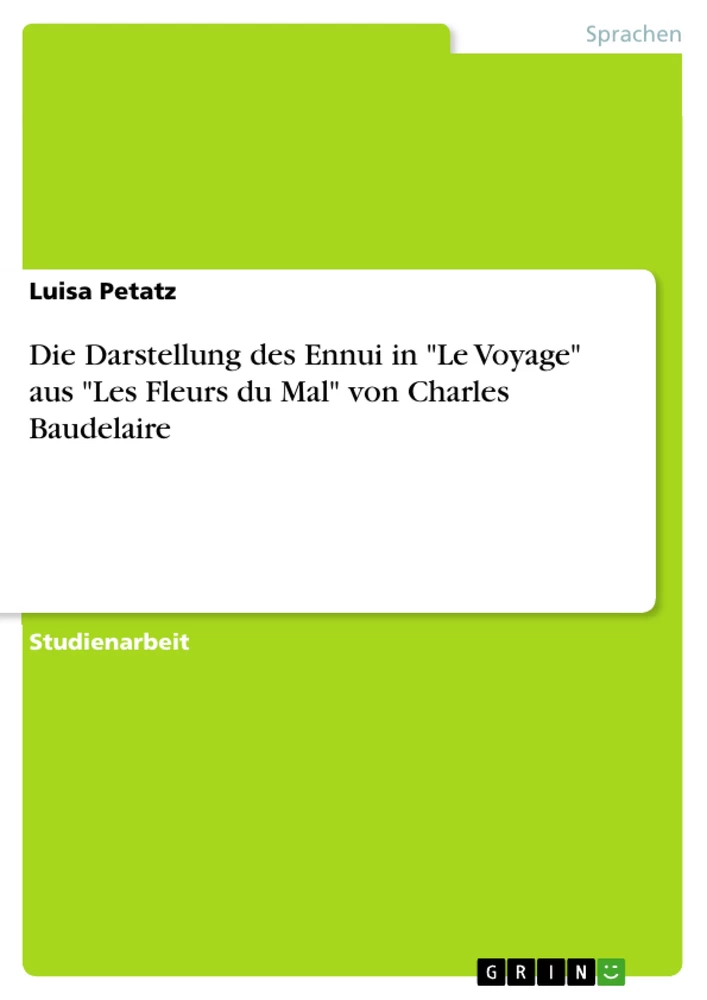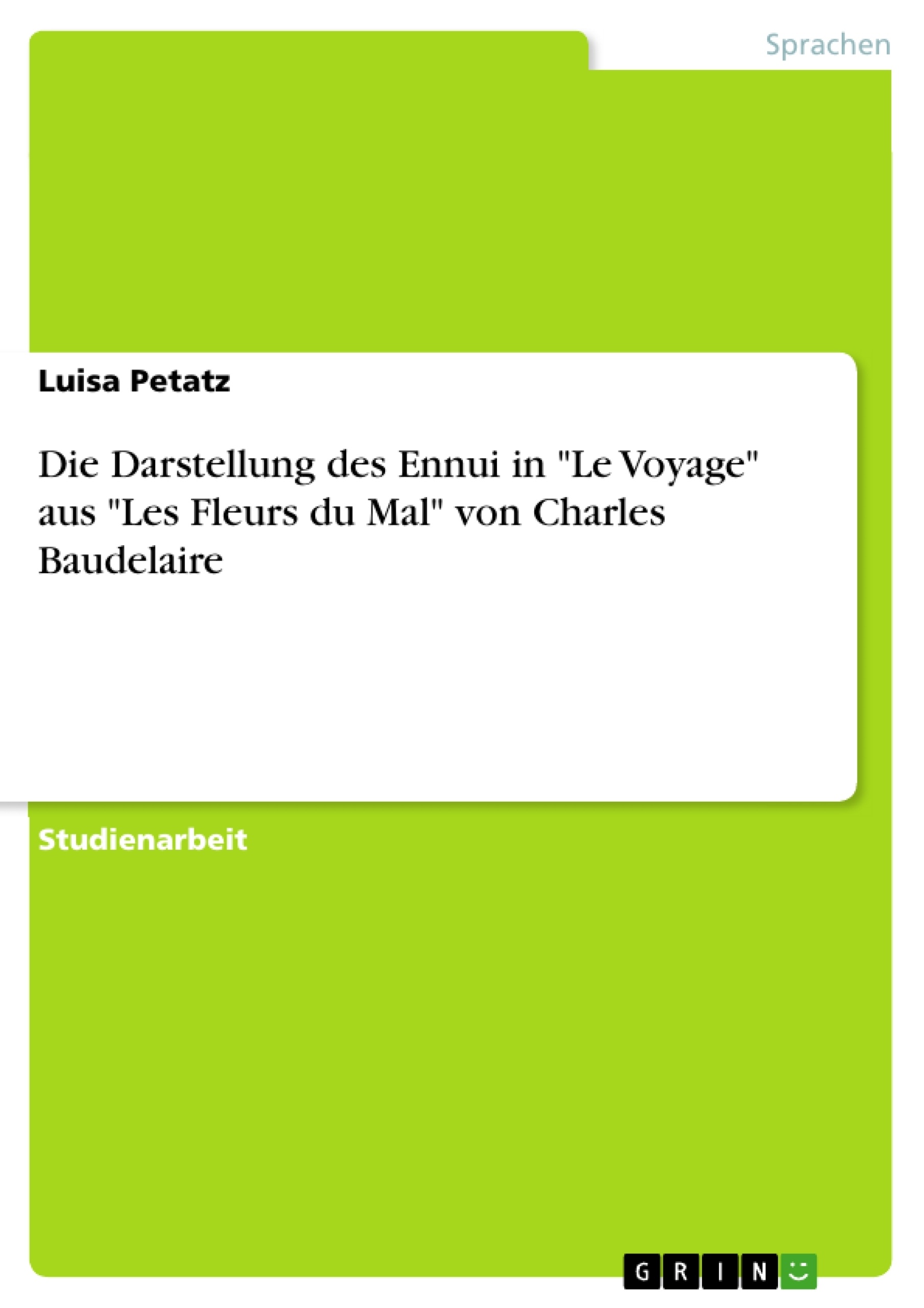Die Hausarbeit analysiert ein Gedicht im letzten Kapitel ("La Mort") in "Les Fleurs du Mal": "Le Voyage". Um den Zusammenhang in dem Werk dazustellen, zeigt sie anfangs kurz den Aufbau der "Fleurs du Mal" auf. Im Hauptteil beantwortet sie die Frage, wie Baudelaire das Ennui in seinem längsten Gedicht des Werkes darstellt. Das und besonders der Einfluss der griechischen Mythologie werden dabei Gegenstand der Interpretation sein.
Das Reisen, besonders die Reisen mit dem Schiff über die Weltmeere sind in der Weltliteratur ein überaus beliebtes Motiv. Auch Charles Baudelaire widmete sich in vielen seiner Werke diesem Thema. 1841, mit 20 Jahren, trat er selbst eine Schiffsreise an. Vor allem getrieben von seinen Eltern, aber vielleicht auch aus eigenen Stücken, als Flucht aus seiner nicht so einfachen Kindheit. Ein Jahr war er auf den Weltmeeren unterwegs und nahm von dort viele Inspirationen für seine Meisterwerke mit. Sein wahrscheinlich größtes ist "Les Fleurs du Mal", welches in 3 Fassungen (von 1857 bis 1868) erschien.
Inhaltsverzeichnis
I Einleitung
II Les Fleurs du Mal
II.1 Kurzer Aufbau der Les Fleurs du Mal
II.2 Interpretation des Gedichtes ‚Le Voyage‘ mit Blick auf den Einzug der grie- chischen Mythologie
II.3 Die besondere Stellung des Gedichtes ‚Le Voyage‘
III Zusammenfassung