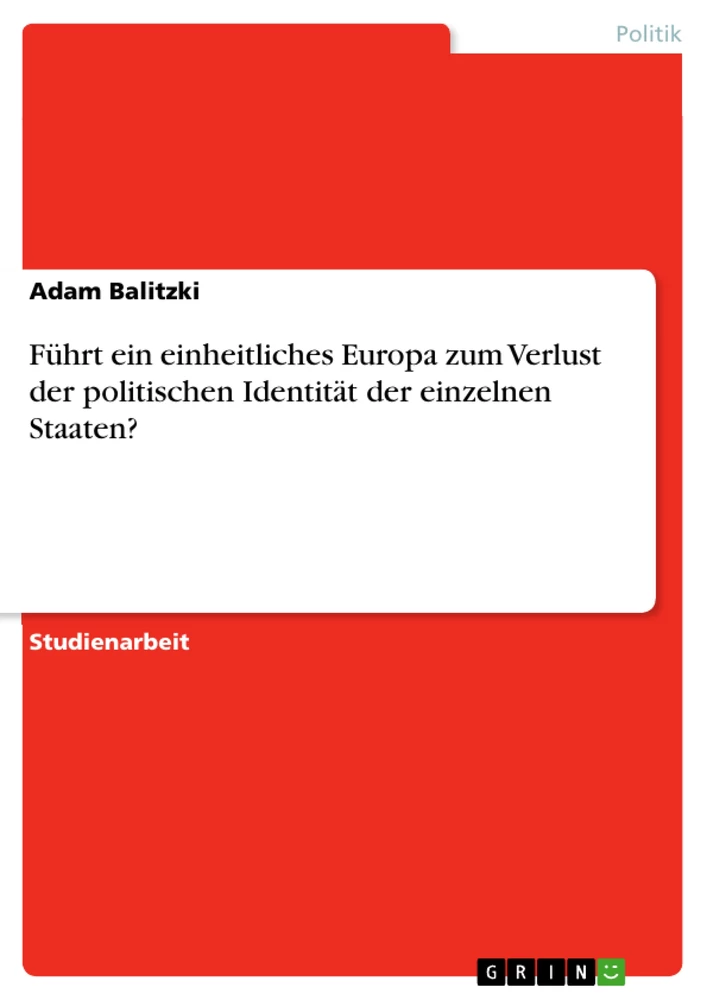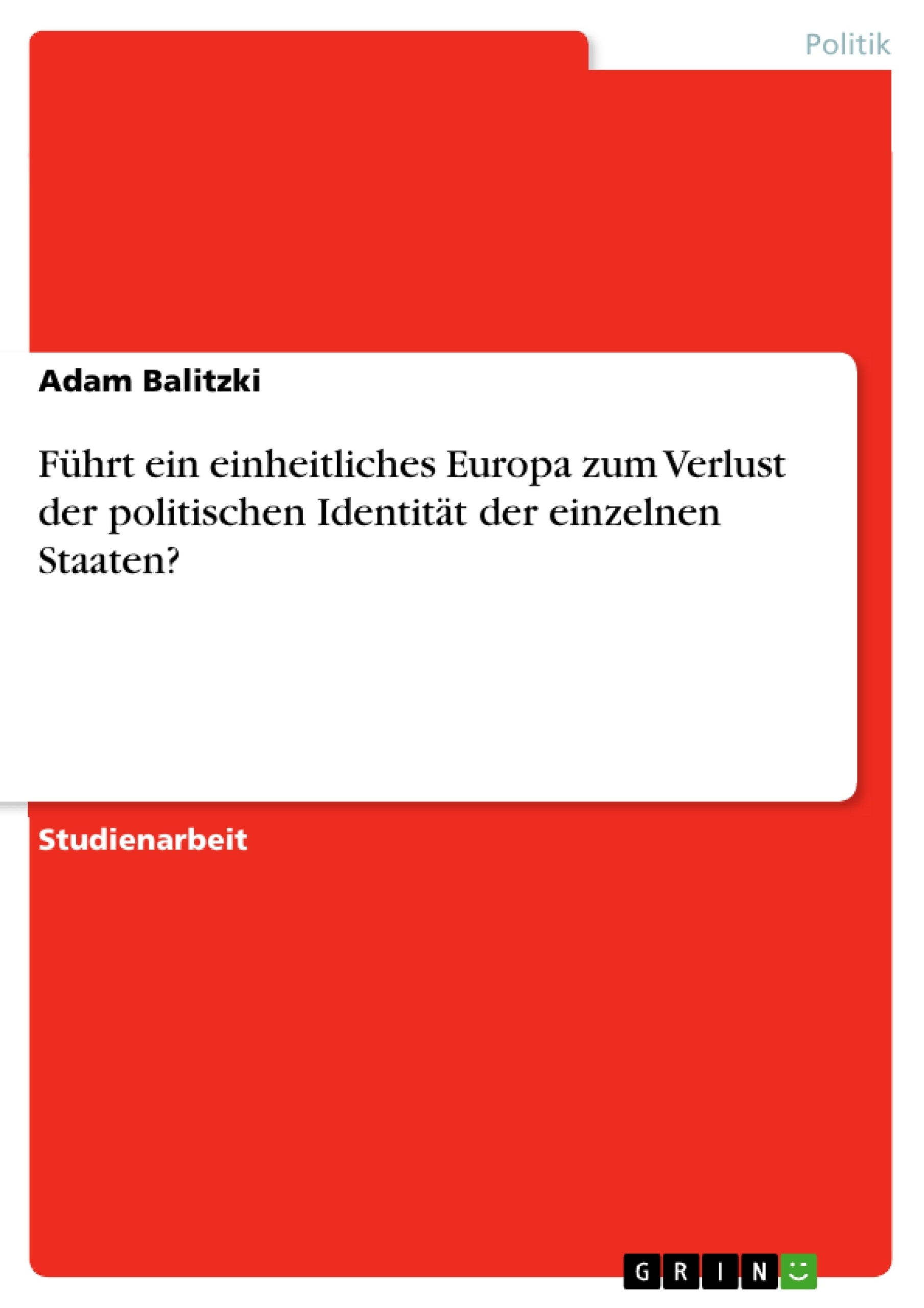Die Hausarbeit befasst sich mit folgender These: Ein einheitliches Europa führt zu Verlust der politischen Identität der einzelnen Staaten. Als wesentliche Quelle für diese Hausarbeit wurden vor allem zwei Texte verwendet: „Die Zukunft des Staates“ von Joachim Hirsch und Bob Jessop, in dem frühe Theorien über die Europäisierung der Nationalstaaten beschrieben werden sowie „Über die Europäisierung aus der heutigen Sicht“ von Prof. Dr. Ludger Kühnhardt.
Zur Einführung befasst sich die Arbeit mit dem Staatshistoriker und Philosophen Thomas Hobbes und seinem 1651 veröffentlichten Werk „Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates“. In diesem Werk erörtert Thomas Hobbes die Natur des Menschen und die Rechtmäßigkeit politischer Herrschaft.
Es folgt ein kurzer historischer Rückblick zur Entstehung der Europäischen Union, ihrem politischen Hintergrund sowie den damit einhergehenden Beweggründen und Zielen, die der Staatenbund verfolgt. Im Anschluss daran wird erörtert, ob die Europäisierung der einzelnen Staaten zu einem Verlust ihrer politischen Identität führt und wie die Kluft zwischen West- und Osteuropa trotz des geschichtlichen und kulturellen Hintergrundes mit Hilfe eines einheitlichen Europas überwunden werden kann.
Der letzte Teil der Arbeit geht auf die Vorteile einer Europäisierung ein, die aktuelle Lage zur Identitätsbildung innerhalb der Europäischen Union und ob bzw. wie die gegensätzlichen Ansichten der Mitgliedstaaten überwunden werden können.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Staatstheorie nach Thomas Hobbes
3. Geschichte der Europäischen Union
3.1 Von der Montanunion zur Europäischen Gemeinschaft
3.2 Ende und Beginn eines Jahrtausends
4. Verlust der politischen Identität
4.1 Was ist Identität?
4.2 Bildung der politischen Identität
- Personale Identität
- Soziale Identität
4.3 West- und Osteuropa
4.4 Voraussetzung für mehr Europa
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis