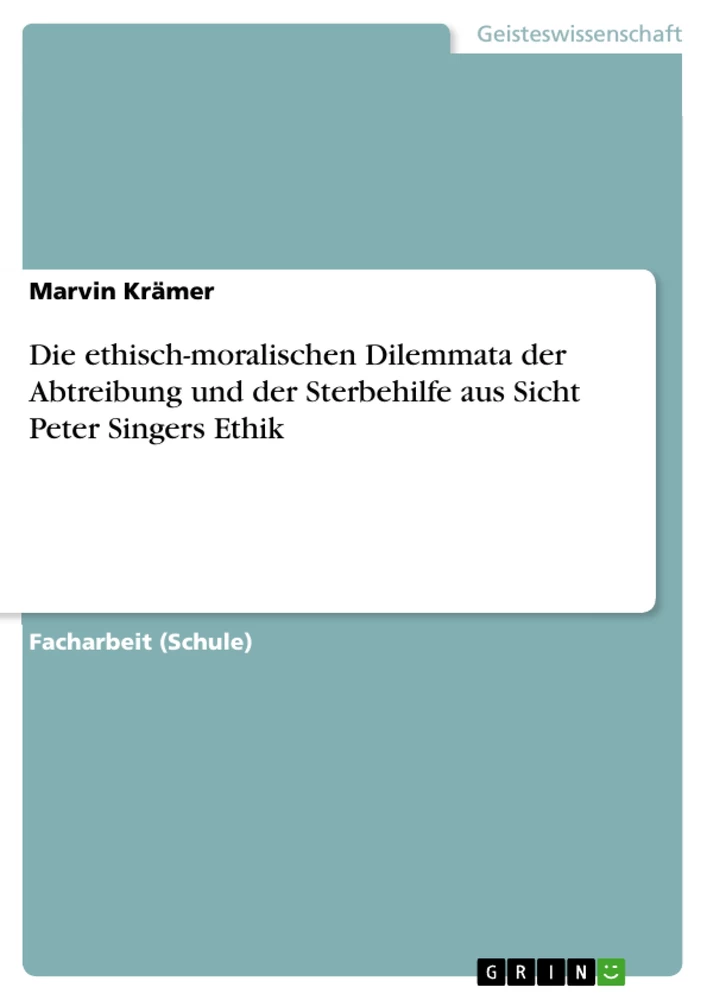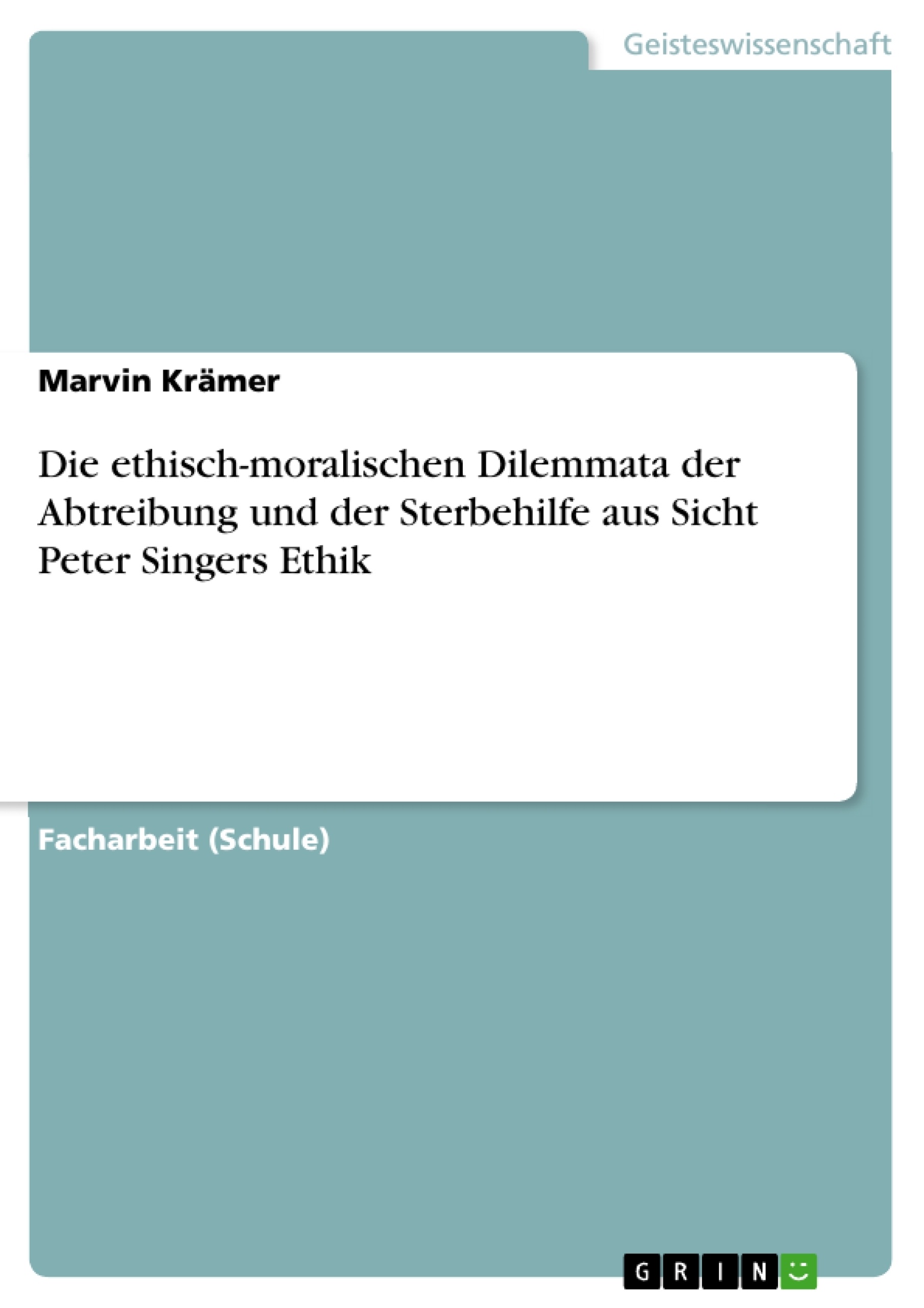Peter Singer, einer der umstrittensten Philosophen, stellt in seinem Werk "Praktische Ethik" seine Ansichten zum moralischen Wert des menschlichen Lebens dar.
Laut Singer besitzt der Mensch keinen An-sich-Anspruch auf Leben und spricht ihm die ethische Schutzwürdigkeit ab; der Wert menschlichen Lebens ist laut Singer weniger absoluter, sondern vielmehr relativer Natur.
Diese Facharbeit analysiert Singers Argumentationsweise und legt dar, warum sich seine Argumentation als nicht überzeugend herausstellt.
Die gesellschaftliche Debatte über Schwangerschaftsabbrüche und Sterbehilfe rückt mit dem fortlaufenden Fortschritt der Medizin immer stärker in die öffentliche Wahrnehmung. Zu den besonders kontrovers diskutierten Autoren im medizinethischen Diskurs gehört der australische Philosoph Peter Singer. Er lässt sich der utilitaristischen Ethikkonzeption zuordnen, welche die moralische Richtigkeit einer Handlung anhand derer positiver und negativer Konsequenzen für die Mehrheit der Personen beurteilt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Grundbegriffe und Thesen der Singers’schen Ethik
3. Legimitation von Schwangerschaftsabbrüchen und der Euthanasie
3.1 Moralische Bewertung von Schwangerschaftsabbrüchen
3.2 Moralische Bewertung der Euthanasie als Mittel zur Verminderung von Leid
4. Kritk
5. Fazit
6. Verzeichnisse
6.1 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Die gesellschaftliche Debatte über Schwangerschaftsabbrüche und Sterbehilfe wird mit dem fortlaufenden Fortschritt der Medizin immer stärker in die öffentliche Wahrnehmung gerückt. Zu den besonders kontrovers diskutierten Autoren im medizinethischen Diskurs zählt der australische Philosoph Peter Singer; Die Kontroverse um Singer entstand bereits Ende der achtziger Jahre und äußerste sich in Störungen seiner Vorträge, erheblichen Protesten gegen seine Vorlesungen in Universitäten sowie Ausladungen zu Folgevorträgen (vgl. Geißendörfer 2009, S. 44). Bis heute sind seine Ansichten zum moralischen Wert des menschlichen Lebens, insbesondere dem Wert frühmenschlichen Lebens, welche er in seinem Werk „Praktische Ethik“ (dritte Auflage: 2013; erste Auflage 1984) entwickelte, stark umstritten.
Singers Auffassung zufolge besitzt der Mensch keinen An-sich-Anspruch auf Leben und spricht ihm die ethische Schutzwürdigung ab; der Wert menschlichen Lebens ist laut Singer weniger absoluter, sondern vielmehr relativer Natur. Von diesem argumentativen Ausgangspunkt aus diskutiert und bewertet er die ethische Vertretbarkeit des Tötens Bezugsrahmen der ethischen Frage nach der moralischen Bewertung von Schwangerschaftsabbrüchen, Sterbehilfe und Kindstötung. Singer argumentiert zugunsten der Tötung von frühmenschlichem Leben wie Embryonen oder Föten sowie der Euthanasie an Neugeborenen, denen z.B. aufgrund einer schwerwiegenden Behinderung vorrausichtlich nur ein kurzes leidvolles Leben bevorsteht.
In dieser Facharbeit werde ich die die Argumentationsweise Singers analysieren und darlegen, warum sich seine Argumentation aus mehreren Gründen als nicht überzeugend herausstellt.
In einem ersten Schritt werden die Grundbegriffe von Singers ethischen Thesen erläutert. In einem zweiten Schritt werden seine Argumente für die moralische Vertretbarkeit der Tötung von pränatalem menschlichem Leben und dem schwerbehinderten Neugeborenem aufgeführt, in einem dritten Schritt wird die Argumentation aus kritisch beurteilt, Anschließend werden die generierten Ergebnisse zusammengefasst.
2 Grundbegriffe und Thesen der Singers'schen Ethik
Zuerst werden die Begriffe des Präferenz-Utilitarismus, der Person erläutert und die grundlegenden Voraussetzungen für eine kritische Auseinandersetzung mit den Ansichten Peter Singers geschaffen, um eine kritische Begutachtung von Abtreibung und Euthanasie von schwerbehinderten Säuglingen gemäß Peter Singers Thesen zu ermöglichen.
Grundlagen der ethischen Ansichten Peter Singers
Singer lässt sich der utilitaristischen Ethikkonzeption zuordnen, welche die moralische Richtigkeit einer Handlung anhand derer guten und schlechten Konsequenzen für die maximale Anzahl von Personen beurteilt wird. (vgl. Schöne-Seifert 2007, S. 30 f.). Im Gegensatz zum klassischen Utilitarismus definiert Singer den guten oder schlechten Nutzen einer Handlung nicht anhand subjektiver Empfindungen wie z.B. Glück oder Zufriedenheit, sondern durch die sich in bestimmten Verhaltensweisen entstehenden „Präferenzen“ d.h. die. individuellen Bedürfnisse und Interessen der von der bestimmten Handlung betreffenden Personen, (vgl. 2013, S. 39, 41). Diese spezielle Form des Utilitarismus wird als „Präferenz-Utilitarismus“ bezeichnet (vgl. hierzu ebd., S. 41). Das Ziel des Präferenz-Utilitarismus“ ist die größtmögliche Erfüllung der interpersonellen Summe; daher ist eine Handlung gemäß Singers Ansichten genau dann moralisch korrekt, wenn die auf diese bestimmte Handlung folgenden Konsequenzen die Präferenzen der, von dieser Handlung betroffenen Personen , fördern, (vgl. ebd., S. 40 f.).
Gemäß Singer müssen moralische Urteile immer von einem universalen, daher unvorhereingenommenen, Standpunkt aus getroffenen. Ein moralisch denkender Mensch muss folglicher Weise seine eigenen persönlichen Präferenzen denen anderer Personen in ihrer Wichtigkeit gleichzusetzen (ebd., S. 39).
Dieses, der Theorie Singers zugrunde liegende, moralische Prinzip wird als Prinzip der gleichen Interessenabwägung bezeichnet.
Das Prinzip verbietet demnach, dass die Gewichtung von etwas anderem beeinflussbar gemacht wird als den jeweiligen Interessen selber. Jedoch gilt für den Philosophen die Anwendung dieses moralischen Prinzips nicht nur in Bezug auf die Rasse Mensch. Sondern für jede „Person“. Eine Person ist gemäß Singer ein empfindungsfähiges Lebewesen, das empfindungsfähig ist und eigene Interessen entwickeln kann. Aus diesem Grund müssten auch Tiere berücksichtigt werden, denn einige, so Singers Begründung, sind empfindungsfähige Lebewesen. Daraus geht hervor, dass für Singer die Empfindungsfähigkeit, d.h. „die Fähigkeit, Leid oder Freude bzw. Glück zu empfinden“ (ebd., S. 102), das Kriterium dafür ist, Anspruch auf gleiche Interessenabwägung zu haben.
Die Wahrnehmung von Leid und Freude ist somit eine Grundbedingung dafür Interessen eigenständig entwickeln zu können. „Eine Maus dagegen hat ein Interesse daran, nichtgequältzu werden, weilsie dabei leiden wird“. (Singer2013, S. 101)
Weil gemäß Singers Sicht alle empfindungsfähigen Lebewesen; daher Personen, leiden können, müssten die Interessen von empfindungsfähigen Tieren und Menschen gleichgesetzt werden. Eine Bevorzugung der eigenen Spezies Mensch bezeichnet Singer als ein spezifisches Vorurteil, das nicht zu rechtfertigen ist (vgl. ebd., S. 99). Eine moralische Bewertung des Zufügens von Schmerzen gegenüber Tieren z.B. während des Schlachtens kann für Singer nicht von der Spezienzugehörigkeit abhängig gemacht werden (vgl. ebd., S. 143) und ist für ihn unvereinbar mit dem moralischen Prinzip der gleichen Interessenabwägung, da die Interessen eines Menschen mit denen eines empfindungsfähigen Tieres gleichzusetzen sind.
Dasselbe gilt für Singer nun ebenfalls für das Töten von menschlichem Leben. Es gäbe laut keinen moralisch zu rechtfertigen Grund, warum artgleiches Leben wertvoller sein sollte als das Leben irgendeiner anderen Art:
„Dem Leben eines Wesens bloß deshalb den Vorzug zu geben, weil das Lebewesen unserer Spezies angehört, würde uns in eine unangenehme Position bringen. Sie gleicht jener der Rassisten, die denen den Vorzug geben, die zu ihrer Rasse gehören (ebd., S. 143) Singer setzt voraus, dass Schmerzen und Leiden grundsätzlich schlecht sind und daher vermieden werden sollten“) (vgl. Singer, 2013, S. 106).
Wie kann aber dann das Töten menschlichen Lebens moralisch gerechtfertigt werden? Gemäß Singers Theorie ist zwischen den beiden Begriffen des „menschlichen Lebens“ und des „menschlichen Wesens“ zu unterscheiden, die sich zwar überschneiden aber nicht immer zusammenfallen (vgl. ebd., S. 141). Der Begriff des „menschlichen Lebens“ ist im Sinne einer biologischen Existenz bzw. der Zugehörigkeit der Spezies „Homo sapiens“ zu begreifen. Der Begriff des menschlichen Wesens dagegen bezeichnet den Menschen als eine Person (vgl. dazu ebd., S. 140-142). Singer lehnt sich hier an, den von John Locke formulierten Personenbegriff, an, unter dem eine Person als ein vernunftbegabtes und selbstbewusstes Wesen verstanden wird (vgl. ebd., S. 142 f.). Da die Tötung eines menschlichen Wesens in der ersten Bedeutung angesichts Singers Prinzipien keine moralische Ungerechtigkeit, kommt die Frage auf, wie die Tötung einer Person moralisch zu bewerten ist.
Aus dieser präferenz-utilitaristischer Sichtweise ist es in der Regel moralisch ungerechter, eine Person, gemäß dem Personenbegriff nach John Locke, als ein nichtpersonales oder bloß empfindungsfähiges Wesen zu töten. Dieser von Singer entwickelte Unterschied zwischen einer Person und einer Nicht-Person begründet dies. Im Gegensatz zur Tötung einer Schnecke, die nicht fähig ist, Wünsche für die Zukunft zu haben, würde die Tötung einer Person bedeuten, ihre Zukunftswünsche auszulöschen und so viele Präferenzen, die eine Person im Leben haben könnte, zu verhindern, (vgl. dazu ebd., S. 146, 152).
„Um ein Recht auf Leben zu haben, muss man wenigstens irgendwann - die Vorstellung einer fortdauernden Existenz haben.“ (Singer „Praktische Ethik“ Auflage 3 2013, S. 157)
Ein exentielles Problem von Singers Ansichten wird bereits deutlich: gemäß der Theorie des Präferenz-Utilitarismus überwiegt eine Mehrheit von Präferenzen einer Einzelnen in ihrer Wichtigkeit, daher wird die Präferenz bzw. das Interesse einer Person zu überleben durch starke Präferenzen anderer überwogen, so wäre die Tötung dieser bestimmten Person nicht unrecht bzw. sogar moralisch richtig (vgl. Singer (2013), S. 153).
[...]