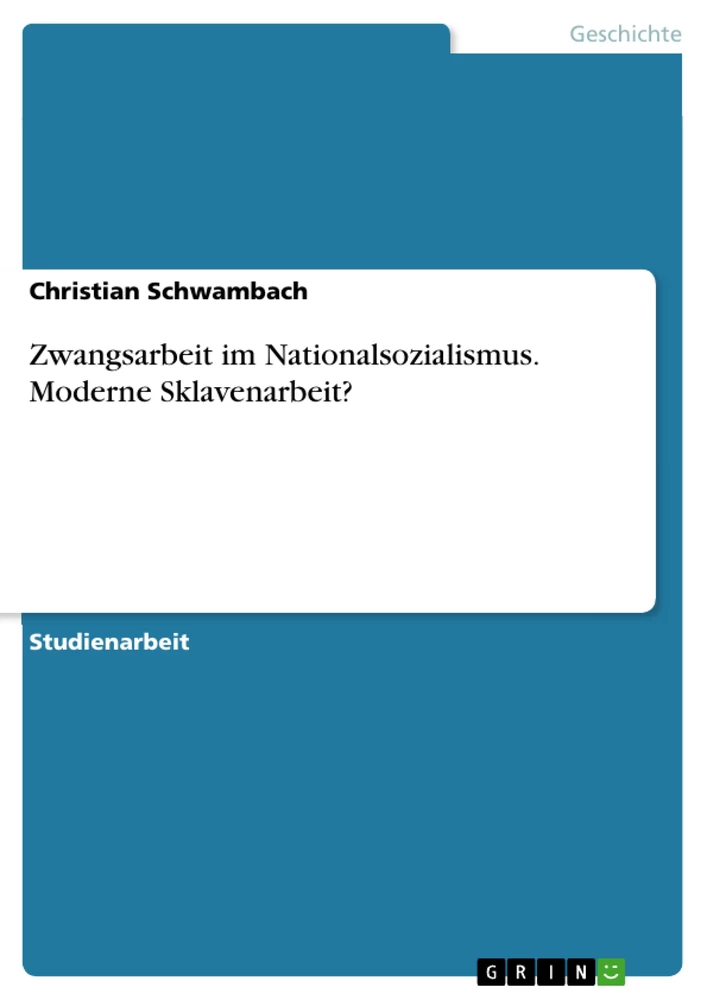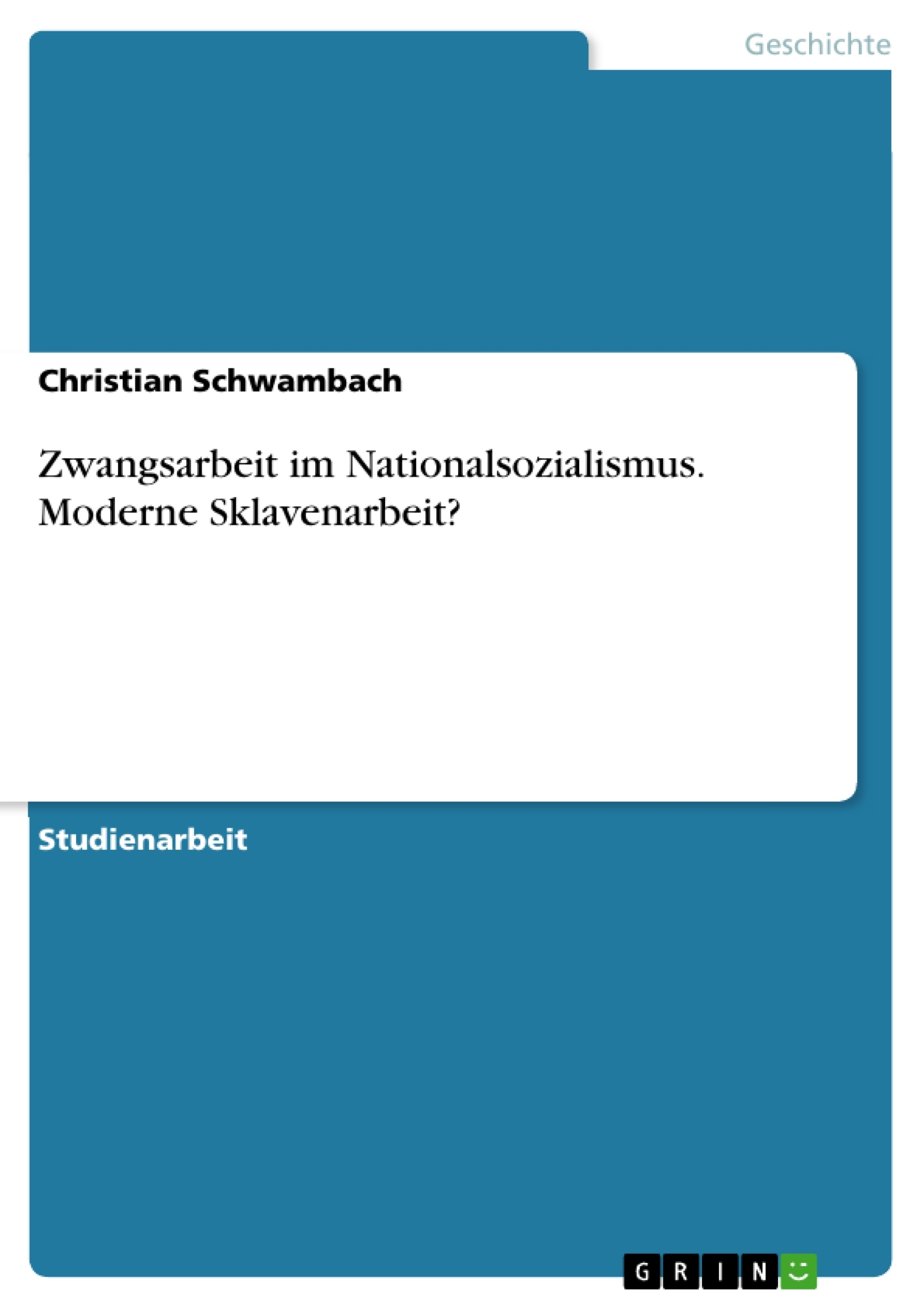Am 30. Januar 1933 kamen die Nationalsozialisten an die Macht. Nach der zwölfjährigen Regierungszeit Hitlers waren große Teile Europas durch den zweiten Weltkrieg zerstört worden und Millionen Menschen hatten ihr Leben verloren. Einen elementaren Wert für den Krieg und die nationalsozialistische Wirtschaft besaß die Zwangsarbeit. In dieser Arbeit soll analysiert werden, inwieweit diese als Sklavenarbeit bezeichnet werden kann. Aus diesem Grund werden zunächst die Merkmale der antiken Zwangsarbeit untersucht. Im dritten Kapitel wird die Zwangsarbeit im Nationalsozialismus thematisiert, bevor beide Formen der unfreien Arbeit verglichen werden.
Die Zwangsarbeit im Nationalsozialismus ist sehr gut erforscht worden. Dies lässt sich auch durch die zahlreichen Akten aus den Archiven der Unternehmen belegen. Es muss allerdings festgehalten werden, dass die Erforschung direkt nach dem Ende des zweiten Weltkrieges forciert wurde. In der Bundesrepublik lag das Interesse zunächst bei der Machtergreifung. Die Kriegsjahre und der damit verbundene verstärkte Einsatz von Zwangsarbeitern rückten erst in den 1980ern in den Fokus. Es muss allerdings angemerkt werden, dass es in der DDR schon früher Ansätze zur Erforschung dieser Thematik gab. Einen weiteren Aufschwung bekam die Forschung durch das Ende des kalten Krieges. Insbesondere die Zwangsarbeit in Osteuropa ist dabei in den Fokus gerückt. Mit dem Fall des Eisernen Vorhanges hatten auch westliche Historiker Zugang zu den Archiven. Weiterhin solidarisierten sich viele ehemalige osteuropäische Zwangsarbeiter, um Entschädigungsforderungen geltend zu machen. Im Zuge dieser Verfahren mussten die historischen Hintergründe genauer untersucht werden, was die Forschung beschleunigte. Es muss dennoch angemerkt werden, dass es auch bei der Erforschung der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus Desiderate gibt. Hierbei ist beispielsweise die Rekrutierung zur Zwangsarbeit in den von der Wehrmacht besetzten Gebieten zu nennen. Einen sehr guten und umfangreichen Einblick in die Thematik findet sich bei Mark Spoerer. Dessen Monografie zeichnet sich vor allem durch ein großes Maß an Statistiken aus.
Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Merkmale der antiken Sklavenarbeit
3. Zwangsarbeit im Nationalsozialismus
4. Vergleich von antiker Sklavenarbeit und Zwangsarbeit im Nationalsozialismus
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis