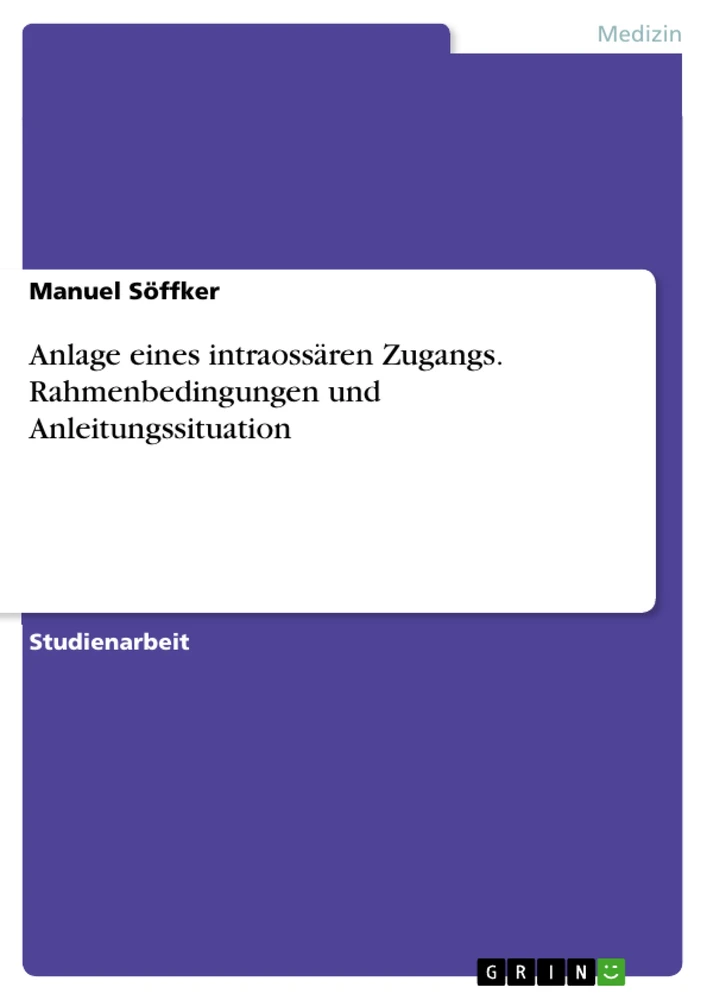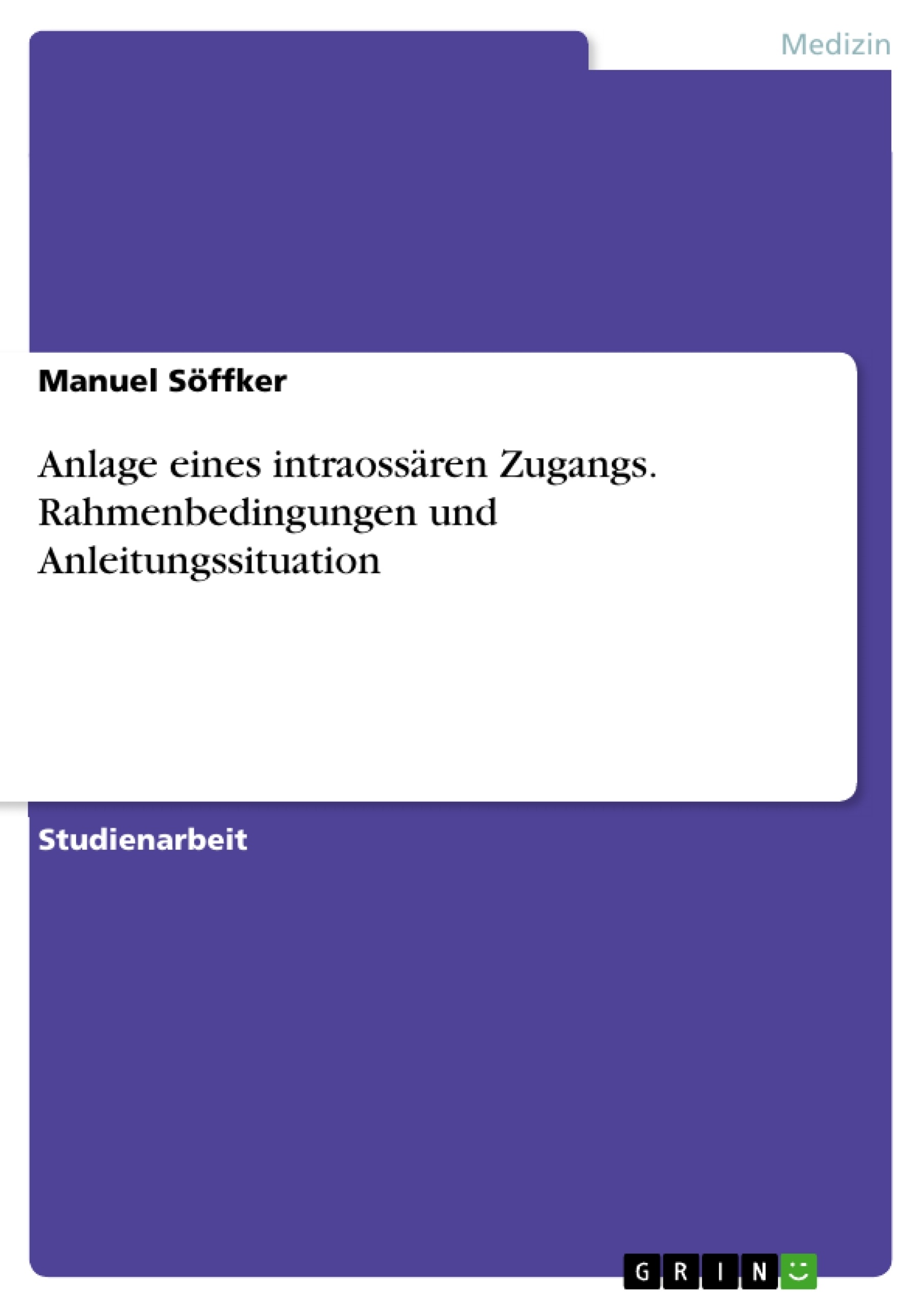Diese Facharbeit wurde im Rahmen der Weiterbildung zum Praxisanleiter als schriftliche Modulabschlussprüfung geschrieben und hat das Ziel einen verständlichen, strukturierten Ablauf einer geplanten Anleitung im Alltag eines Praxisanleiters aufzuführen. Autor ist ein 25-jähriger Praxisanleiter, welcher neben einem guten Fachwissen über ein starkes Interesse an der Unterweisung neuer Mitarbeiter und Schüler verfügt.
In dieser Facharbeit wird beschrieben, wie eine solche Anleitungssituation geplant und durchgeführt wird. Thema ist die Anlage eines intraossären Zuganges mittels des EZ-IO Bohrers. Verschiedenste Analysen zur Vorbereitung werden separat aufgeführt und verständlich erklärt. Zusätzlich enthält die Facharbeit eine wissenschaftliche Ausarbeitung zum Thema intraossären Zugang mit Themenbereichen wie Voraussetzungen und Kontraindikationen.
Dem Autor ist es wichtig, dass die Anlage eines intraossären Zugangs im Rettungsdienst reibungslos abläuft. Er vertritt die Meinung, dass jeder angehende Notfallsanitäter im dritten Lehrjahr diese Fertigkeit beherrschen sollte. Der Praxisanleiter hat für die Anleitung Ziele formuliert, welche auf die zu erreichenden Handlungskompetenzen ausgelegt sind. Eine für diese Anleitung geeignete Lehrmethode wird definiert und auch begründet.
In einem darauffolgenden Ablaufplan wird die Durchführung der Anleitungssituation beschrieben. Zum Abschluss der Facharbeit erfolgt ein Soll-Ist-Vergleich, welcher aufzeigen soll, ob die geplante Anleitung die vorab gesetzten Ziele erreicht hat. Die Anleitung zielt darauf ab, ein handlungsorientiertes und selbstständiges Lernen zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Wissenschaftlicher Teil / intraossärer Zugang
2.1 Indikation
2.2 Kontraindikationen
2.3 Komplikationen
2.4 Punktionsorte
2.5 Durchführung
3. Praktischer Teil / Bedingungsanalyse
3.1 Umfeldanalyse
3.2 Lehrvoraussetzungen
3.3 Lernvoraussetzungen
4. Lernziele
5. Methode der vier Stufen
5.1 Vorbereitung
5.2. Durchführung
5.3 Nachbesprechung
6. Fazit
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Anhang
Anmerkung
1. Einleitung
Diese Facharbeit wurde im Rahmen der Weiterbildung zum Praxisanleiter als schriftliche Modulabschlussprüfung geschrieben und hat das Ziel einen verständlichen, strukturierten Ablauf einer geplanten Anleitung im Alltag eines Praxisanleiters aufzuführen. Autor ist ein 25-jähriger Praxisanleiter, welcher neben einem guten Fachwissen über ein starkes Interesse an der Unterweisung neuer Mitarbeiter und Schüler verfügt. Auf der Rettungswache ist er zurzeit für insgesamt drei Schüler zuständig. Für den Autor spielt die Praxisanleitung im Rettungsdienst eine sehr große Rolle. Ihm ist eine qualitativ hochwertige Ausbildung angehender Notfallsanitäter sehr wichtig. Mit dem Inkrafttreten des Notfallsanitätergesetz (NotSanG) am 01.01.2014 und der entsprechenden Ausbildungs- und Prüfungsordnung (NotSan-APrV) wird eine outputorientierte Ausbildung im Lernfeld gefordert, welche auf eine berufliche Handlungskompetenz mit den Bestandteilen Fach-, Sozial-, Personal- und Methodenkompetenz abzielt. Die Einrichtungen der praktischen Ausbildung stellen die Praxisanleitung der Schülerinnen und Schüler (vgl. §3 Abs. 1, NotSanG) sicher. Die dafür notwendigen Praxisanleiter sind zuständig, den Schüler in seiner dreijährigen Ausbildung zum Notfallsanitäter zu begleiten und anzuleiten. Stets sollte hierbei das Ziel sein, den Schüler bei der Entwicklung verschiedenster Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen zu unterstützen. Auf der Rettungswache erhält der Schüler hierfür eine Vielzahl möglicher Lernfelder, welche Bestandteil seiner Ausbildung sind und entsprechend des Lehrjahres parallel in der Schule als auch auf der Rettungswache gelehrt werden. Im Rahmen der Ausbildung sind durch die NotSan-APrV mindestens 196 Stunden situative oder geplante Anleitungen gefordert.
In dieser Facharbeit wird beschrieben, wie eine solche Anleitungssituation geplant und durchgeführt wird. Thema ist die Anlage eines intraossären Zuganges mittels des EZ-IO Bohrers. Verschiedenste Analysen zur Vorbereitung werden separat aufgeführt und verständlich erklärt. Zusätzlich enthält die Facharbeit eine wissenschaftliche Ausarbeitung zum Thema intraossären Zugang mit Themenbereichen wie Voraussetzungen und Kontraindikationen.
Dem Autor ist es wichtig, dass die Anlage eines intraossären Zugangs im Rettungsdienst reibungslos abläuft. Er vertritt die Meinung, dass jeder angehende Notfallsanitäter im 3. Lehrjahr diese Fertigkeit beherrschen sollte. Der Praxisanleiter hat für die Anleitung Ziele formuliert, welche auf die zu erreichenden Handlungskompetenzen ausgelegt sind. Eine für diese Anleitung geeignete Lehrmethode wird definiert und auch begründet. In einem darauffolgenden Ablaufplan wird die Durchführung der Anleitungssituation beschrieben. Zum Abschluss der Facharbeit erfolgt ein Soll-Ist-Vergleich, welcher aufzeigen soll, ob die geplante Anleitung die vorab gesetzten Ziele erreicht hat. Die Anleitung zielt darauf ab, ein handlungsorientiertes und selbstständiges Lernen zu ermöglichen.
2. Wissenschaftlicher Teil / intraossärer Zugang
Der Intraossäre Zugang ist in den letzten Jahren immer weiter in den Fokus des Rettungsdienstes gerückt, dies belegt eine Studie von M. Helm und B. Hossfeld, welche in den Jahren 2005 bis 2009 durchgeführt wurde.1 Durch die Schaffung des Berufsbildes Notfallsanitäters ist es nun, gemäß NotSanAPrV auch eine Regelkompetenz geworden, welche bei lebensbedrohlichen Zuständen oder schwerwiegenden Erkrankungen der Patienten angewendet werden darf.2 Dieses macht regelmäßige Trainings in der Durchführung obligatorisch. „Bei der notfallmedizinischen Versorgung kritisch kranker bzw. verletzter Kinder und Erwachsener ist es oft entscheidend, rechtzeitig einen Gefäßzugang für eine Pharmaka- und Infusionstherapie zu legen“3
Bei der intraossären Punktion wird eine Stahlkanüle in die Knochenmarkshöhle gebohrt oder gestochen. In der Epiphyse (proximales und distales Ende) des Knochenmarkraums befindet sich ein ausgedehntes System von Blutgefäßen, die vertikal (Havers-Kanäle) und horizontal (Volksmann-Kanäle) verlaufen. Durch die gute Durchblutung besteht die Möglichkeit, Medikamente und Flüssigkeiten schnell im zentralen Kreislauf des Körpers zu verteilen. Hierdurch wird ein nahezu zeitgleicher Wirkungseintritt wie bei der i.v Applikation erreicht (siehe Anhang). Neben den Blutgefäßen enthält der Intraossärraum eine Vielzahl von Nerven und Rezeptoren. Durch sensorische Rezeptoren, die Druckveränderungen registrieren, kann die Applikation von Flüssigkeiten für Patienten außerordentlich unangenehm und schmerzhaft sein. Dies kann bei bewusstseinsklaren Patienten eine Lokalanästhesie erfordern.4
Aufgrund eines in der Markhöhle herrschenden physiologischen Druckes von 20-30 mmHg ist zur Gewährleistung einer ausreichend hohen Durchflussrate von intraossär applizierten Infusionslösungen die Nutzung einer Druckinfusion sinnvoll.5 Der intraossäre Zugang stellt eine gängige Alternative zum intravenösen Zugang dar, weil die Applikation aller gängigen Notfallmedikamente freigegeben ist (siehe Anhang). Bei richtiger Anwendung ist eine hohe Erfolgsrate bei geringem Komplikationsrisiko sichergestellt6.
2.1 Indikation
Die Indikation für die Anlage eines intraossären Zugangs im Rettungsdienst ergeben sich aus den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI). Diese besagt, dass eine Anlage indiziert ist, falls eine akute Vitalgefährdung des Patienten gegeben ist, oder wenn das Anlegen eines intravenösen Zugangs misslingt bzw. sich soweit verzögern würde, dass es die zeitgerechte Versorgung des Patienten gefährde. Nach spätestens drei frustranen periphervenösen Punktionsversuchen oder nach 90-120 Sekunden sollte hier die Strategie gewechselt und ein intraossärer Zugang etabliert werden. Auch die Delegation, durch einen am Einsatz beteiligten Notarzt, kann die Anlage eines i.O Zuganges legitimieren. Zu jeder Zeit muss die korrekte Indikation und auch die medizinisch Notwendigkeit einer intraossären Infusion sowohl im Kindes- als auch im Erwachsenenalter im Einzelfall gegeben sein.7 8
2.2 Kontraindikationen
Im Rahmen einer akut Lebensbedrohlichen Situation gibt es für die Anlage eines intraossären Zugangs ausschließlich relative Kontraindikationen. Gewisse Gegebenheiten beim Patienten können den Erfolg der Punktion jedoch deutlich einschränken. Daher sollten diese auch beim akuten Notfall beachtet werden. Es ist sinnvoll, beim Vorliegen einer relativen Kontraindikation auf einen alternativen Punktionsort auszuweichen, sofern eine besser geeignete Punktionstelle vorhanden ist. Beispielsweise bei Vorliegen einer Femurfraktur auf das augenscheinlich gesunde Bein auszuweichen. Die Sensibilisierung des Schülers diesbezüglich ist wichtig. Folgende relative Kontraindikationen sind zu beachten:
- proximal der Punktionsstelle vorhandene Frakturen oder Gefäßverletzungen
- Kompartmentsyndrom an der zu Punktierenden Extremität
- Vorausgegangene Punktionen an derselben Extremität in den letzten 24-48h (auch Versuche!)
- Implantate an der zu punktierenden Stelle
- Angeborene Knochenerkrankungen (z.B. Glasknochen)
- Gefäßverletzung proximal der Punktionsstelle (Gefahr der Paravasatbildung)9 10
2.3 Komplikationen
Die Risiken und Komplikationen einer intraossären Punktion sind insgesamt äußerst gering. Die häufigsten Akutkomplikationen ergeben sich aus einer inkorrekten Punktionstechnik und/oder einer falschen Handhabung des Materials. Die Osteomyelitis ist eine seltene Spätkomplikation, die man durch eine kurze Verweildauer der intraossären Kanüle vermeiden kann. Besonderen Stellenwert hat hier das seitens des Herstellers mitgelieferte Patientenband, auf welchem die genaue Punktionszeit festgehalten werden kann. Dieses wird an der punktierten Extremität fixiert und ermöglicht dem weiterbehandelnden medizinischen Personal genaue Rückschlüsse auf die Verweildauer. Wenn auch selten, können folgende weitere Komplikationen auftreten:
- Luft-, Fett-, Knochenmarksembolie
- Kompartmentsyndrom
- Bei Kindern: Fraktur oder Verletzung der Epiphysenfuge
- Dislokation der Nadel11 12
2.4 Punktionsorte
Die Einsatzmöglichkeit für die Anlage eines i.O Zuganges sind weitreichend. Allerdings gibt es herstellerspezifische Unterschiede für die Punktionsorte. Vidacare als Hersteller des EZ-IO gibt die folgenden Punktionsorte frei:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1 Punktionsorte
Proximale Tibia Distale Tibia Proximaler Humerus Distaler Femur
Das Sternum ist seitens des Herstellers nicht freigegeben und durch die, im Reanimationsfall, resultierenden Komplikationen im Rettungsdienst ohnehin nicht geeignet.
Der Hersteller nennt die proximale Tibia in allen Altersschichten als Punktionsort der 1. Wahl.
Für die Auswahl der passenden EZ-IO-Nadel gibt es Richtwerte, die auf ungefähren Gewichts- und Altersbereichen basieren. Die 15G Nadeln sind in drei Längen erhältlich: 15 mm (für 3-39 kg), 25 mm (ab 40 kg) und 45 mm (ab 40 kg für dicke Gewebeschichten). Dennoch sollte die Auswahl der geeigneten IO-Nadel nach klinischem Ermessen aufgrund der Anatomie und des Gewichts des Patienten sowie der Gewebedicke erfolgen.13
2.5 Durchführung
Die Durchführung der intraossären Punktion mittels EZ-IO wird hier Anhand der Punktion der proximalen Tibia beschrieben. Dieser Punktionsort ist auch im Rahmen der Anleitung geplant. Folgende Arbeitsschritte müssen neben der Funktionskontrolle des benötigten Materials berücksichtig werden:
Identifizieren der Punktionsstelle à Desinfizieren der Punktionsstelle à Vorbereiten des Punktionssystems à Einstechen der geeigneten Punktionskanüle à Bohren bis Widerstandsverlust à Entfernen von Bohrer und Stahlmandrins à Anschluss Verlängerungsschlauch mit Drei-Wege-Hahn à Freispülen des Knochenmarkraums à Kontrollieren der Lage à Sichern der Intraossärkanüle mit EZ-Stabilizer-Pflaster à Anschluss der Druckinfusion
Die Identifikation der Punktionsstelle erfolgt mittels Zeige- und Mittelfinger, 1-2cm medial der Tuberositas tibiae. Ist die Punktionsstelle identifiziert, erfolgt eine gründliche Desinfektion unter Berücksichtigung der Hygienevorgaben. In der Zwischenzeit erfolgt die Vorbereitung des Bohrers und der geeigneten Punktionskanüle. Eine gewichtsadaptierte Wahl der Punktionskanüle ist obligatorisch. Die entsprechenden Richtwerte finden sich auf der Verpackung der Punktionskanüle. Aufgrund von unterschiedlichsten physiologischen und pathophysiologischen Grundlagen eines jeden Patienten, kann es erforderlich sein, eine nicht gewichtsadaptierte Nadel zu verwenden. Insofern kann es beispielsweise vorkommen, dass bei Vorliegen einer Adipositas-Erkrankungen die Gewebsschicht für eine Punktion, mit der vermeidlich passenden Nadel, zu dick ist. Aus diesem Grund werden auf jedem Rettungsmittel immer drei verschiedene Größen vorgehalten, um eine dynamische Anpassung zu ermöglichen. Ist die Wahl der geeigneten Nadel erfolgt, wird die Punktionskanüle durch die Haut gestoßen, bis ein merkbarer Widerstand spürbar ist. Sollten weniger als 5mm des Stahlmandrins zu sehen sein, muss auf die nächst größere Punktionskanüle ausgewichen werden.
Die obere 5mm Markierung ist durch einen schwarzen Strich auf dem Stahlmandrin erkennbar. Ist die Markierung sichtbar, kann mit der Bohrung senkrecht zur Punktionstelle begonnen werden. Diese erfolgt mit einem konstanten, schwachen Druck, bis ein plötzlichen Widerstandsverlust zu spüren ist oder die Kanüle bis auf Hautniveau eingebohrt ist. Ein erneutes Betätigen des Bohrers sollte unbedingt unterlassen werden, da dies zu Riss- oder Quetschverletzungen der Haut um die Punktionstelle führen kann. Es erfolgt die Entfernung von Bohrer und Stahlmandrin, sowie der Anschluss eines entlüfteten Verlängerungsschlauches mit einem Drei-Wege-Hahn. Um den Knochenmarksraum zu spülen, müssen 5-10ml NaCL unter Druck appliziert werden. Auf diese Weise lässt sich zum einem die korrekte Lage überprüfen, als auch die spätere Durchflussrate von Flüssigkeiten erhöhen. Wenn keinerlei Anzeichen auf eine Fehlpunktion vorliegen (Schwellung, Paravasat), kann die Kanüle mittels eins EZ-Stabilizer-Pflasters gesichert werden. Bei Patienten mit starkem Haarwuchs kann eine Entfernung der Beinhaare um die Punktionstelle erforderlich sein, um einen sicheren Halt des Pflasters zu ermöglichen. Nach Anschluss der Druckinfusion ist die Vorbereitung abgeschlossen und das System einsetzbar.14 15 16
3. Praktischer Teil / Bedingungsanalyse
Die Bedingungsanalyse ist als Teil der Vorbereitung zu verstehen. Sie zielt darauf ab, die Anleitung an die örtlichen Gegebenheiten, als auch auf Schüler und Praxisanleiter anzupassen. Die Analyse unterteilt sich in mehrere Kategorien, welche wichtig für die geplante Anleitung sind. Es ist bedeutsam, dass darauf geachtet wird, welche Voraussetzungen der Praxisanleiter als auch der Schüler mitbringen. Anhand der ermittelten Erkenntnisse aus Lehr- und Lernvoraussetzungen kann die Anleitung geplant werden. Zusätzlich müssen Vorbereitungen bezüglich der Lernumgebung getroffen werden. Hierbei kann eine Umfeldanalyse helfen, das Lernszenario vorab zu planen und so eine reibungslose Anleitungssituation zu schaffen, welche in dafür geeigneten Räumlichkeiten stattfinden. Ebenfalls ist es wichtig, einen geeigneten Patienten oder alternativ einen Mitarbeiter, welcher die Rolle des Patienten übernimmt, zur Anleitungssituation auszuwählen. Sollte es sich um einen realen Patienten handeln, ist der Allgemeinzustand, Orientierung, Diagnosen, situativer Zustand und vor allem das Einverständnis vorab zu ermitteln. Bei der hier beschriebenen Anleitungssituation handelt es sich um die Anlage eines intraossären Zuganges an einem Knochenmodell, daher findet im Rahmen der geplanten Anleitung kein Patientenkontakt statt.
3.1 Umfeldanalyse
Die Anleitung findet auf einer Rettungswache mit zwei Rettungswagen und zwei Krankenwagen statt. Im Regelbetrieb sind acht bis zwölf Mitarbeiter gleichzeitig im Betrieb. Das Team unterstützt den Praxisanleiter in seiner Aufgabe. Die Mitarbeiter sind im Bedarfsfall dazu geneigt, unterstützend in einer Anleitungssituation mitzuwirken. Der Praxisanleiter versucht stets, die Bedeutsamkeit einer guten Ausbildungssituation, dem Schüler und ebenso den Mitarbeitern bewusst zu machen. Dies geschieht beispielsweise durch das Aufzeigen von Fehlern und Negativbeispielen, um die große Bedeutung der Ausbildung zu veranschaulichen. Die Freistellungen für den Praxisanleiter sind geregelt, sofern es der Urlaubs- und Krankheitstand zulässt. Die Freistellungen ermöglichen dem Praxisanleiter eine vollumfängliche Betreuung der Schüler. In den „PAL-Diensten“ ist Zeit für Anleitungen, Benotungen und Gespräche, wodurch besser auf individuelle Wünsche der einzelnen Schüler eingegangen werden kann.
Auf der Rettungswache besteht sowohl für den Praxisanleiter als auch für die Schüler die Möglichkeit sich im Bereich des Fachwissens weiterzubilden, indem eine kleine Bibliothek und einen PC inklusive Internetzugang zu Verfügung gestellt sind. Über den PC besteht die Möglichkeit, Onlinefortbildungen über das in der Firma zur Verfügung gestellte Fortbildungsportal „Smedex“ zu absolvieren. Dort kann der Schüler aus einer Vielzahl an Themenbereichen individuelle Lerndefizite aufarbeiten oder für ihn neue Themenbereiche erarbeiten.
Für die Anleitung wird als Örtlichkeit der Besprechungsraum gewählt, dieser ist am Tag der Anleitung reserviert. Der Raum ist groß und hell, verfügt über ausreichend Heizkörper und Fenster, um ein optimales Klima für die Anleitung zu etablieren. Als weiterer Vorteil stellt sich seine räumliche Trennung von der Rettungswache dar. Die Anleitung findet somit in einem ruhigen Rahmen statt, wodurch sich der Schüler noch besser auf seine Anleitung konzentrieren kann. Es befinden sich genug Tische und Stühle im Raum, um diese sowohl für die Anleitung zu nutzen als auch für das anschließende Beurteilungsgespräch. Bei Bedarf besteht außerdem die Möglichkeit, über einen Beamer Fotos oder Videos einzublenden. Hierfür hat der Praxisanleiter vorab eine kleine Präsentation auf seinem Laptop erstellt. Außerdem hat er ausreichend Demonstrationsmaterial organisiert, in diesem Fall ein EZ-IO Bohrer, verschiedene Punktionsnadeln, EZ-Stabilizer-Pflaster, Desinfektionsmittel, ein Dreiwegehahn, und ein EZ-Connect -Anschlussschlauch. Des Weiteren steht Fachliteratur des Herstellers und das Buch „Notfalltechniken Schritt für Schritt“ von Michael Bernhard bereit. Eine Infografik mit möglichen Punktionsorten für den EZ-IO Bohrer vom Hersteller Vidacare wurde ebenfalls durch den Praxisanleiter organisiert. Somit besteht für die Anleitungssituation die Möglichkeit, flexibel und dynamisch auf potenziell auftretende Fragen oder Probleme einzugehen, ohne hierfür die Anleitung unterbrechen zu müssen.
[...]
1 (AWMF Online S1-Leitline, 2017)
2 (Bundesminsterium der Justiz und Verbraucherschutz, 2013)
3 (Bernhard & Grässner, 2016)
4 (Vidacare® Corporation, 2013)
5 (AWMF Online S1-Leitline, 2017)
6 (Jürgen Königer, ÄLRD Landshut, 2014)
7 (Bernhard & Grässner, 2016)
8 (AWMF Online S1-Leitline, 2017)
9 (AWMF Online S1-Leitline, 2017)
10 (Bernhard & Grässner, 2016)
11 (Bernhard & Grässner, 2016)
12 (AWMF Online S1-Leitline, 2017)
13 (Vidacare® Corporation, 2013)
14 (Bernhard & Grässner, 2016)
15 (AWMF Online S1-Leitline, 2017)
16 (Vidacare® Corporation, 2013)