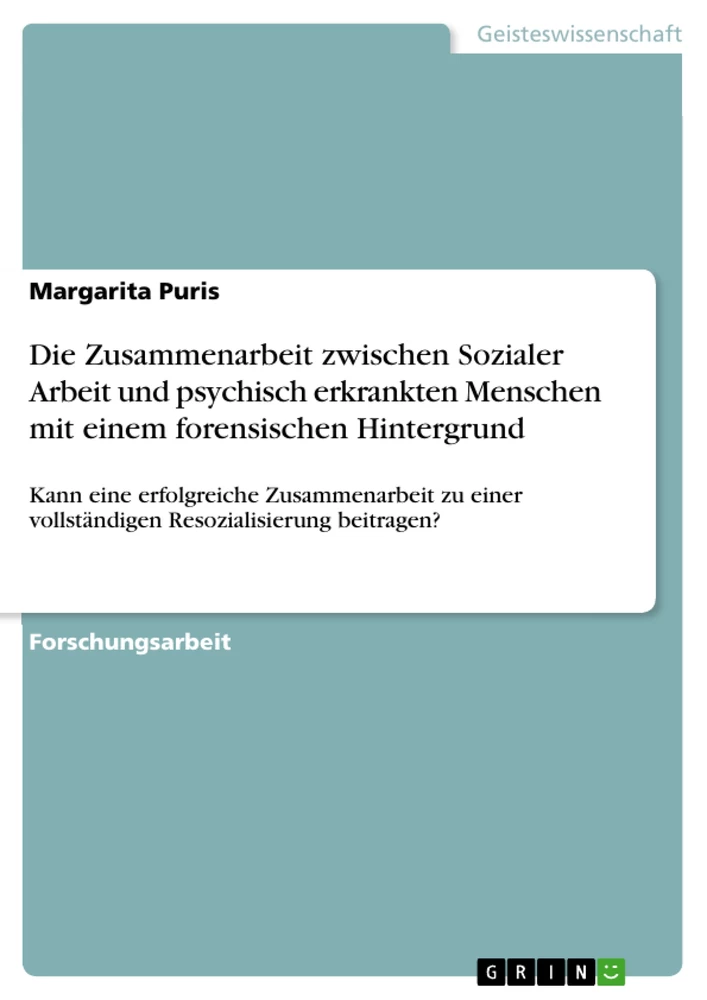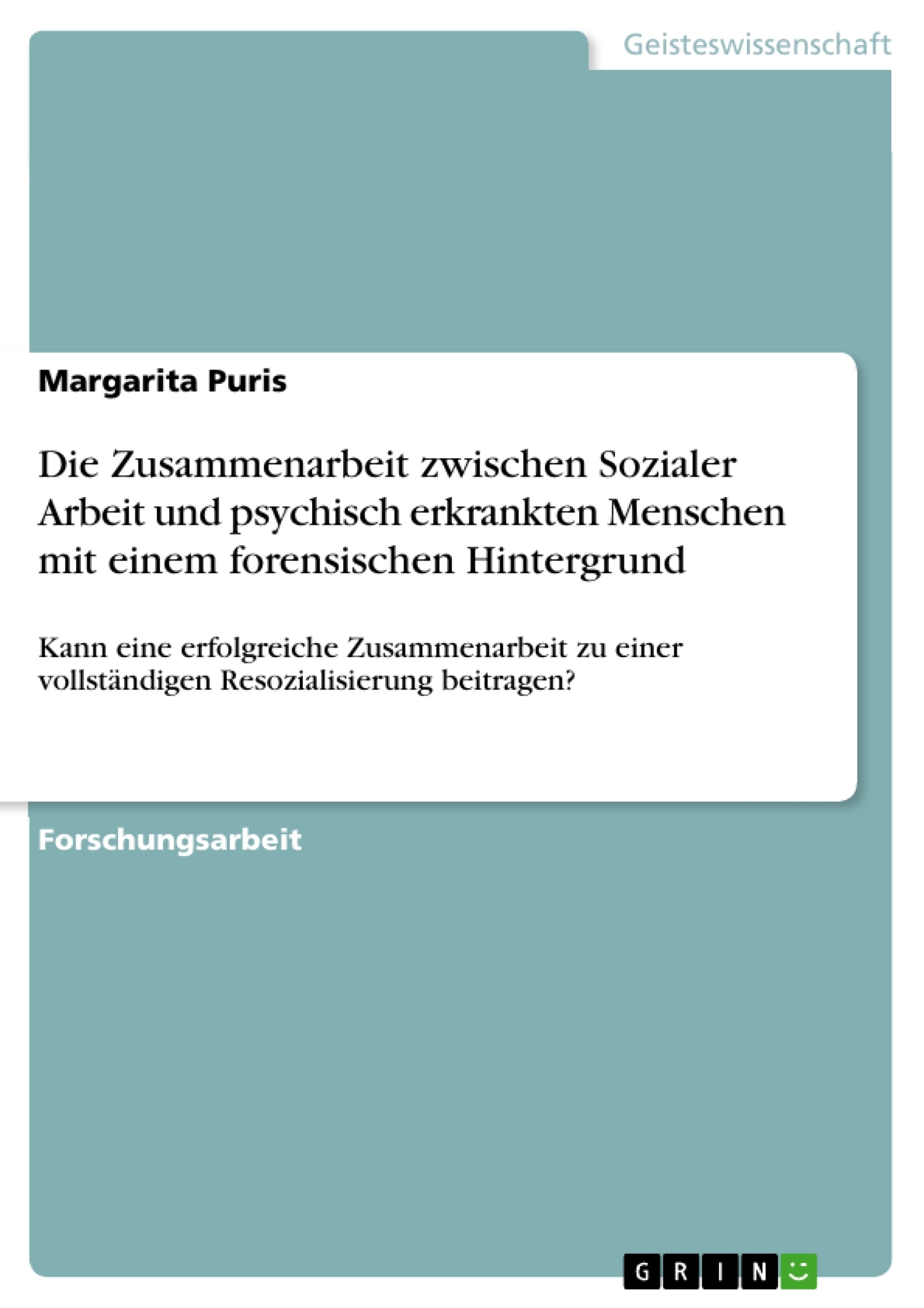Der Fokus dieser Arbeit liegt auf den Voraussetzungen für eine gelungene Zusammenarbeit zwischen den Professionellen der Sozialen Arbeit und psychisch erkrankten Menschen mit einem forensischen Hintergrund in den Hilfen zum Wohnen. Dabei soll untersucht werden, ob eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu einer vollständigen Resozialisierung beitragen kann.
In Deutschland wird nach § 63 StGB eine Unterbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus dann angeordnet, wenn eine Person im Zustand der Schuldunfähigkeit oder verminderten Schuldfähigkeit eine rechtswidrige Tat begangen hat. Zusätzlich muss die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat ergeben, dass von ihm infolge seines Zustandes in Zukunft erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind und er aus diesem Grund für die Allgemeinheit eine Gefahr darstellt.
Mit dem Eintritt der Entlassung ist die Mehrheit der Betroffenen auf erneute Unterstützung angewiesen. Sobald eine mögliche Entlassung seitens des behandelnden Teams in Erwägung gezogen wird, meldet dieses den Betroffenen bei der forensischen Ambulanz. Durch den ersten Kontakt zum psychisch erkrankten Delinquenten, können sich die professionell Tätigen der forensischen Ambulanz ein Bild über die Gesamtsituation und Aussichten des Betroffenen verschaffen. Anschließend wird ein Wiedereingliederungsplan durch die forensische Ambulanz erstellt, gefolgt von Vorschlägen und verschiedenen Möglichkeiten einer Überleitung.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Vorstellung der Einrichtung
1.2 Persönliche Motivation
2. Begründung der Fragestellung
3. Theoretischer Hintergrund /Fachlicher Hintergrund
4. Methoden
4.1 Quantitative und Qualitative Sozialforschung
4.2 Die angewandte Forschungsmethode: Das Leitfadeninterview
5. Das Forschungsdesign
5.1 Das Sampling
5.2 Durchführung der Erhebung
5.3 Durchführung der Auswertung
6. Selbstreflexion der Forschungstätigkeit
7. Ergebnisdarstellung
7.1 Kategoriensysteme
7.2 Auswertung und Interpretation der Forschungsergebnisse
8. Fazit
Literaturverzeichnis:
Anhang