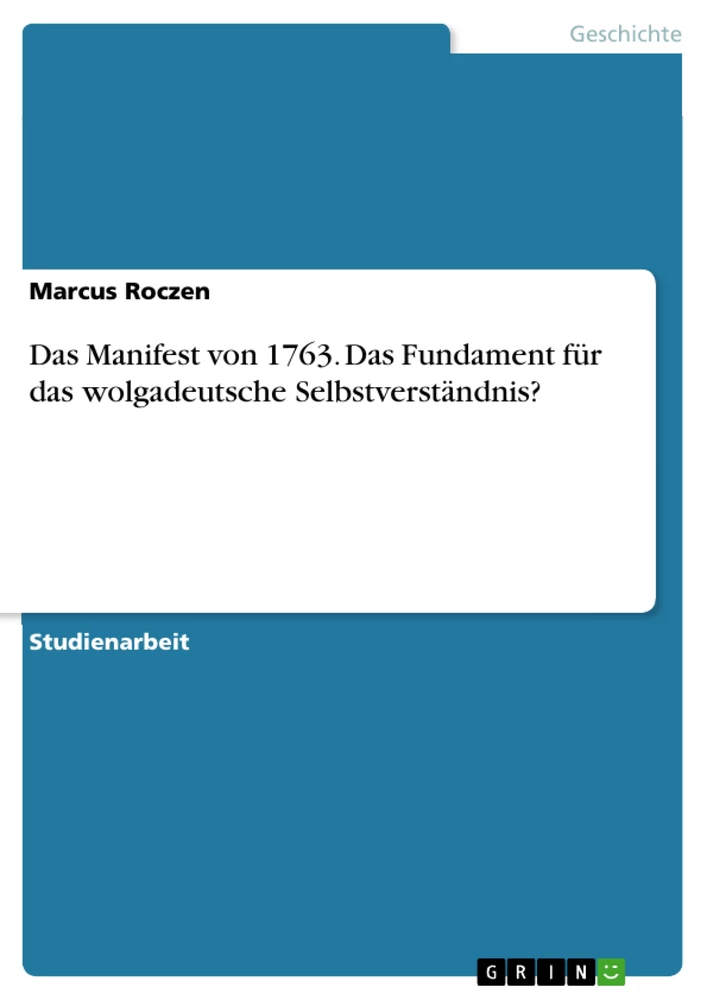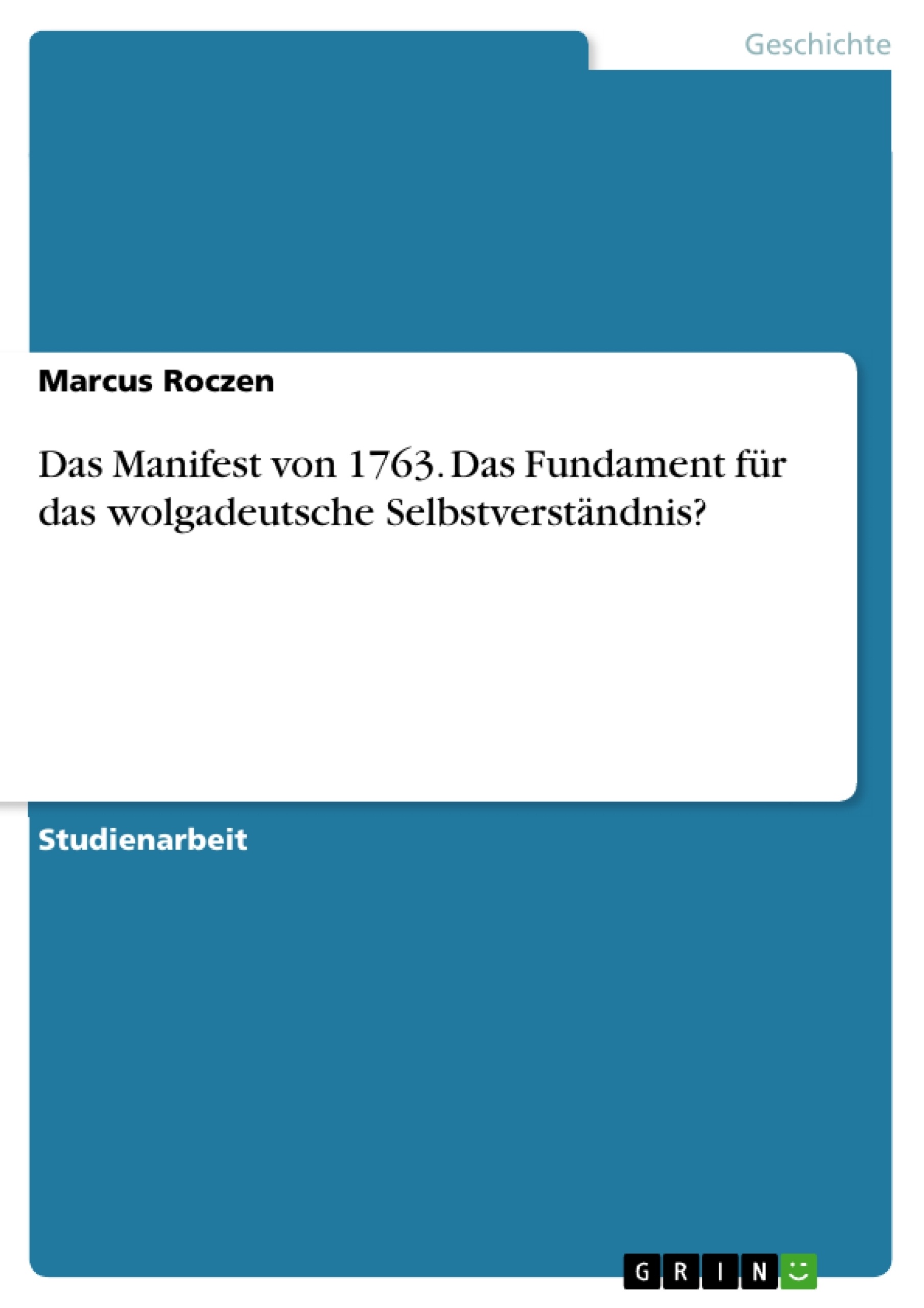Diese Arbeit hat den Anspruch das Manifest zur Einwanderung von 1763 und ausgewählte zugehörige schriftliche Ergänzungen inhaltlich auf die Anforderungen zur Integration oder Assimilation zu untersuchen. Dabei geht der Autor von der These aus, dass dieser Erlass inhaltlich die Grundlage für eine wolgadeutsche Identität bildete und für viele Jahre eine tiefgreifende kulturelle Angleichung an die russische Mehrheitsgesellschaft verhinderte.
Für die präzise Bearbeitung der Fragestellung ist es methodisch unumgänglich den Untersuchungsbereich zeitlich auf die Jahre 1763 bis 1793 und räumlich auf den Siedlungsbereich der Wolgadeutschen zu begrenzen. Zunächst werden dem Leser die Hintergründe zum Manifest von 1763 erläutert, um anschließend den Begriff der Identitätsbildung zu bestimmten und inhaltliche Passagen auf deren Einfluss zur Bildung einer wolgadeutschen Selbstwahrnehmung zu analysieren. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für das abschließende Fazit.
Bereits kurz nach dem Beginn ihrer Herrschaft rief die deutschstämmige Zarin Katharina II. Migranten aus deutschen Landen nach Russland. Der entsprechende Ukas von 1762/63 gab dazu den formalen Rahmen vor.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Einwanderungsmanifest von 1763
3. Wolgadeutsche Identitätsbildung
3.1. Begrenzung des Siedlungsgebiets
3.2. Ökonomische Privilegien
3.3. Weitreichende Religionsfreiheit
3.4. Teilautonomie der Verwaltung
3.5. Sprachbarrieren
4. Zusammenfassung und Fazit
Literaturverzeichnis