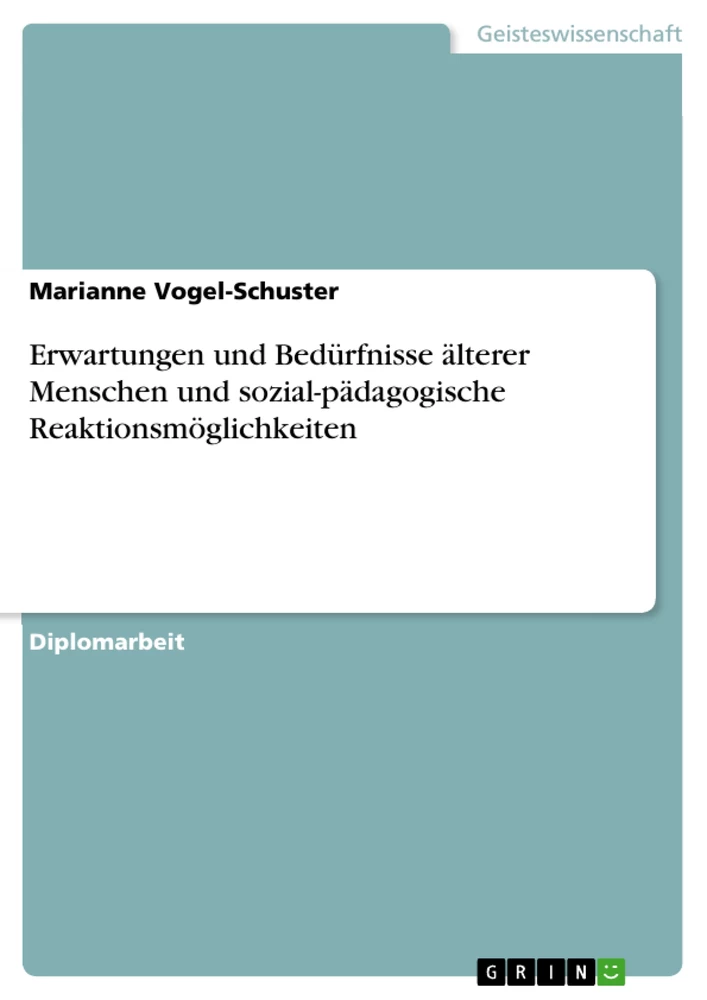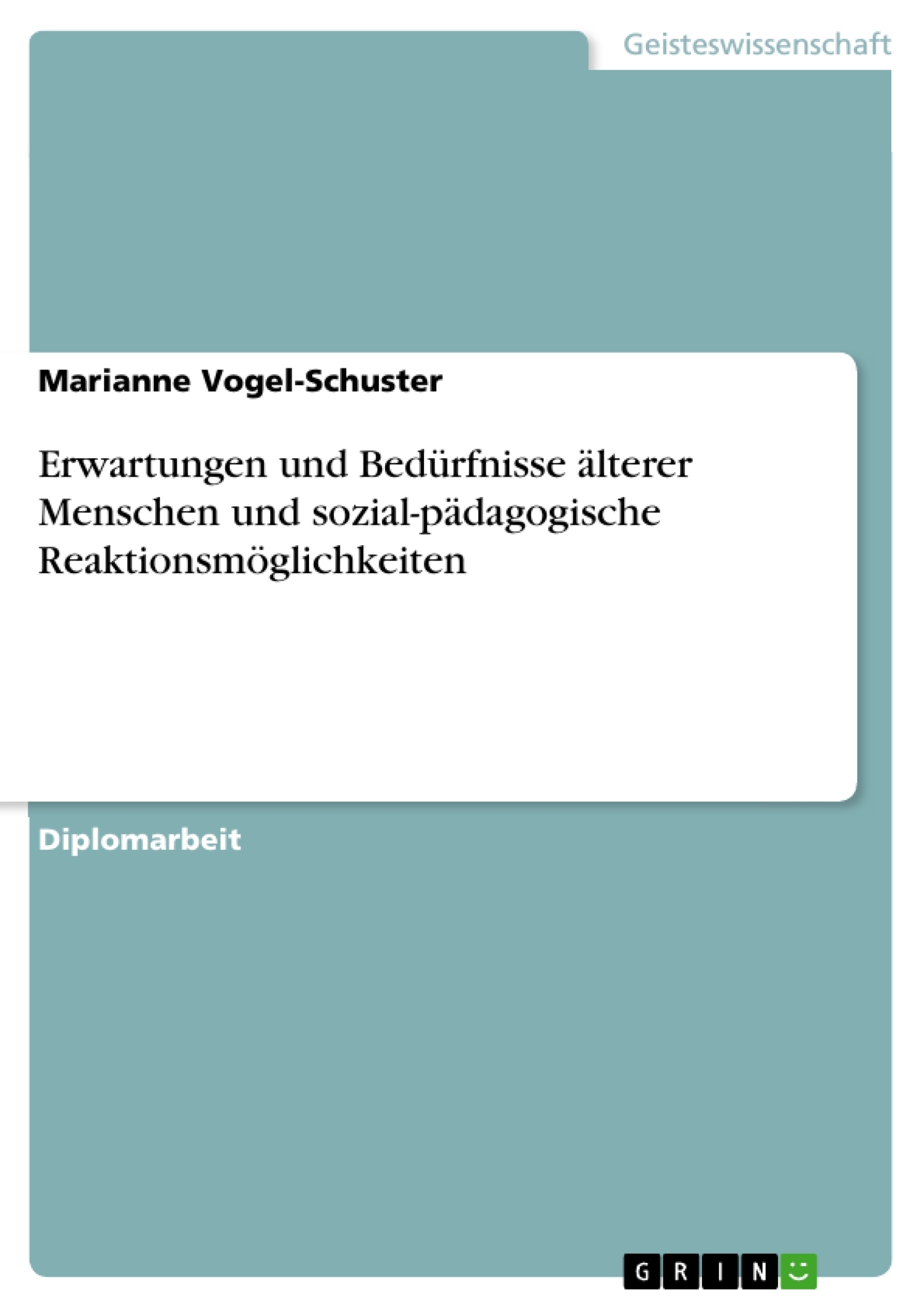Ältere Menschen werden in Zukunft den größten Teil der Gesamtgesellschaft in Deutschland ausmachen. Demographische Veränderungen und der dadurch bedingte Strukturwandel des Alters sind eine der Ursachen dafür.
Was macht es so interessant und bewegt einem, sich mit älteren Menschen und ihren Bedürfnissen zu befassen?
Anlass war u.a. meine Tätigkeit bei den „Mobilen Sozialen Diensten“. Dort bekam ich Einblick in die praktische Arbeit mit älteren Menschen und der Vielfalt ihrer Bedürfnisse. Aktive ältere Menschen die wenig Unterstützung brauchten und ältere Menschen mit großer Hilflosigkeit zählten zum Klientel. Und immer standen Bedürfnisse dahinter, denen man bestmöglichst entgegenkommen wollte.
Auf welche Theorien sich die Bedürfnisdiskussion stützt und das Alter(n) wird im Laufe dieser Arbeit dargestellt.
Auch heute begegnen wir älteren Menschen einerseits in ihrer kulturellen Entfaltung, andererseits in ihrer sozialen Isolation, ihrer Wohlsituiertheit oder einem Leben am Existenzminimum, mit einem großen beruflichen Fachwissen oder einer Frühberentung (die aber auch eine Chance bedeuten kann). Man sieht die Buntheit und Alltäglichkeit des Alters, aber auch, dass die älteren Menschen leider vieles mit dem „Randgruppendasein“ gemeinsam haben. Die Einschränkung ihrer Anteilnahme am Leben der Gesellschaft, ihre räumliche und psychologische Isolation, zudem scheint ihre Situation durch negative Vorurteile bestimmt.
Hölderlin gibt uns in seinem Gedicht der „Trost“ wichtige Hinweise, die dem Alternden Gesundheit, Stabilität und Zufriedenheit verleihen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Alter
2.1 Begriffsbestimmung des Alters
2.1.1 Das kalendarische Alter
2.1.2 Das biologische Alter
2.1.3 Das psychologische Alter
2.1.4 Das soziale Alter
2.1.5 Exkurs – das Altern
2.2 Alter in seiner Historie und wissenschaftlicher Entwicklung
2.2.1 Vorwissenschaftliche Äußerungen zu Altersprozessen
2.2.2 Die Frühperiode wissenschaftlicher Erforschung von Altersprozessen
2.2.3 Die systematische Altersforschung
2.3 Demographische Angaben
2.3.1 Demographische Veränderungen – Strukturwandel
des Alters
2.4 Die Wissenschaft vom Alter
2.4.1 Die Gerontologie
2.4.2 Die Gerontagogik
2.5 Alterstheorien- und Modelle
2.5.1 Theorien erfolgreichen Alterns
2.5.2 Aktivität oder Rückzug
2.5.2.1 Das Defizit-Modell der kognitiven Entwicklung
2.5.2.2 Die Disengagementtheorie
2.5.2.3 Die Aktivitätstheorie
2.6 Neuere Erklärungsansätze für den Prozess des Alterns
2.6.1 Die Kontinuitätstheorie
2.6.2 Das Kompetenzmodell
2.6.3 Erfolgreiches Altern
2.6.4 Die kognitive Theorie der Anpassung an das Alter
2.7 Zusammenfassend
3. Bedürfnisse – theoretische Fundierungen
3.1 Begriffsaspekte
3.2 Der Bedürfnisbegriff in seiner Historie
3.3 Der Bedürfnisbegriff aus dem Blickwinkel verschiedener Wissenschaften
3.3.1 Die philosophische Sichtweise
3.3.2 Die psychologische Sichtweise
3.3.3 Die anthropologische Sichtweise
3.3.4 Die soziologische Sichtweise
3.4 Konsequenzen nicht befriedigter Bedürfnisse
3.5 Zusammenfassend
3.6 Zur Empirie von Bedürfnissen
3.7 Bedürfnisse und ihre Bedeutung für die Pädagogik
4. Bedürfnisse und Erwartungen älterer Menschen
5. Das Interview als Instrument der Empirie
6. Das Interview und darin genannte Bedürfnisse
6.1 Das Interview
6.2 Auswertung des Interviews
7. Altenhilfe und Altenarbeit
7.1 Aufgabenstellung sozialer Altenhilfe
7.2 Das Berufsbild von Sozial-PädagogInnen in der Altenhilfe
8. Die Methoden der Sozialpädagogik und Sozialarbeit
8.1 Exkurs: Stationen der Methodendiskussion
9. Sozial-pädagogische Reaktionsmöglichkeiten auf die Bedürfnisse
und Erwartungen älterer Menschen
9.1 Gemeinwesenarbeit als Reaktionsmöglichkeit
9.1.1 Entwicklung und Etablierung als Methode der sozialen
Arbeit
9.1.2 Theorieansätze der Gemeinwesenarbeit
9.1.3 Gemeinwesenarbeit innerhalb der Altenhilfe
9.2 Gruppenarbeit als Reaktionsmöglichkeit
9.2.1 Die Arbeit mit Gruppen älterer Menschen
9.3 Case-Management als Reaktionsmöglichkeit
9.3.1 Theorie des Case-Managements
9.3.2 Entwicklung des Case-Managements
9.3.3 Case-Management und seine Anwendung in der
Altenhilfe
9.3.4 Verschiedene Einsatzmöglichkeiten des Case-
Managements
9.3.5 Zur fachlichen Kompetenz der Case-ManagerInnen
9.3.5.1 Exkurs: Das Assessment
9.4 Beratung als Reaktionsmöglichkeit
9.4.1 Die professionelle Beratung bei älteren Menschen
9.4.2 Erwartungen des Klienten oder älteren Menschen
9.5 Biographiearbeit als Reaktionsmöglichkeit
9.5.1 Praxisorientierte Biographiearbeit
9.5.2 Biographiearbeit in der Altenhilfe
9.6 Die Rehabilitation als Reaktionsmöglichkeit
9.6.1 Der Sozialpädagoge in der Rehabilitation
9.7 Vorbereitung auf das Alter und den Ruhestand als Reaktionsmöglichkeit
9.7.1 Drei Formen der Vorbereitung auf das Alter
10. Schlussbemerkung
11. Das transkribierte Interview
Literaturverzeichnis
„Getrost! Es ist der Tränen wert dies Leben
So lang uns Pilgern die Sonne Gottes scheint,
und Bilder beßrer Zeit in unsere Seelen schweben.
Und ach! mit uns ein fremdes Auge weint.“
(Hölderlin)
1. Einleitung
Ältere Menschen werden in Zukunft den größten Teil der Gesamtgesellschaft in Deutschland ausmachen
Demographische Veränderungen und der dadurch bedingte Strukturwandel des Alters sind eine der Ursachen dafür
Was macht es so interessant und bewegt einem, sich mit älteren Menschen und ihren Bedürfnissen zu befassen?
Anlass war u.a. meine Tätigkeit bei den „Mobilen Sozialen Diensten“. Dort bekam ich Einblick in die praktische Arbeit mit älteren Menschen und der Vielfalt ihrer Bedürfnisse. Aktive ältere Menschen die wenig Unterstützung brauchten und ältere Menschen mit großer Hilflosigkeit zählten zum Klientel. Und immer standen Bedürfnisse dahinter, denen man bestmöglichst entgegenkommen wollte
Auf welche Theorien sich die Bedürfnisdiskussion stützt und das Alter(n) wird im Laufe dieser Arbeit dargestellt
Auch heute begegnen wir älteren Menschen einerseits in ihrer kulturellen Entfaltung, andererseits in ihrer sozialen Isolation, ihrer Wohlsituiertheit oder einem Leben am Existenzminimum, mit einem großen beruflichen Fachwissen oder einer Frühberentung (die aber auch eine Chance bedeuten kann)
Man sieht die Buntheit und Alltäglichkeit des Alters, aber auch, dass die älteren Menschen leider vieles mit dem „Randgruppendasein“ gemeinsam haben. Die Einschränkung ihrer Anteilnahme am Leben der Gesellschaft, ihre räumliche und psychologische Isolation, zudem scheint ihre Situation durch negative Vorurteile bestimmt
Hölderlin gibt uns in seinem Gedicht der „Trost“ wichtige Hinweise, die dem Alternden Gesundheit, Stabilität und Zufriedenheit verleihen
Er schreibt in seinem Gedicht von den religiösen Bindungen, von den Erinnerungen, die eine positive Kontinuität garantieren und schließlich von der sozialen Geborgenheit
Hinter Hölderlins Ausführungen verbirgt sich mehr, es sind Hinweise auf die Bedürfnisse älterer Menschen und damit verbundene Erwartungen
Deshalb stellt sich die Frage: Was sind die Bedürfnisse älterer Menschen und ihre damit verbundenen Erwartungen und wenn Bedarf, mit welchen sozial- pädagogischen Möglichkeiten kann reagiert werden?
Unter dem Aspekt der Selbstbestimmung und Selbstverantwortung, zugleich sozialer Eingebundenheit und gesellschaftlicher Teilhabe des älteren Menschen
Diese Bedürfnisse gilt es immer wieder zu erhellen, da Bedürfnisse die Planungen für eine sozial-pädagogischen Reaktion beeinflussen
Vorab müssen die Begrifflichkeiten geklärt werden
Was ist „alt“, „älter“, „Alter“, oder „Altern“ (siehe Kap. 2.1.) und auf welche Theorien stützt sich das Alter (siehe Kap. 2.5.)
Eine Annäherung an den Bedürfnisbegriff geschieht aus dem Blickwinkel verschiedener Wissenschaften (siehe Kap. 3.3.)
Um die Bedürfnisse zu erheben wird das Interview als Instrument der Empirie gewählt (siehe Kap. 5). Folglich werden sozial-pädagogische Reaktionsmöglichkeiten beschrieben die auf die Bedürfnisse und Erwartungen älterer Menschen reagieren, in Form eines Case-Managements, Gruppenarbeit, Biographiearbeit, Beratung u.a. (siehe Kap. 9)
Die Reaktionsmöglichkeiten werden einzeln beschrieben, d.h. jedoch nicht dass sie in keinem Zusammenhang stehen. Sie sind teilweise Bestandteile der Methoden und sollen als Vernetzung und Koordination in der sozial-pädagogischen Altenhilfe verstanden werden
Diese Arbeit soll einen Überblick über mögliche sozial-pädagogische Reaktionsmöglichkeiten auf Bedürfnisse und Erwartungen älterer Menschen geben und einen Denkanstoß was wir gesamtgesellschaftlich gesehen, dazu beitragen können
2. Das Alter
2.1 Begriffsbestimmung des Alters
Die Frage wer alt ist wird oft mit der Redeweise beantwortet: „Man ist so alt wie man sich fühlt.“ Somit wäre die Frage nach dem Alter eine Sache des individuellen Standpunktes. Die Wissenschaft sucht aber nach anderen Antworten und nennt unterschiedliche Begriffe
Bezüglich des Altersbegriffs ist nach KLINGENBERGER keine eindeutige Definition nachzuweisen. Dabei berücksichtigt er zweierlei Verwendung. Zum einen bezeichnet „Alter“ den individuellen Stand (meist zählbar) eines Menschen im Lebenslauf
Alter wird hier neutral verwendet im Sinne von Lebensalter, zum anderen bezeichnet „Alter“ eine bestimmte Phase des Lebenslaufes, im gängigen Zählen die „vierte nach Kindheit, Jugend und frühem/mittleren Erwachsenenalter“ (zit. i. Klingenberger1992, S. 30). Alter hier benutzt im Sinne von „höherem Erwachsenenalter.“ Um „Alter“ im Sinne von höherem Erwachsenenalter festzulegen, können verschiedene Ansatzpunkte herangezogen werden
2.1.1 Das kalendarische Alter
Nach dem kalendarischen Alter, ist nach NARR alt „wer eine bestimmte Zahl von Jahren gelebt hat“ (zit. i. Narr 1976, S.13). Nach v. SCHEIDT (1995) ist diese Definition unzureichend. Er verdeutlicht es daran, dass sich die Lebenserwartungen der Menschen beständig verändern. Insbesondere in den letzten 80 Jahren ist die Lebenserwartung bei der Geburt in Deutschland um fast 30 Jahre gestiegen (von etwa 45 auf 75 Jahre). Damit ändert sich natürlich auch das kalendarische Maß für das Alter beständig
Auch zeigt die gegenwärtige Situation auf der Erde große Unterschiede hinsichtlich des durchschnittlichen Lebensalters je nach Rasse, Kontinent, Geschlecht u.Ä. Weder körperliche, noch psychische oder soziale Veränderungen sind also an die reine Anzahl von Jahren gebunden, sondern immer von zusätzlichen Faktoren abhängig, etwa von der Lebensweise, der Gestaltung der Lebensbedingungen etc
Genau diese Lebensbedingungen führen in Deutschland dazu, dass das kalendarische Alter als Kriterium untauglich geworden ist. Denn trotz einiger Gemeinsamkeiten wie Lebenserwartung, gesetzliche Altersgrenze, Rentensystem, sind die Unterschiede in der Lebensweise und den Lebensmöglichkeiten bei älteren Menschen ungeheuer groß. Hier pauschal eine Altersgrenze zu benutzen, wird diesen Unterschieden nicht gerecht. Auch nach Klingenberger hat diese Form des Alters „so gut wie keine Aussagekraft“ (vgl. i. Klingenberger 1996, S. 30)
2.1.2 Das biologische Alter
Biologisch alt ist „wer sich durch bestimmte psychische und/oder physische Veränderungen von ‚Nichtalten‘ unterscheidet“ (zit. i. Narr 1976, S. 13)
SCHEIDT ergänzt und schreibt, dass nach heutiger Sichtweise durch biologische Alterungsprozesse, sich im Laufe des Lebens die Vitalität des Organismus ändert. Diese wird verstanden als Gesamtheit seiner funktionellen Fähigkeiten[1]. Offensichtlich wird der biologische Alterungsprozess bereits beim äußeren Erscheinungsbild sichtbar, weniger sichtbar ist der innere Abbauprozess. Unbestritten ist, das im Zeitraum zwischen Geburt und Tod biologische Veränderungen des menschlichen Körpers stattfinden. Zumeist haben sie irreversiblen Charakter und können somit den Eintritt ins Alter näher bestimmen
2.1.3 Das psychologische Alter
Hiermit ist das je individuelle eigene Altersgefühl und persönliche Altersinterpretation ausgesprochen, wie sie sich in der Redewendung „Jeder ist so alt wie er sich fühlt“ darstellt. Bereits dieses Sprichwort macht auf einen bedeutsamen Sachverhalt aufmerksam: Gleiche und ähnliche Situationen können bei verschiedenen Personen zu unterschiedlichen Beurteilungen und damit zu diversen Erlebnisformen und Verhaltensweisen führen
2.1.4 Das soziale Alter
Altern ist ein sozialer Prozess, denn das Leben eines Menschen ist „durch und durch von sozial entstandenen Festschreibungen geprägt, was in welchem Alter möglich oder unmöglich ist“ (vgl. v. Scheidt 1996, S. 28)
Solche Festschreibungen sind etwa das Einschulungsalter, die Volljährigkeit u.Ä
Im sozialen Feld wird Alter (in Verbindung mit verschiedenen Rollenerwartungen und -zuschreibungen) mit Hilfe eines bestimmten Zeitpunktes des kalendarischen Alters festgelegt
In der BRD handelt es sich zumeist um das Renteneintrittsalter
Solche Festschreibungen sind jedoch nicht ganz unproblematisch, z.B. wird die Pensionierungsgrenze von 65 Jahren so verstanden, als wäre sie von Natur aus eine Altersgrenze, ab welcher nicht mehr gearbeitet werden kann. Dies ist weder historisch noch derzeit richtig. Denn die Altersgrenze ab 65 Jahren wurde im Hinblick auf die Rentenfinanzierung und den Arbeitsmarkt eingeführt. Somit ist sie weder eine natürliche Grenze für den Ruhestand, noch eine sinnvolle und gerechtfertigte Maßnahme, sondern eine politische Entscheidung
Zu erwähnen wäre noch, dass bei der Betrachtung des „sozialen Schicksals Alter“ für den Pädagogen auch besonders das „Bildungsschicksal Alter“ von Interesse ist. Denn die in der Biographie erworbenen pädagogische Erfahrungen sowie die im Alter bestehende Haltung gegenüber pädagogischen Angeboten konstituieren das Erleben von Zufriedenheit und Wohlbefinden im Alter (vgl. i. Klingenberger 1992, S. 31)
Besondere Berücksichtigung bei der Bestimmung des Altersbegriffs ist die Tatsache, dass es sich um eine Lebensphase handelt die eingespannt ist zwischen unterschiedlichsten Erfahrungen und Ereignisse der jeweiligen Biographie und deren prägender Wirkung einerseits und dem Bewusstwerden der eigenen Existenz andererseits
Das Alter bzw. die alten Menschen bilden das bewahrende Element einer Gesellschaft, was nicht heißen soll, dass sie passiv, lebensmüde oder resigniert sind. Sie vermitteln überkommende Werte und Normen und stellen diese zumindest in Diskussion oder bringen sie in Erinnerung. Alte Menschen können Werte und Tatsachen ins Bewusstsein rücken, die in unserer modernen und industrialisierten Gesellschaft in den Hintergrund gedrängt worden sind
Alte Menschen werden somit zum Störfall in doppeltem Sinne: zum einen als Ärgernis in unserer Leistungsgesellschaft, zum anderen sind sie Erinnerung an vergessene Werte und Sachverhalte in einer rationalisierten Welt
Hier könnten Funktion und Sinn (aus gesellschaftlich-kultureller Sicht) dieser Lebensphase liegen. Hier besteht nach KLINGENBERGER „ein deutliches pädagogisches Potential in den älteren Generationen[2] (vgl. Klingenberger 1992, S. 34)
So scheinen die Versuche zahllos, „Alter“ zu definieren. Zu einer anerkannten, allgemeinen Einigung führte keine dieser Annäherungen, es scheint nur in einem Punkt Übereinkunft zu bestehen. Kaum jemand betrachtet sich selbst als alt. Alt sind die anderen
Aber wo es nicht das „Alter“ und die „Alten“ gibt, wird der Begriff „alt“ zum Etikett und birgt die Gefahr, das Alter negativ zu sehen, als Sonderfall des Lebens und eine Ausgrenzung zu legitimieren. Aber Alter stellt keinen klar abgrenzbaren Lebensabschnitt dar. Mit zunehmendem Alter nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, von mehreren Problemen betroffen zu werden, was dann als alterstypisch etikettiert wird. Alt werden und alt sein lässt sich als dialektische Spannung sehen: von Aktivität und Rückzug, von Autonomie und Abhängigkeit, von Gewinn und Verlusten
2.1.5 Exkurs – das Altern
Nach KLINGENBERG muss der Begriff des „Alterns“ von dem des „Alters“, wegen seiner dynamischen, d.h. veränderbaren und gestaltbaren Charakteristik unterschieden werden. Seine Verwendung ist bezüglich seiner Konnotation als auch wegen seiner Bewertung des damit beschriebenen Prozesses vielfältig. So kann „Altern“ mit ein paar Umschreibungen zu diesem Begriff verstanden werden (vgl. Klingenberger 1992, S. 34)
„Altern“ kann verstanden werden als:
- als ein das ganze Leben umgreifender, mit der Geburt beginnender Vorgang des Älterwerdens, der mit dem Tod
- als eine Funktion des Gleichgewichts zwischen kognitivem und motivationalem System, und somit als Anpassungsprozess, der eingespannt ist in Begrifflichkeiten wie „Verlust“ und „Kompensation“
- als ein vom „Welken“ abzugrenzender Vorgang, da mit dem Altern nicht nur ein Vergehen, sondern auch ein Reifen, ein „Zugewinn“ an seelisch- geistiger Vollreife, an anthropologischem Realismus, an stärkender Identität mit sich selbst, auch an personaler Vollendung, verbunden
- als ein Schicksal des Menschen, das nicht nur von biologischen und organischen Prozessen abhängig ist, sondern das auch soziale, biographische und religiöse Dimensionen
- als das Ergebnis des umfassenden Zusammenspiels unterschiedlicher Faktoren, sei es individueller oder sozialer Art, sei es natürlicher oder kultureller Art, sei es anhaltender oder situativer A
- als Vorgang der intensiveren und zum Teil widerspruchsvollen Wahrnehmung von Zeitlichkeit und Endlichkeit, mit Selbstentfremdung und kultureller Entfremdung, mit Körperlichkeit, begleitet mit der Grundbefindlichkeit der Mühsal und der D
- als ein mit der Geburt einsetzender Prozess psychophysischer Art, der sich in einem sozialen und politischen Feld vollzieht (vgl. i. Klingenberg 1992, ebd.)
Die Problematik des Alterns wird in unserer Gesellschaft weitgehend tabuisiert bzw. von den herrschenden Vorstellungen der Jugendlichkeit (z.B. in den Medien) in den Vordergrund gerückt, was dann auch Auswirkungen auf die Menschen hat die in dieser Gesellschaft leben und altern
SCHEIDT v. definiert Altern folgendermaßen : „... ist ein lebenslanger Veränderungsprozess und nicht ein lebensphasenspezifisches Phänomen“ (zit. i. Sickendiek 1999, S.37)
2.2 Alter in seiner Historie und wissenschaftlicher Entwicklung
Um den heutigen Stellenwert des Alters zu verstehen, muss der Begriff von seiner Entwicklung her, aus seiner Geschichte heraus verstanden werden. Ein kritischer Blick in die Historie wird zu diesem Verständnis beitragen
Zunächst zeigt uns die Geschichte einen sehr wechselhaften Umgang mit dem Alter. Mal war er von Achtung, mal von Missachtung geprägt. Zum anderen ist sowohl die Achtung vor dem Alter als auch dessen konkrete historische Erscheinungsform in jeder Epoche sehr abhängig von zusätzlichen Faktoren, wie der Wirtschafts- und Sozialorganisation der Gesellschaft, ihrem Geschlecht oder Gesundheitszustand
Das Alter gab es folglich damals so wenig wie heute. Seit Jahrtausenden sind die Gesellschaftsstrukturen weltweit durch Ungleichheiten zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, Schichten oder Klassen geprägt. Macht, Reichtum, Entwicklungsmöglichkeiten, gesellschaftliche Anerkennung sind nicht gleich verteilt
Und das Alter ist neben Herkunft, Geschlecht, Religion, Bildung u.a. auch immer als Quelle oder Rechtfertigung von Ungleichheiten benutzt worden. Dies gilt im positiven wie im negativen Sinne, also für Privilegierung, Macht, Status, Achtung einerseits und für Diskriminierung andererseits. Das ist auch in sofern von Bedeutung, als dass die historischen Überlieferungen über die Situation der Älteren immer vor dem Hintergrund dieser Ungleichheiten gesehen werden müssen
Somit nach v. SCHEIDT „... wird verständlich, warum eine historische Betrachtung allgemein gültiger Alterscharakterisierung nicht möglich ist ...“ (zit. i. v. Scheidt 1996, S.18). Man kann nur globale Tendenzen und Unterschiede zwischen den verschiedenen Zeiträumen wiedergeben (vgl. i. v. Scheidt ebd.)
2.2.1 Vorwissenschaftliche Äußerungen zu Altersprozessen
Im alten Testament wird die Würde und die Weisheit des Alters gelobt, sowohl auch die besonderen Fähigkeiten zu höchsten Ämtern, immer wieder hervorgehoben. Auch die alten Griechen schätzten die Weisheit des Alters und bei Homer finden sich Hinweise auf die Fähigkeiten des Alters und die Bereitschaft Jüngerer, sich dem Rat oder Richterspruch der Alten zu beugen
In seiner Politeia nimmt Platon (427-347 v. Chr.) zum Alter Stellung. Platon betont vor allem die individuelle Komponente des Alterns und sieht das Erleben der Altersphase weitgehend durch die Lebensführung in Jugend und Erwachsenenalter bestimmt. So müsse schon die Jugend zu einem rechtschaffenden, auf Pflichterfüllung hin ausgerichtetes Leben angehalten werden um dann ein ruhiges Alter genießen zu können. In dieser Forderung findet die heute weitgehende Feststellung, derzufolge jede Geroprophylaxe bereits in Kindheit und Jugend zu beginnen habe, einen geschichtlichen Beleg
Die negativen Seiten hingegen wurden von Aristoteles (384- 322 v.Chr.) und Seneca (gest. 65 n. Chr.) vertreten, die Alter mit „Abbau“ gleichsetzten
(vgl. Klicpera 1994,S. 13)
In seiner Schrift „De generatione animalium“ vertritt Aristoteles die Auffassung, dass „Krankheit vorzeitig erworbenes Alter, Alter aber eine natürliche Krankheit“ (zit. i. Lehr 2000, S. 7) sei, eine Auffassung der Seneca (gest. 65 n. Chr.) Nachdruck verlieh, indem er das Alter als unheilbare Krankheit, als „senectus insanabilis morbus“ (vgl. i. Lehr 2000, ebd.) bezeichnete.
Cicero (106-43 v. Chr.) meinte, dass die Jugend den Alterungsprozess beeinflusst durch die Art und Weise, in der sie den alten Menschen begegnet: mit Hochachtung, Mitleid oder sogar Verachtung. Seit dieser Zeit haben auch viele Dichter über das Alter philosophiert wie z.B. Shakespeare, Goethe oder Schopenhauer, um nur einige zu nennen. Jedoch ist diesen Einzeläußerungen über das Alter, das vorwiegend als Verlust, manchmal als Gewinn oder als Aufgabe betrachtet wurde kaum eine Allgemeinverbindlichkeit zuzusprechen, es spiegelt weitgehend die persönlichen Erfahrungen des Autors wider
In seiner Schrift „Cato Maior de Senectute“ (vgl. i. Lehr 2000, S. 8) findet sich eine Fülle von Feststellungen über die geistige Leistungsfähigkeit im höheren Alter, beschrieben an Einzelbeispielen aus der römischen und griechischen Geschichte, unter Hinweis auf große staatspolitische, wissenschaftliche und künstlerische Taten von bereits über 80-jährigen. In seiner Schrift über das Greisenalter, das für die Römer mit 61 Jahren begann : „Fähigkeiten, die sich auf die Welt des Geistes beziehen, wachsen bei einsichtsvollen und wohlangelegten Männern gleichmäßig mit dem Lebensalter ... – Denn die Greise sind es, die Verstand und Vernunft und Überlegung besitzen: und hätte es keine solchen gegeben, so hätte es überhaupt keine Staaten gegeben.“ „Nicht die körperliche Kraft, Gewandtheit oder Schnelligkeit wird Großes ausgeführt, sondern mit dem Gedanken, mit geistiger Überlegenheit und geltendmachend der Ansicht, – Eigenschaften, deren das Alter nicht nur nicht beraubt zu werden, sondern die es in noch höherem Maße als zuvor zu gewinnen pflegt ...“ (zit. i. Lehr 2000, S. 8)
Zunahme von Verstand und Vernunft, von Maßhalten und Toleranz, von Urteilsfähigkeit und Einsicht, von menschlicher Würde und Klugheit ist nur dann gegeben, Nichtaufhören, Weitermachen, ständiges Üben in allem – das sei die Maxime!
Er stellt vier Gründe in den Vordergrund die den Alterungsprozess negativ beeinflussen:
1. Die Verwehrung einer ergiebigen Tätigkeit, das Verurteiltsein zur Passivität
2. Die körperliche Schwächung und körperliche Beschwerden
3. Die Beraubung der Vergnügen, der Verzicht oder Ausgeschlossensein von den angenehmen Erfahrungen und Freuden des Lebens
4. Schließlich das Bewusstsein der Todesnähe (vgl. Lehr 2000, ebd.)
Cicero weist außerdem auf die bedeutendste Rolle der Gesellschaft hin, die das Altersleben und damit auch den Alternsprozess bestimmt, wenn er feststellt: „Was gibt es Angenehmeres als ein Greisenalter, das umgeben ist von einer Jugend, die von ihm lernen möchte“! (zit. i. Lehr 2000, ebd.)
Tritt man dem Älteren mit Hochachtung und Verehrung gegenüber und nicht nur mit Gefühlen der Hilfsbereitschaft und des Mitleids oder gar mit Vorurteilen hinsichtlich seiner Verantwortungs- und Leistungsfähigkeit, so beeinflusst man den Alternsprozess selbst in erheblicher Weise . Die Gesellschaft bestimmt die Rolle des alten Menschen und ob das Älterwerden zum Problem wird
2.2.2 Die Frühperiode wissenschaftlicher Erforschung von Altersprozessen
Im 17. Jahrhundert wurde der alte Mensch als Jammergestalt dargestellt, er war der Verachtung seiner Mitmenschen und dem Spott der Kinder ausgesetzt. Die so genannten Großeltern waren eigentlich die Kleinen: „... tapsig, nicht ganz gescheit, kindisch, hilfsbedürftig usw. Alter war Makel, Zerfall, Abbau, Rückbildung, Krankheit, Invalidität, Vorstufe zum Tod, durch Medizin nicht zu lindern“ (zit. i. v. Scheidt 1996, S. 18). Demgegenüber wurde die Jugend verherrlicht mit ihrer Freude am prallen Leben und ihrer Kraft
Dies veränderte sich im späten 17./18. Jahrhundert, wo eine Art Zivilisationsschub einsetzte, der die Menschlichkeit des Menschen in der Versittlichung und Disziplinierung sah. Forderungen nach Achtung des Mitmenschen und damit auch des Alters wurden laut. Damit änderte sich auch die Vorstellung vom Alter, es wurde nicht mehr mit Verfall, Krankheit und Tod gleichgesetzt, sondern mit Bildern von weisen, genügsamen und zufriedenen Menschen, die ihrer Weisheit wegen geschätzt und gelobt wurden und mit Ehrfurcht begegnet (vgl. i. v. Scheidt 1996, ebd.)
Man kann sagen, dass die Frühperiode wissenschaftlicher Erforschung psychischer Alterungsprozesse etwa um 1835 mit Quetelet (1796-1874) einsetzte
Quetelet, 1796 in Genf geboren, forschend auf dem Gebiet der Astronomie, Astrologie, Statistik, Mathematik, Soziologie und Psychologie. Er versuchte unter anderem eine Sterblichkeitsstatistik aufzustellen, und die Daten mit Geschlecht, Alter, Wohngegend und Nationalzugehörigkeit in Zusammenhang zu bringen. Er wandte sich gegen Verallgemeinerungen von Einzeläußerungen, und versuchte einen Zusammenhang zwischen biologischen und sozialen Einflüssen auf den Alterungsprozess zu konstatieren
Galtons (1832-1911) Interesse, er studierte zuerst Medizin in London und Birmingham und kam erst später zur Psychologie, galt den beim Älterwerden auftretenden Veränderungen des Organismus, der Psychomotorik, der Wahrnehmungsprozesse und der höheren geistigen Prozesse. Diese wollte er mittels seiner erstmals entwickelten Konzepte der Korrelationsstatistik mit dem Lebensalter in Zusammenhang bringen
2.2.3 Die systematische Altersforschung
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann die systematische Altersforschung, die gekennzeichnet ist durch die Verwendung, im anglo-amerikanischen Raum, von testpsychologischen Methoden
Hall (1844-1924) eigentlich bekannt durch seine Studien über das frühe Kindesalter, sprach sich gegen eine Rückentwicklung im Alter aus. Er betonte die qualitativen Unterschiede und dass die individuellen Differenzen im Alter höher seien als in der Jugend. Ein Forschungsansatz der immer wieder bestätigt wird
In Kalifornien wurde 1928 das erste Institut zur Erforschung der Probleme des Alters eröffnet. Im Mittelpunkt der Untersuchungen standen die Veränderungen der geistigen Leistungsfähigkeit. Man konnte empirisch nachweisen, dass die intellektuellen Fähigkeiten im Alter nachlassen
In Europa ging die Altersforschung in dieser Zeit weder systematisch noch methodenbewusst vor. Es lagen meistens Arbeiten von psychiatrischer Seite vor, was eine pathologische Sicht des Alters stark förderte
Im deutschsprachigen Raum gab es außer diesen psychiatrischen Ansätzen nur einzelne Ansätze in der gerontologischen Forschung. Nennenswert wäre Charlotte Bühler die versuchte, die gesamte Lebensentwicklung bis zum Ende zu erfassen und die Wandlungen der menschlichen Persönlichkeit im mittleren und höheren Alter
Ab den 40er Jahren kam es regelrecht zu einer Expansionswelle in der Gerontologie. In den USA wurden Altersprobleme vermehrt systematisch untersucht. Durch den zweiten Weltkrieg gerieten die Entwicklungen kurz in den Hintergrund, seit 1946 erscheint jedoch das „Journal of Gerontology“, in der die Wichtigkeit der interdisziplinären Forschung hervorgehoben wird
Obwohl auch in Deutschland seit 1938/39 die „Zeitschrift für Altersforschung“ erhältlich ist, forschte jede Disziplin nach wie vor im Alleingang. Erst 1967 kam es zu einer interdisziplinären Zusammenarbeit, die in der internationalen Entwicklung schon lange praktiziert wurde. Inzwischen fand der 15. Internationale Kongress statt, und die Altersforschung ist so populär wie nie zuvor
So gesehen ist die Existenz des Alters als eigenständige und allgemeingültige Lebensphase eher eine neuere Entwicklung. Bis ans Lebensende zu arbeiten, war bis ins 20. Jahrhundert hinein die einzige Möglichkeit für die Mehrheit der Menschen zu überleben. Ein Mensch wurde als alt bezeichnet, wenn seine körperlichen und geistigen Kräfte aufgrund seiner Nähe zum Tod schwanden
Alter war gleichgesetzt mit Invalidität
2.3 Demographische Angaben
Im deutschen Raum schwankte in der Zeit von „1600 bis 1900 der Anteil der über 60-jährigen an der Gesamtbevölkerung zwischen 7% und 10%
Im Jahr 1990 im wieder vereinten Deutschland 20,3% und im Jahr 2030, so Prognosen wird er nach Prognosen auf ca. ein Drittel ansteigen“ (vgl. i. Otto/ Thiersch 2001, S. 31)
Im vorindustriellen Europa herrschten verschiedene Sozialformen des Alters, die von verschiedenen Faktoren abhängig waren: dem sozioökonomischen Entwicklungsstand und der sozialen Differenzierung der jeweiligen Region, dem jeweiligen Familien- und Verwandtschaftssystem und der sozialen Schicht. Die Vielfalt der Sozialformen des Alters bewegte sich zwischen zwei Polen. Ein Pol ist gekennzeichnet durch die Dominanz der Kernfamilie und einer räumlichen Trennung der Generationen
Der andere Pol war durch das Zusammenleben mehrerer verheirateter mit ihren Kindern und eventuell weiterer Verwandter gekennzeichnet und typisch für das Ost- und Mitteleuropa des 18. und 19. Jahrhunderts. Die alten Menschen blieben in diese Haushalte integriert und lebten in einem großen mit durch Tod und Wiederverheiratung bedingten wechselnden Zusammensetzung
In Mitteleuropa lagen die Sozialformen des Alters zwischen diesen Extrempolen und wiesen eine hohe Differenzierung auf. Bauern hatten z.B. die Möglichkeit, im Alter bis zum Tod die Wirtschaft weiterzuführen, nach dem Tod des Ehegatten sich wieder zu verheiraten oder den Hof zu übergeben, den Besitz an die eigenen Nachkommen weiterzugeben oder ihn zu verkaufen oder nach neuen Wohnmöglichkeiten zu suchen
In den Städten war durch die stärker entwickelte Waren- und Geldwirtschaft eine Versorgung älterer Menschen auch außerhalb der Hauswirtschaft möglich, z.B. durch den Einkauf in ein Bürgerspital. Voraussetzung für diese Alterssicherung war jedoch Vermögen, Besitz oder Rechtstitel aufgrund der Zugehörigkeit zur Bürgerschaft oder einer Zunft. Die Angehörigen der Unterschicht mussten sich weiterhin selbst durch Arbeit versorgen, es gab z.B. Berufe speziell für Ältere wie zum Bsp. der des Totengräbers oder Torwächters, oder sie mussten betteln gehen
Den meisten der genannten Lebensformen des Alters war gemein, dass die eigene Arbeitskraft das wichtigste Gut des alten Menschen war, wichtiger als die Familie oder die Heimatgemeinde. Alter war bis auf wenige Ausnahmen nicht mit einer Zäsur im Lebenslauf verbunden und somit durch keine eigenständige Lebensphase gekennzeichnet. Das änderte sich erst mit der Entstehung von Pensionssystemen. Diese trugen zur Konstituierung des Alters als einer einheitlichen und chronologisch abgrenzbaren Lebensphase bei
Die historisch bereits im europäischen Absolutismus in der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert entstandenen Pensionssysteme übertrugen die patriarchalische, auf individualisierender Einzelentscheidung bestehende Fürsorgepflicht für Untergebene auf den Staat. Die Pensionssysteme des 18. und 19. Jahrhunderts zielten noch keineswegs auf die Sicherstellung einer von Erwerbsarbeit befreiten Altersphase, sondern behandelten Alter als Sonderfall von Invalidität
Der tatsächliche Übergang zum Alter als eine eigenständige Lebensphase wurde schließlich mit der Einführung eines Regelpensionsalters im Zuge der Entstehung der Rentenversicherung an der Wende zum 20. Jahrhundert erreicht. Erst ab hier war eine Pensionierung unabhängig vom Gesundheitszustand möglich. Alter wurde synonym mit Ruhestand „mit einer Lebensphase, die strukturell vom Erwerbsleben abgegrenzt ist und einen relativ einheitlichen Beginn hat, der maßgeblich durch die Altersgrenzen der öffentlichen Alterssicherungssysteme bestimmt wird“ (zit. i. Kohli 1992, S. 239 f)
Die Wahrnehmung des Alters als „soziales Problem“ begann mit seiner Wahrnehmung als gefährdete Lebensphase der Lohnarbeiterexistenz, zu einer Zeit, als Armut im Alter zum Massenphänomen wurde. Zur gleichen Zeit begann die Medizin, sich mit dem Alter zu beschäftigen, und identifizierte es als Krankheit sowie als körperlichen und geistigen Verfall. Die Leistungsfähigkeit des alten Menschen wurde zunehmend auch im Produktionsprozess angezweifelt. Dieser defizitäre Blickwinkel hatte großen Einfluss auf die weitere wissenschaftliche und allgemeine Perzeption des Alters
2.3.1 Demographische Veränderungen – Strukturwandel des Alters
Ältere Menschen von heute sind hinsichtlich ihres äußeren Erscheinungsbildes, ihrer Einstellungen und Verhaltensweisen, aber auch ihrer Bedürfnisse und Interessen kaum mehr vergleichbar mit den Älteren früheren Generationen. Gemessen an dem eher greisenhaft anmutenden Aussehen ihrer eigenen Eltern, sowie es auf Fotographien festgehalten ist, erscheinen sie, obwohl im gleichen Alter, erheblich jünger. Sie gelten als gesünder und aktiver, verfügen über ein höheres Bildungsniveau und eine bessere Berufsausbildung
Auch wenn die bislang verbreiteten negativen Altersstereotypien nun nicht einfach durch das hier skizzierte neue positive Altersbild, das sich vorwiegend an jüngeren Altersjahrgängen orientiert, ersetzt werden können, ist doch der Wandel des Alters unübersehbar. Diese nach BECHTLER „historische Alterssituation soll zunächst anhand einiger wesentlicher Aspekte der demographischen Entwicklung aufgezeigt werden“ (zit. i. Bechtler 1991, S. 13)
BECHTLER geht davon aus, dass sich die demographischen Trends auch in der Zukunft so fortsetzten (vgl. i. Bechtler 1991, S. 14)
Wesentliches Merkmal der Bevölkerungsentwicklung ist die Verlängerung der Lebenserwartung, das hat zur Folge dass eine wachsende Zahl alternder Menschen ein höheres und hohes Lebensalter erreichen
Auf der Basis der langfristigen Folgen des Geburtenrückgangs bewirkt die starke Zunahme der alten Menschen tiefgreifende Veränderungen der Altersstruktur der Bevölkerung.
Die beschriebenen demographischen Veränderungen haben im gesellschaftlichen Kontext zu einem Strukturwandel des Alters geführt, den TEWS anhand der im Folgenden dargestellten fünf Merkmalen begründet
1. Verjüngung des Alters: Das durchschnittliche Rentenzugangsalter liegt bei Männern bei 58, bei Frauen bei 56 Jahren. Für viele beginnt somit die Altersphase zu einem Zeitpunkt, an dem sie aufgrund ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten keineswegs als „alt“ anzusehen sind
2. Entberuflichung: Als das gesellschaftlich wesentlichste Phänomen des „neuen Alters“ sieht TEWS die Entberuflichung des Alters an. Das heißt bei durchschnittlicher Lebenserwartung haben 60-jährige Männer noch rund 17 Jahre und Frauen noch 21 Jahre vor sich, die mit neuen Lebensinhalten jenseits von Beruf und Familie zu füllen sind
3. Feminisierung (Verweiblichung) des Alters: Das Verhältnis der Geschlechter weist im Alter einen hohen Frauenüberschuss auf, verursacht durch die längere Lebenserwartung der Frauen. Frauen prägen somit das Bild in der Altenarbeit. So erweist sich die Gruppenarbeit mit älteren Menschen oft als Gruppenarbeit mit älteren Frauen
4. Singularisierung (Vereinzelung): Der Anteil der Alleinlebenden steigt mit zunehmendem Alter. Das Leben als „Single“ besitzt inzwischen bei allen Generationen des Erwachsenenalters eine hohe Attraktivität und wird in zunehmendem Maße auch als gewünschte Lebensform begriffen
5. Hochaltrigkeit: Aufgrund z.B. immer besser werdender medizinischer Versorgung steigt der Anteil der über 80-Jährigen an, was aber auch zu einer defizitären Lebenssituation mit weithin unzureichendem Einkommen führen kann
2.4 Die Wissenschaft vom Alter
2.4.1 Die Gerontologie
Die Wissenschaft vom Alter und vom Altern ist die Gerontologie (vom griechischen geron = alter Mensch). Die Herausbildung des Alters als eigenständiger Lebensabschnitt bildete die Grundlage für das Aufkommen der Gerontologie. Der russische Nobelpreisträger METCHNIKOFF verwandte 1903 in seinem Buch „Etude sur la nature humaine“, als erster den Begriff der Gerontologie zur Benennung der Wissenschaft des Alter(n)s. Seit den 60er Jahren erlebt diese Wissenschaft einen starken Aufschwung (vgl. i. Siekendiek 1999, S. 3)
Die Gerontologie kann zunächst einmal als eine Wissenschaft verstanden werden, deren Thema von der Lebensweise älterer Menschen bis zu möglichen Veränderungen ihrer körperlichen, psychischen oder sozialen Prozesse und Vorgänge reicht
Die Erforschung der Altersvorgänge und der Alterssituation umfasst diverse Subdisziplinen wie Geriatrie, Gerontopsychologie, Gerontosoziologie, Geragogik etc. „Sie beschäftigt sich mit der Beschreibung, Erklärung und Modifikation von körperlichen, psychischen, sozialen, historischen, und kulturellen Aspekten des Alterns und des Alters, einschließlich der Analyse von altersrelevanten und alterskonstituierenden Umwelten und sozialen Institutionen“ (vgl. i. Thiersch/ Otto, 2001; S. 32 f.)
Die Gerontologie als Alterswissenschaft bzw. Altersforschung ist seit den 30 Jahren institutionalisiert, die Sozialwissenschaften befassen sich erst seit den 40er Jahren vereinzelt mit Fragen und Problemen alter Menschen, die eine gesellschaftliche Lösung erforderten. Inzwischen ist durch zahlreiche Studien belegt, dass eine Vielzahl von Aspekten Alter und Verlauf der Alternprozesse beeinflussen
2.4.2 Die Gerontagogik
Die Gerontagogik (oder Geragogik) „ist die Wissenschaft von der Erziehung des älteren Menschen und wurde von Bollnow in Analogie zur Pädagogik, Gerontagogik genannt“ (vgl. i. Dabitz/Seuring 1993, S. 400 ff.). Sie ist ein Teilgebiet der interdisziplinären Gerontologie. Jedoch muss man die Gerontagogik von der Erwachsenenbildung unter Aufführung folgender Argumente trennen:
Für die älteren Menschen gelten neben vielen gemeinsamen, auch eine Reihe von spezifischen Lernzielen und -inhalten. Die sozio-emotionalen Bedürfnisse älterer Menschen unterscheiden sich von denen der jüngeren. Die geistige Leistungsfähigkeit ältere Menschen liegt faktisch unter der Leistungsfähigkeit der jüngeren. Ältere Menschen lernen oft anders, deshalb benötigen sie eigene Lehrmethoden
Das Leben im Alter wird durch Theorien erklärt. Die Gerontagogik versucht dann auf wichtige Variablen einzuwirken, die auf Zufriedenheit einwirken
2.5 Alterstheorien- und Modelle
In der Geschichte und Gegenwart der Auseinandersetzung mit dem Alter sind eine ganze Reihe unterschiedlicher Theorien zu verzeichnen, die sich teilweise bekämpft oder abgelöst haben und die unterschiedlichen Welt- und Menschenbildern entspringen, diese lassen sich je nach Einordnungskriterien- unterschiedlich klassifizieren, z.B. nach Human- und Sozialwissenschaften (biologische Alterstheorien, soziologische, psychologische Alterstheorien) und nach den darin formulierten Grundgedanken (Aktivitätstheorie, Disengagementtheorie)
2.5.1 Theorien erfolgreichen Alterns
HAVIGHURST (1963) umschreibt erfolgreiches Altern „als ein Zustand der Zufriedenheit und des Glücks“ (zit. i. Lehr 2000, S. 55). Er geht von der Annahme aus, dass der Übergang in das höhere Lebensalter eine Instabilisierung der inneren und äußeren Situation auslöst. Lebenszufriedenheit wird in diesem Kontext als Indikator für eine gelungene Anpassung an den Alterungsprozess angesehen. Zu Beginn dieses Prozesses wird ein relativ stabilisierender Zustand der Lebenssituation angenommen
Mit dem Übergang in den Ruhestand, dem Wegzug der Kinder aus dem Haushalt der Eltern, dem Verlust von Angehörigen, mit häufiger auftretender Erkrankung, treten nach dieser Auffassung, mehr oder weniger dauerhafte Veränderungen der Lebenssituationen auf, die in der Lage sind, psychisches und physisches Ungleichgewicht zu schaffen
Diesem Konstrukt liegt eine sehr realistische Einschätzung der Lebensereignisse zu Grunde, die mit dem Tatbestand „Altern“ verbunden sind. Auf der anderen Seite wird als normale Reaktion des Individuums eine Regulierung dieses Ungleichgewichts angenommen, deren Resultat im Maß Lebenszufriedenheit erfasst wird
Nach Havighurst werden dem älteren Menschen, von hier aus gesehen „Kompetenzen im Ausgleich von Störungen zugeschrieben, die in dieser Form früheren Lebensalter nicht eigen seien“ (zit. i. Lehr 2000, S. 56)
Auf jeden Fall stellt für HAVIGHURST die Lebenszufriedenheit den besten Indikator für die Anpassung zwischen individuellen Bedürfnissen und Erwartungen einerseits und der sozialen und biographischen Situation andererseits und damit ein erfolgreiches Altern dar
2.5.2 Aktivität oder Rückzug
Vor einigen Jahrzehnten waren die Ressourcen älterer Menschen noch unentdeckt. Die Gerontologie wurde dominiert von einem negativen Altersbild. Ausschlaggebend dafür waren einerseits das Defizitmodell als psychologische Alterstheorie, andererseits die Disengagementtheorie als sozialpsychologisches Modell
Anhand einiger Theorien soll nun die Frage beantwortet werden, welche Form des Alters für den Menschen die optimale sei, die ihm ein Höchstmaß an Zufriedenheit gewährt? Dabei prallen zwei gegensätzliche Theorien aufeinander. Die Disengagementtheorie und die Aktivitätstheorie. Zuvor ist bereits vor dem zweiten Weltkrieg in den USA im Rahmen von faktorenanalytischen psychologischen Untersuchungen das Defizit-Modell der kognitiven Entwicklung entstanden
Schließlich sind noch andere theoretische Konzepte für das Verhalten im höheren Lebensalter genannt
2.5.2.1 Das Defizit-Modell der kognitiven E
Das Modell geht davon aus, dass die kognitiven Fähigkeiten mit zunehmenden Alter abnehmen. Auch emotionale Qualitäten wie Empathie, Sensibilität, Tiefe und Empfindungen usw. wurden dazu gezählt. Das Alter beschrieben als Lebensphase: „... dem Tode nahe, unproduktiv, durch Abbau und Verlust gekennzeichnet, wenig erstrebenswert ...“ (zit. i. Baumgartl 1997, S.69)
Das so entstandene negative Fremdbild des Alters beschreibt BERGLER (1968): „Mangelnde Beweglichkeit, mangelnde Umstellungsfähigkeit, Widerstand gegenüber neuen Arbeitsmethoden, allgemeine Verlangsamung, leichte Ermüdbarkeit usw. ...“
Entgegen gehalten wurde dieser Annahme gerade auch aufgrund von Faktorenmessungen, dass verschiedene kognitive Faktoren auch weiter ansteigende Leistungen aufweisen können, z.B. das Verfügen über Allgemeinwissen oder die sprachliche Kompetenz. Obwohl das Defizitmodell heute wissenschaftlich nahezu überwunden ist, bleibt es weiterhin im Alltagsgedenken präsent und bestimmt wesentlich die Haltung gesellschaftlicher Instanzen gegenüber Alten und das eigene Selbstbild (vgl. i. Sickendiek 1999, S. 38)
Man kann davon ausgehen, dass dieses Modell, dieses negative Fremdbild unweigerlich die Bildung eines negativen Selbstbildes nach sich zieht
Müller stellt fest : „Jedenfalls muss die stereotype Verklammerung von Alter – Krankheit – Isolation – Armut aufgehoben werden, um den alten Menschen aus der Randständigkeit zu lösen“ (zit. i. Baumgartl 1997, S. 70)
Dieses Modell wurde stark kritisiert und in den 80er Jahren revidiert. Trotzdem, das Angehen des negativen Altersbildes dominieren weite Teile der alterswissenschaftlichen Diskussion bis heute
2.5.2.2 Die Disengagementtheorie
Diese Theorie stellte zunächst einmal nahezu alle Ansätze praktischer Altenarbeit in Frage, indem sie Grundannahmen vertritt und behauptet „der ältere Mensch wünsche sich geradezu gewisse Formen der „sozialen Isolierung“, der Reduzierung seiner sozialen Kontakte und fühle sich gerade dadurch glücklich und zufrieden.“ (zit. i. Lehr 2000, S. 58)[3]
Ihre Hauptvertreter CUMMING und HENRY nahmen deshalb ein generelles und weitgehend natürliches und auch notwendiges Rückzugsverhalten aus Aktivitäten und Rollen des mittleren Alters als Charakteristikum des Alternsprozesses an. Als Ursache hierfür wird die entwicklungspsychologische Hinwendung zum herannahenden Tod und das biologische Alter gesehen
Die psychische wie auch soziale Abwendung erfüllt sowohl die Alten selbst als auch für ihre soziale Umwelt den Zweck, auf den Tod vorzubereiten oder die Folgen des Todes durch zunehmende Distanz zum „Leben“ erträglicher zu machen. Rückzug ist nach ihrer These eine wesentliche Voraussetzung für die individuelle Auseinandersetzung mit altersbedingten Abbauprozessen
Die Loslösung von sozialen Rollen wird als gesellschaftlich notwendig dargestellt, um Platz zu machen für die nachwachsende Generation. Aus der Disengagementtheorie resultiert ein direkter Zusammenhang zwischen der Lebenszufriedenheit im Alter und der Abnahme sozialer Aktivitäten
Nach KORF-KRUMREY zeigen Untersuchungen jedoch, dass die Verringerung sozialer Aktivitäten kein allgemeingültiges Merkmal für den Prozess des Alterns ist, sondern in Abhängigkeit von der individuellen Biographie eines Menschen gesehen werden kann. Das Defizitmodell wie auch die Disengagementtheorie setzen biologisch bedingte Alternsprozesse als unvermeidbar voraus. Kalendarisches Alter und Krankheitsprozesse werden in Abhängigkeit zueinander gesehen, sodass Alter und Rehabilitation als Widerspruch erscheinen (vgl. i. Korf-Krumrey 2001, Soziale Arbeit 8/2001)
2.5.2.3 Die Aktivitä
Als Reaktion auf die Defizit- und die Disengagementtheorie und im Gegensatz zum negativen Altersbild, kann die in den 60-er Jahren entworfene Aktivitätstheorie gewertet werden
Sie beschreibt Altern wie die Disengagementtheorie aus der sozialpsychologischen Perspektive. Diese geht entgegen der Disengagementtheorie von der Annahme aus, dass nur derjenige Mensch glücklich und zufrieden ist, der aktiv ist, etwas leisten kann und von anderen noch gebraucht wird. Wer keine Funktion mehr in der Gesellschaft hat ist unglücklich und unzufrieden (vgl. i. Lehr 2000, S. 56)
KEUCHEL (1984) formuliert dieser Theorie zugrundeliegende Annahme folgendermaßen: „Jeder Mensch hat in der Gesellschaft, in der er lebt, spezifische soziale Rollen zu erfüllen. Sowohl die Ausübung dieser Aktivitäten an sich als auch der dabei entstehende Sozialkontakt wird vom Rollenträger als befriedigend erlebt. (...) Die Befriedigung der sozialen und psychologischen Bedürfnisse wird jedoch mit zunehmenden Alter einerseits durch Normen (Pensionierung) und andererseits durch den eigenen gesundheitlichen Abbau oder auch den Tod nahestehender Kontaktpersonen eingeengt“ (zit. i. Klingenberger 1992, S. 42)
Optimales Altern ist nach HAVIGHURST von einer Kontinuität eines aktiven Lebensstils und dem Bemühen älterer Menschen abhängig, der Einschränkung der eigenen sozialen Kontakte entgegenzuwirken. Wer optimal altere, behalte die Aktivitäten des mittleren erwachsenen Alters bei so lange wie möglich und findet geeigneten Ersatz für Aktivitäten die man wie die Berufstätigkeit aufgeben muss, aber auch Ersatz für Freunde und geliebte Menschen, die er durch den Tod verlor (vgl. i. Lehr 2000, S. 56)
KORF-KRUMREY (2001) meint dazu: „Eine solche Annahme setzt das Bedürfnis nach sozialer Aktivität voraus. Sie beschränkt den Menschen allerdings auf seine sozialen Rollen und berücksichtigt nicht die verschiedenen Dimensionen des Alters“ (zit. i. Soziale Arbeit, 8/2001)
BALTES (1996) ergänzt, indem er darauf hinweist, dass bei dieser Theorie, die Grundannahme ist, die menschliche Natur sei auf Tätigkeit hin ausgerichtet und deshalb laufe Untätigkeit der Natur zuwider: „Tätigkeit muss dabei nicht unbedingt „Produktivität" bedeuten, sondern kann auch als unproduktiv bewertete Beschäftigung wie Lernen von Fremdsprachen oder Lesen umfassen. Auch Krankheit und Behinderung schließen Aktivität nicht aus, sondern erfordern nur besondere Formen der Aktivität. Wichtig ist demzufolge also die Kompensation der Rollen- und Funktionsverluste durch neue Aufgaben, Rollen, Aktivitäten“ (zit. i. Siekendiek 1999, S. 40)
Margret und Paul BALTES (1990) verfeinern die Aktivitätstheorie mit dem „Prinzip der selektiven Optimierung mit Kompensation.“ „Je älter (reifer) jemand wird, desto mehr ist er oder sie in der Lage, solche Lebensbereiche und Aktivitätsterrains auszuwählen und sich darauf zu konzentrieren, die subjektiv wichtig und positiv besetzt sind. Er oder sie verwendet Kraft und Aufmerksamkeit darauf, diese in der Lebensführung gut auszugestalten und sie im Alter aufrecht zu erhalten, auch wenn sie durch persönliche oder äußere Veränderungen bedroht sind. Einschränkungen oder Verschlechterungen werden durch Anpassungsleistungen oder Ersatzfunktionen kompensiert“ (zit. i. Sickendiek 1999, S. 40)
Problematisch ist jedoch, dass die in der westlichen Gesellschaft verfügbaren Rollen und Aufgaben häufig Ersatzcharakter haben, wenig gesellschaftliche Wertschätzung erfahren oder von den Alten selbst abgelehnt werden, da sie nicht ihrer Lebenserfahrung und Lebenswelt entsprechen
Weiter wird die Aktivitätstheorie fundamental in Kritik gestellt, dass ihr eine einseitige Orientierung an einem Begriff von Leistung- und Leistungsfähigkeit zugrunde liegt (vgl. i. Sickendiek 1999, S. 41)
Für die Altenarbeit und Altenbildung bedeutet ein solches Altersbild, dass sie möglichst (re)aktivierend und motivierend sein muss. Der Verlust von Kontakten und Rollen muss durch die Altenarbeit ausgeglichen werden. Allerdings gibt es nur wenig konkrete Angaben von Ersatz- und Kompensationstätigkeiten; auch deren Anerkennung in einer arbeits- und erwerbstätig orientierten Kultur anzuzweifeln
Jedoch sind die bisher genannten Theorien erwähnenswert, weil sie eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Prozess des Alterns angeregt und somit den Reifeprozess einer jungen Wissenschaft, der Gerontologie, vorangetrieben haben
[...]
[1] funktionelle Fähigkeiten: Damit werden die Funktionen der Organe und Organsysteme zur Aufrechterhaltung der Balance der Körperfunktionen verstanden
[2] Pädagogisch gesehen ergibt sich hieraus die Aufgabe unter Beachtung und Wahrung der ganzheitlichen Verfassung und Bezüge der alten Menschen, diesen zur Entwicklung seiner Potentiale zu befähigen
[3] Disengagement: aus dem englischen in der Bedeutung von Los-lassen, Zurück-ziehen (vgl. Lehr 2000, S. 58)