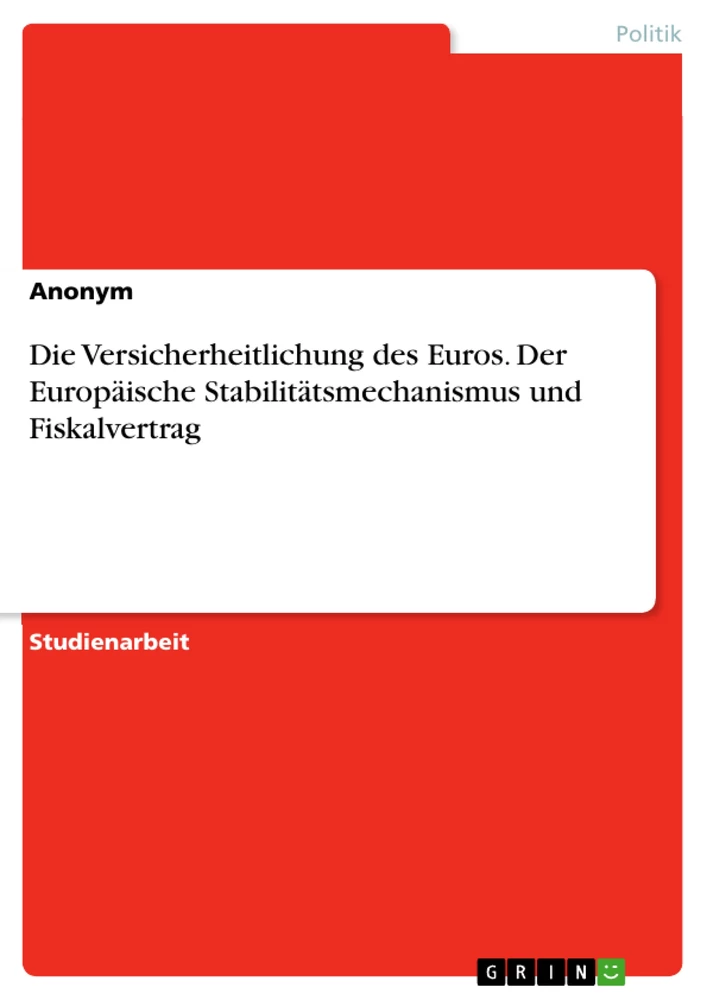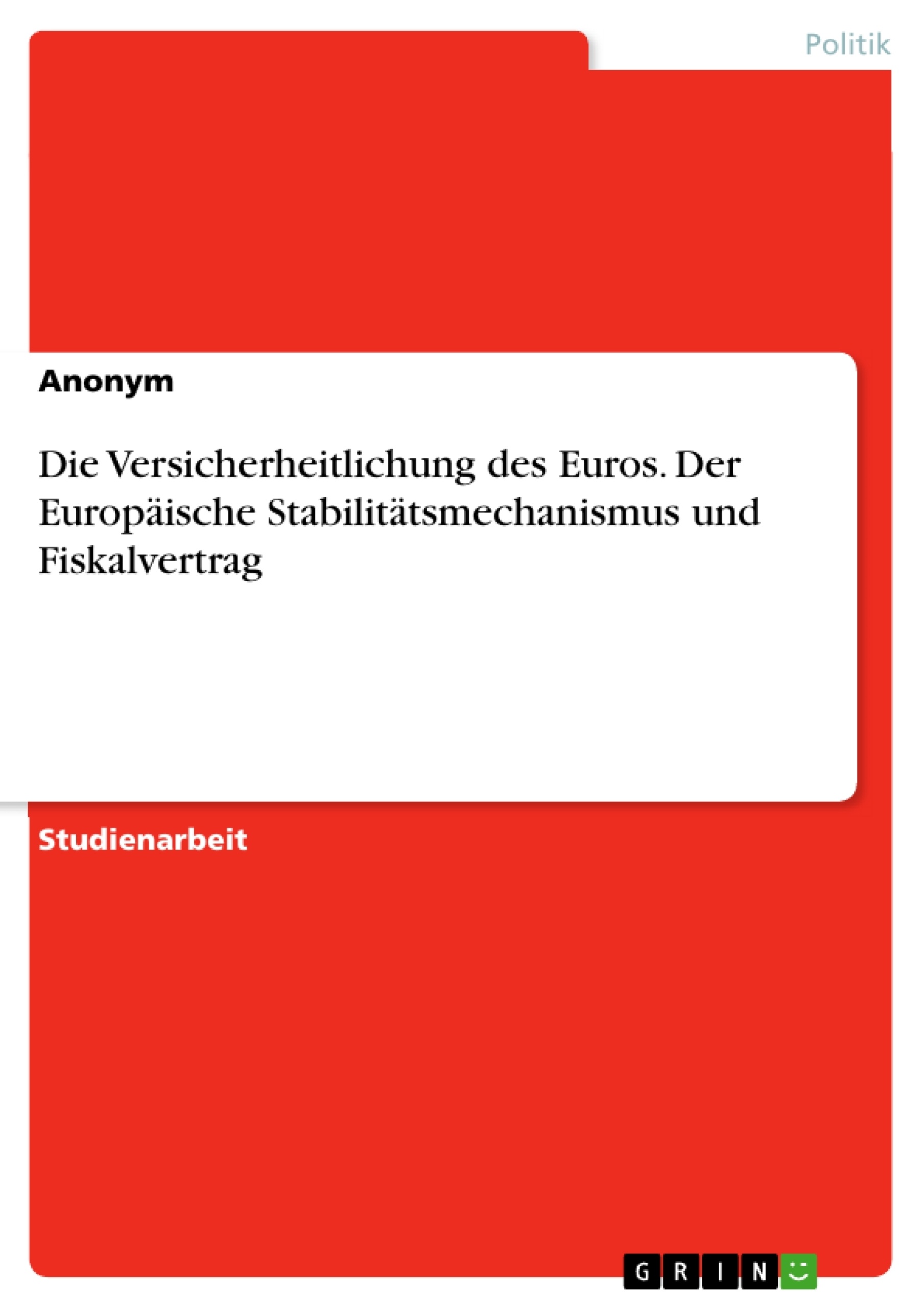Wie gelang es der Bundeskanzlerin die Abgeordneten der Regierungsparteien und große Teile der Opposition davon zu überzeugen, dem Gesetzespaket, bestehend aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und Fiskalvertrag, zuzustimmen? Untersucht wird, ob die Bundeskanzlerin in ihrer Rede eine Versicherheitlichung vornahm und ob diese, die Abgeordneten bei ihrer Abstimmung beeinflusst hat, für die Rettungsmaßnahmen zu stimmen. Zur Beantwortung der Forschungsfrage eignet sich die Securitization-Theorie von Barry Buzan, Ole Waever und Jaap H. de Wilde.
Vor seiner Einführung wurden der ESM und auch der Fiskalvertrag von vielen Seiten kritisiert. Trotz der breiten gesellschaftlichen Kritik und Zweifel bei einigen Abgeordneten stimmte der Bundestag mit einer großen Mehrheit für das Gesetzespaket bestehend aus ESM und Fiskalvertrag. Vor der Abstimmung hielt die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Rede im deutschen Bundestag, um die Abgeordneten von der Notwendigkeit der von ihr geforderten Rettungsmaßnahmen zu überzeugen und diese zur Zustimmung zu bewegen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Forschungsfrage und Theoriewahl
2. Securitization-Theorie
2.1 Überblick
2.2 Das Bezugsobjekt
2.3 Versicherheitlichung im ökonomischen Sektor
2.4 Der versicherheitlichende Akteur
2.5 Der Sprechakt
2.6 Die förderlichen Umstände
2.7 Das Publikum des Sprechaktes
3. Analyse der Rede
3.1 Der versicherheitlichende Akteur
3.2 Das Publikum
3.3 Die Bezugsobjekte
3.3.1 Die Finanzstabilität der Euro-Zone als Bezugsobjekt
3.3.2 Der Wohlstand in Europa als Bezugsobjekt
3.4 Die förderlichen Umstände
3.4.1 Internen Umstände
3.4.2 Externen Umstände
3.5 Die geforderten Notfallmaßnahmen
3.5.1 Der Europäische Stabilitätsmechanismus
3.5.2 Der Fiskalvertrag
3.6 Abstimmungsergebnis
4. Fazit
Bibliographie