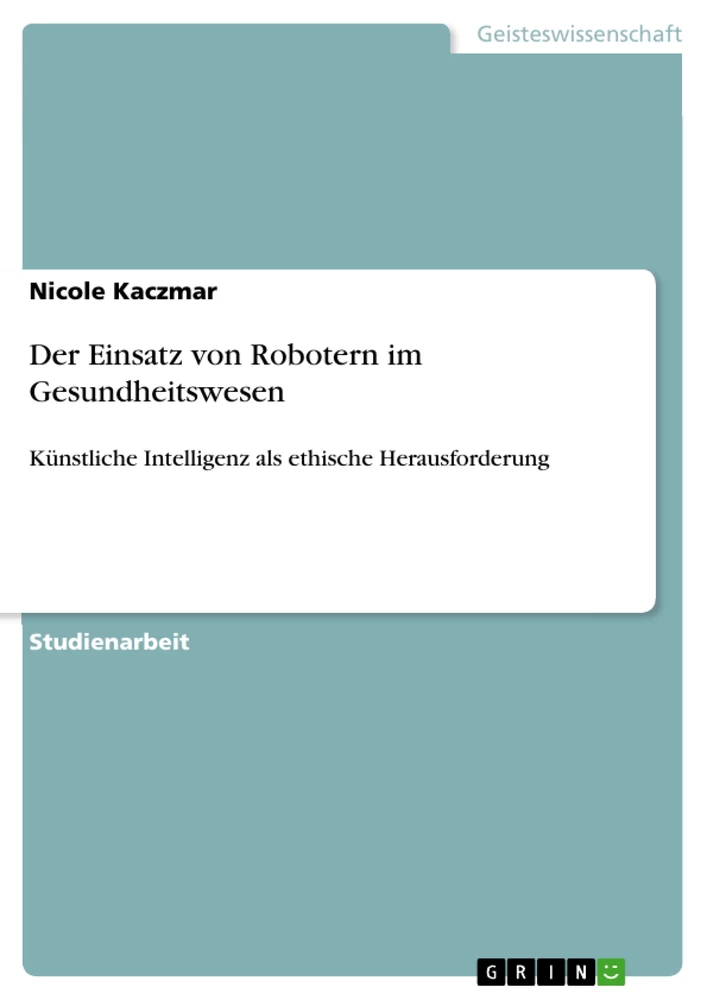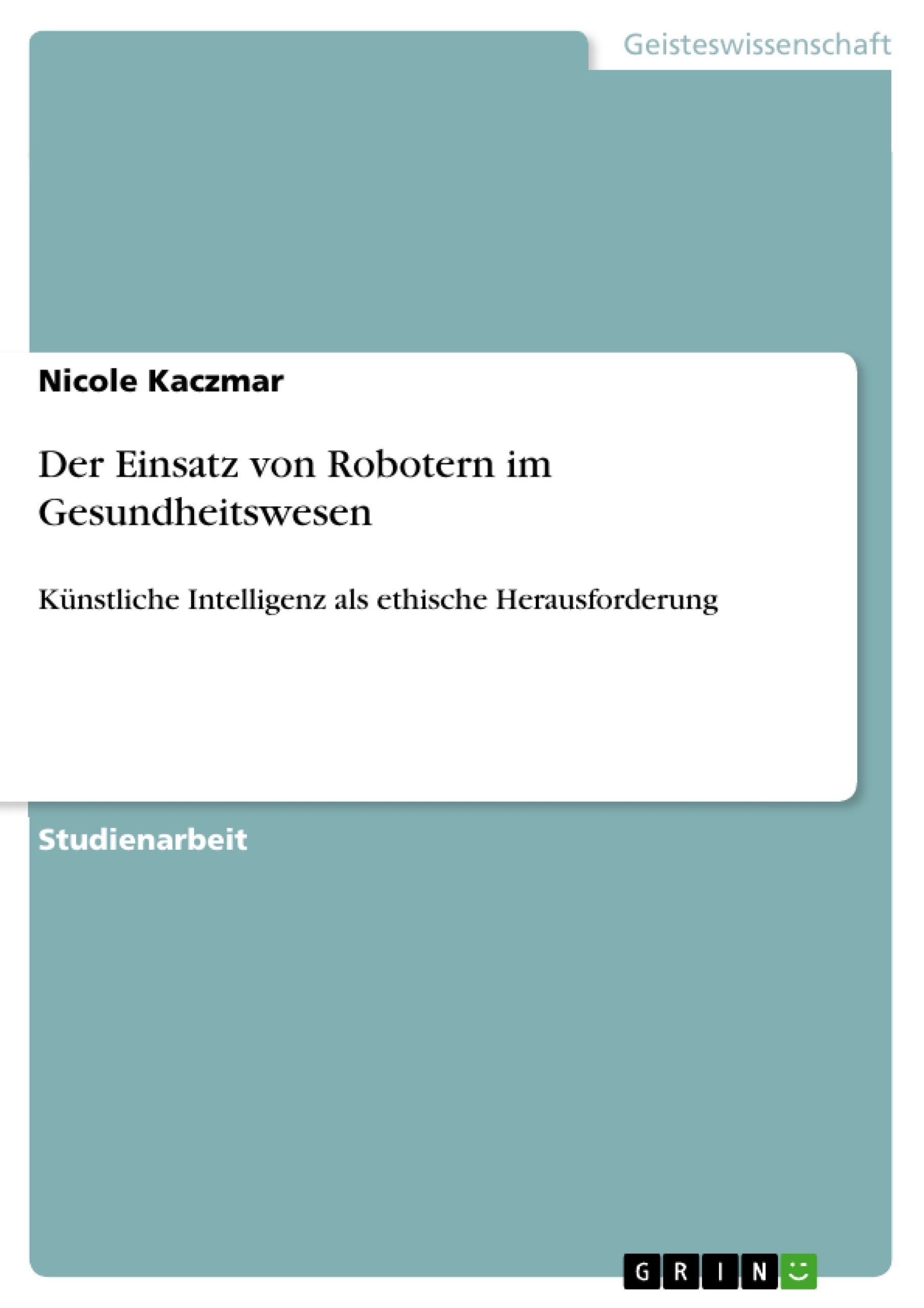In dieser Arbeit wird der Bereich der sozialen Robotik im Gesundheitswesen diskutiert. Der Schwerpunkt liegt auf Robotern, die in der Pflege und Therapie in Deutschland eingesetzt werden.
Neben den Vorteilen werden auch die wesentlichen ethischen Fragestellungen erörtert, die sich beim Einsatz von Robotern in Pflege und Therapie ergeben. Dabei werden die Perspektiven, Chancen und Risiken der Mensch-Roboter-Interaktion beispielhaft an den beiden sozialen Robotern Pepper und Paro diskutiert, die seit kurzem auch in Deutschland in Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden. Um diese ethische Bewertung sinnvoll wiederzugeben, müssen zunächst die begrifflichen Grundlagen, wie der Begriff der "Künstlichen Intelligenz" und der Begriff "Roboter" mit dem Fokus auf humanoide Roboter und soziale Roboter geklärt werden. In einem weiteren Punkt wird das Gebiet der Pflege- und Therapieroboter expliziert. Anhand der beiden Roboter Pepper und Paro werden Vorteile sowie ethische Herausforderungen in der Anwendung diskutiert. Im Anschluss wird für einen nachhaltigen Einsatz von Pflegerobotern in der Zukunft plädiert.
Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung fehlen bis zum Jahr 2030 in Deutschland ca. 393.000 Pfleger in Altenheimen und bei ambulanten Pflegediensten. In Bezug auf die Versorgungslücke, die sich zwischen Nachfrage und Fachkräfteangebot bahnt, wird bereits von einem bevorstehenden Pflegenotstand gesprochen. Dieser Pflegenotstand sorgt für Handlungsdruck. So stellt sich die Frage, ob Pflegeroboter diese Lücke im wachsenden Bedarf der Altenpflege füllen können, indem sie dem Pflegepersonal Routinetätigkeiten abnehmen und es dadurch entlasten.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Begriffsdefinitionen
2.1. Künstliche Intelligenz
2.2. Roboter
2.2.1. Humanoide Roboter
2.2.2. Soziale Roboter: Pflege und Therapieroboter
III. Einsatz von Robotern in Pflege und Therapie eine ethische Analyse
3.1. Pflegeroboter: Pepper
3.2. Allgemeine ethische Debatte über den Einsatz von Pepper im Pflegebereich
3.3. Therapieroboter: Robbe Paro
3.4. Allgemeine ethische Debatte über den Einsatz von Paro im Therapiebereich
IV. Plädoyer: Nachhaltiger Einsatz von Pflege und Therapierobotern
V. Zusammenfassung und Ausblick
Literaturverzeichnis