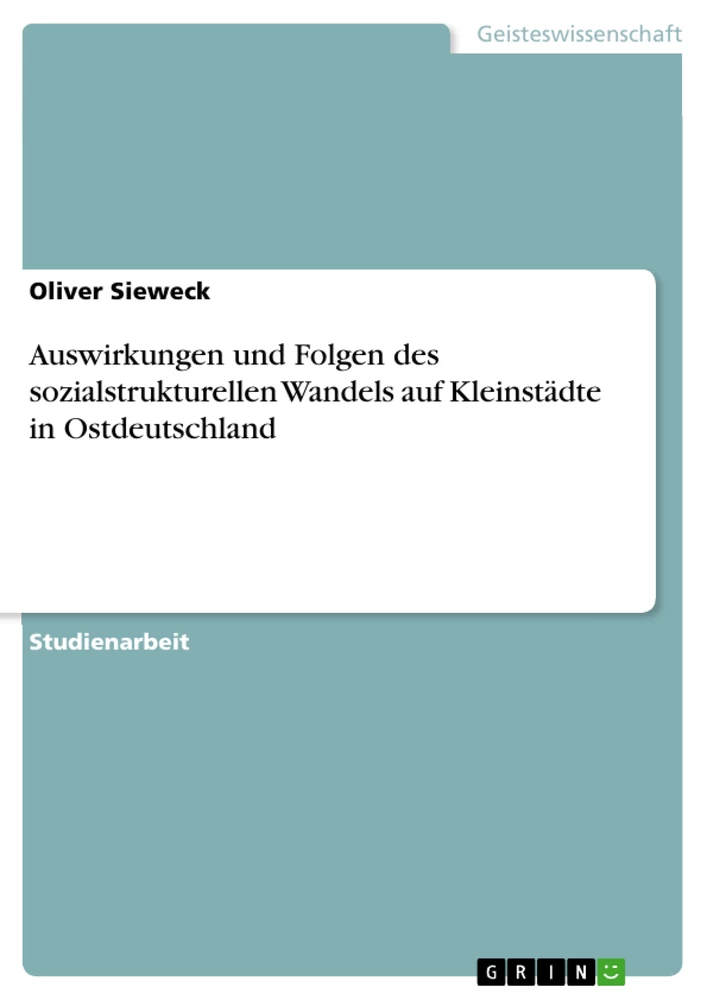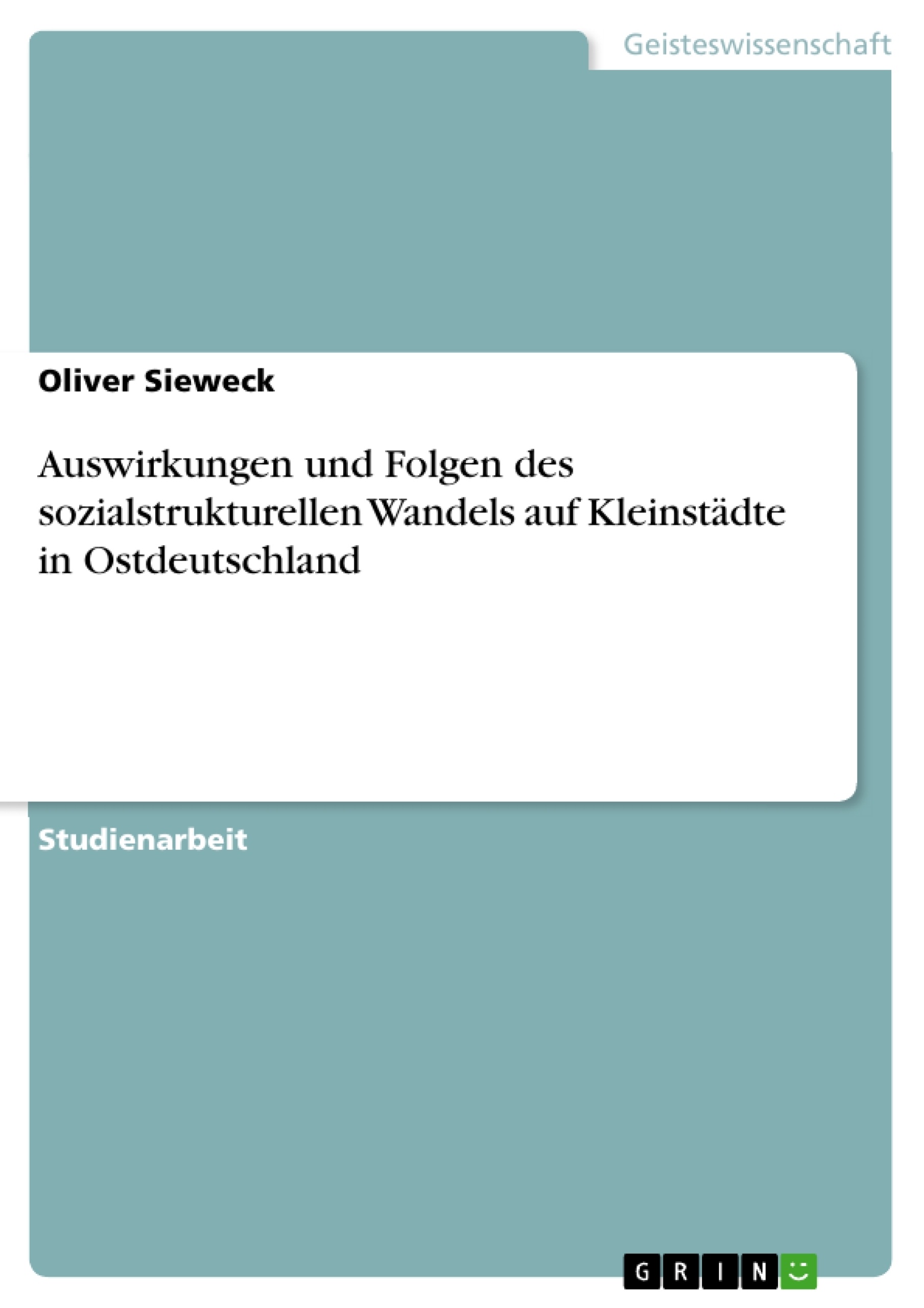Die Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen und Folgen des sozialstrukturellen Wandels auf Kleinstädte in Ostdeutschland. Um die Forschungsfrage zu überprüfen, sollen in dieser Arbeit fünf ausgewählte Kleinstädte in Ostdeutschland auf die Auswirkungen/ Folgen des sozialstrukturellen Wandels hin untersucht werden. Dies geschieht anhand einiger Bestandteile des Merkmals "Demografischer Wandel". Die Städte besitzen alle eine vergleichbare Einwohnerzahl und liegen in eher ländlich geprägten Regionen. Zudem sind sie Verwaltungssitz für eingemeindete Dörfer.
Inhaltsverzeichnis
1 Forschungsfrage und Vorgehensweise
2 Begriffsdefinitionen
2.1 Sozialstruktureller Wandel
2.2 Kleinstadt
2.3 Ostdeutschland
3 Grundlagen – Theorie
3.1 Historischer Abriss
3.2 Lage in Ostdeutschland
4 Empirische Überprüfung
4.1 Theoretische Vorüberlegung
4.2 Umsetzung
5 Zu erwartende Ergebnisse
6 Quellenverzeichnis
6.1 Literatur
6.2 Internetquellen
6.3 Sonstiges