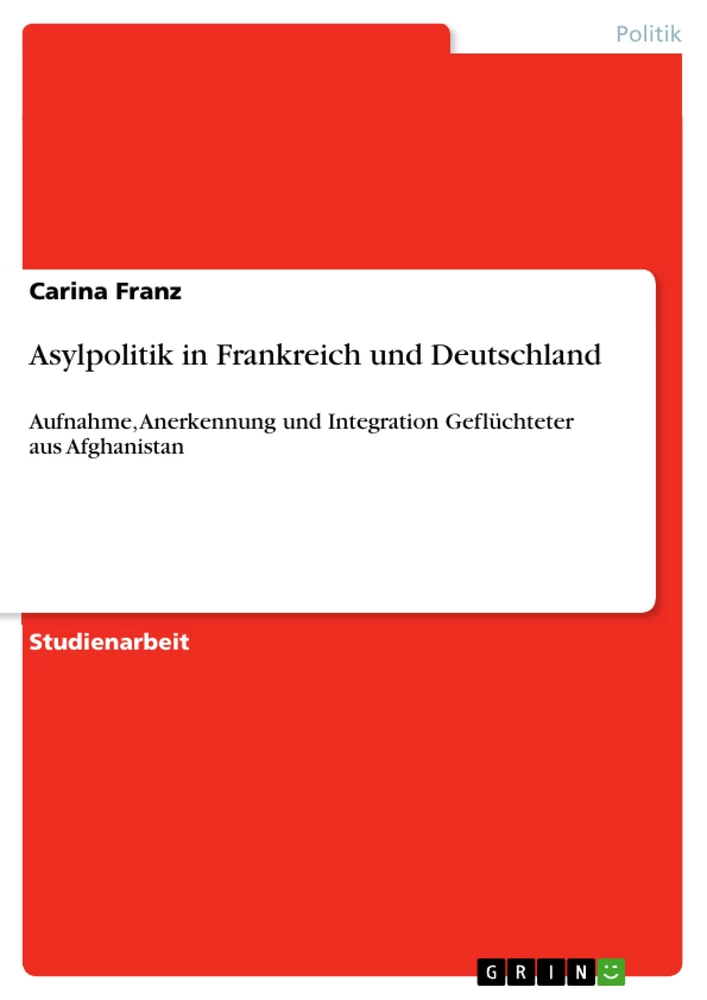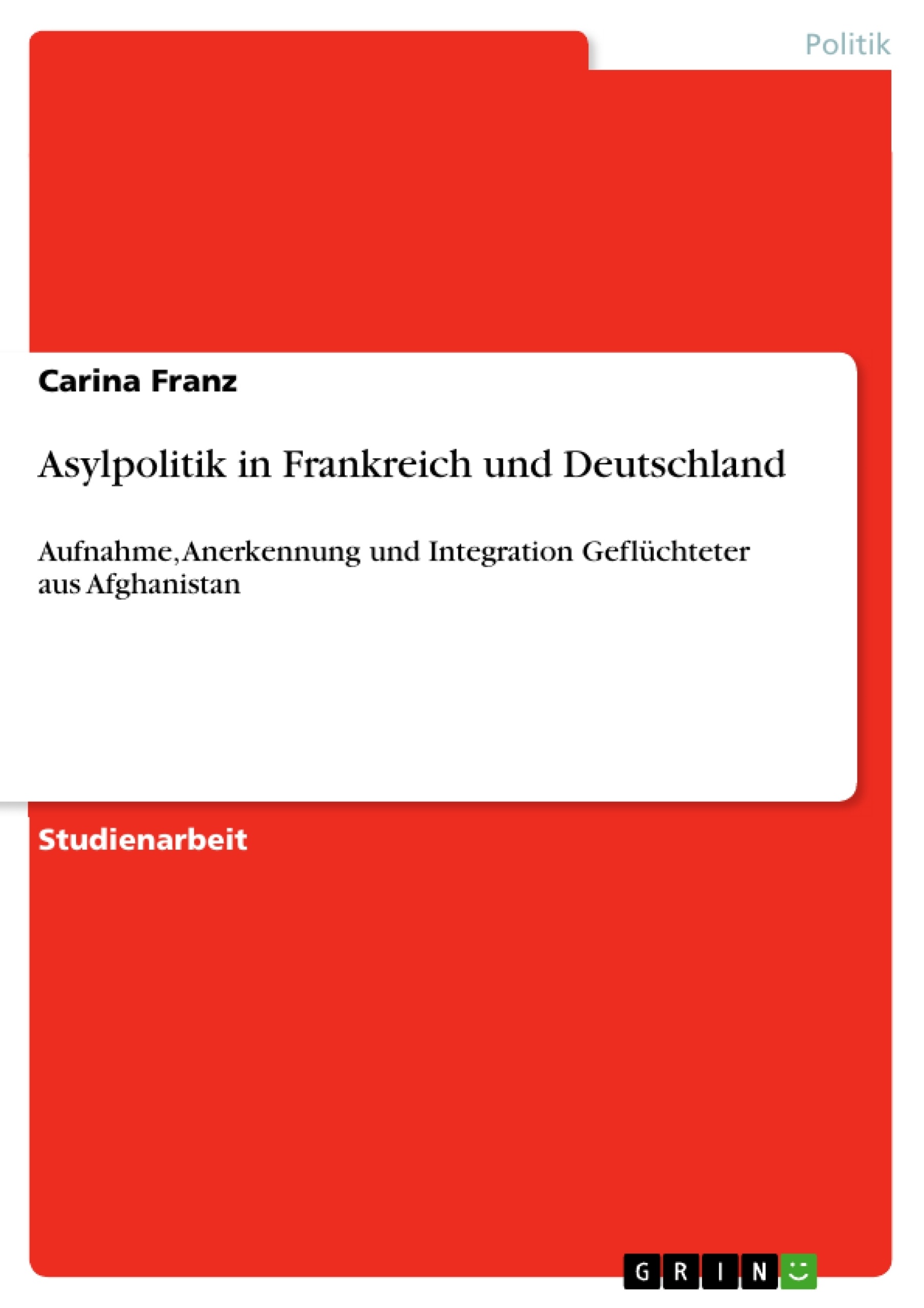In dieser Studienarbeit werden folgende Fragen erörtert:
Welche Unterschiede gibt es zwischen der Asylpolitik Frankreichs und der Bundesrepublik Deutschland (BRD)? Stimmt es, dass Geflüchtete aus Afghanistan in Frankreich öfter einen Schutzstatus – als Asylberechtigte, als Flüchtlinge nach der Genfer Konvention oder als Subsidiär Geschützte – erhalten als in der BRD? Lassen sich die Unterschiede in der Asylpolitik durch Erkenntnisse zu Wohlfahrtsregimen erklären?
Inhalt
1 Einleitung
1.1 Die Situation Asylsuchender aus Afghanistan
1.2 Der Faktor Wohlfahrtsregime
2 Asylpolitik in der Europäischen Union
2.1 Asylpolitische Ziele der Europäischen Union
2.2 Asylpolitische Realität in der Europäischen Union
2.3 Vergleich der Asylpolitik der EU-Staaten Frankreich und BRD
2.3.1 Unterschiedliche Asylbewerberzahlen
2.3.2 Unterschiedliche Ergebnisse der Asylprozesse
2.3.3 Unterschiedliche Aufenthaltstitel
2.3.4 Unterschiede bei der Integration
2.3.5 Zusammenfassung zum Vergleich der Asylpolitik Frankreich - BRD
3 Zusammenhänge zwischen Wohlfahrtsregimen und Asylpolitik
4 Diskussion
4.1 Aufnahmezahlen, geografische und kulturelle Distanz
4.2 Aufnahmezahlen und Einstellungen zur Zuwanderung
4.3 Integration und Stratifizierung
4.4 Integration und Re-Kommodifizierung
5 Fazit
Literatur- und Quellenverzeichnis