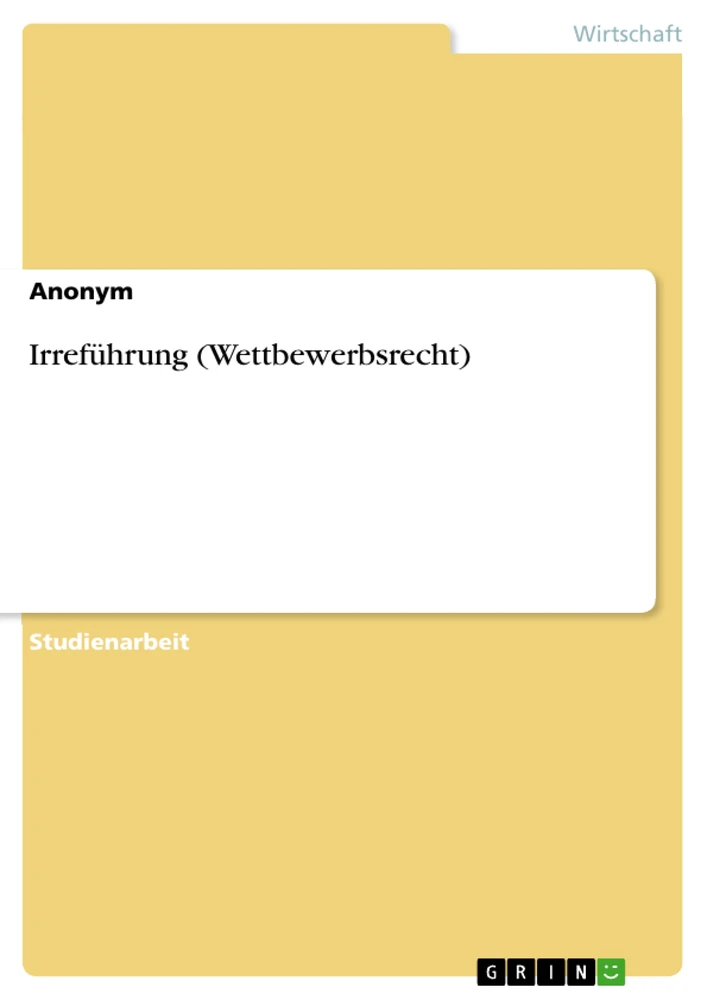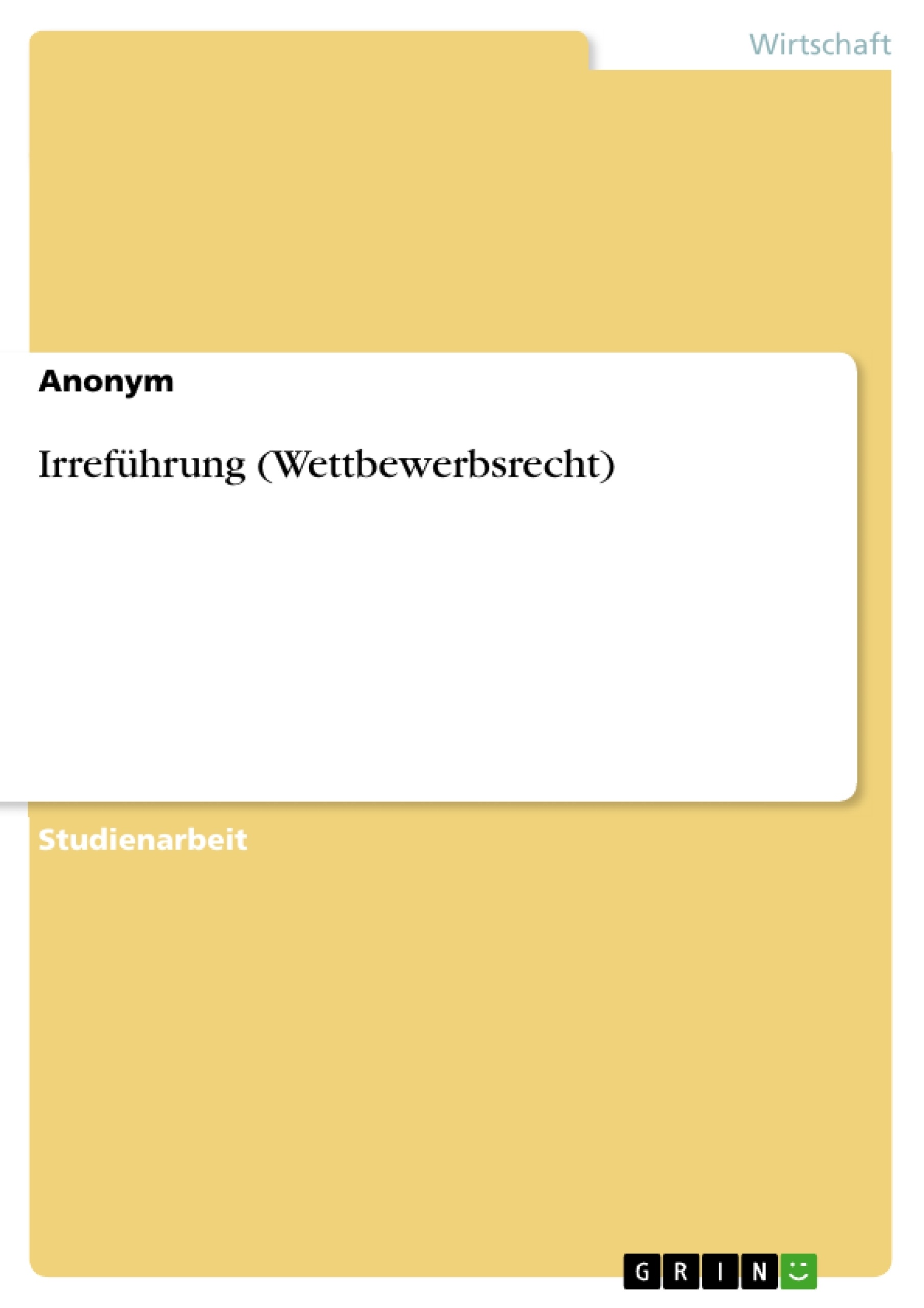In der folgenden Hausarbeit soll die Irreführungsgefahr im Wettbewerbsrecht in Deutschland verdeutlicht werden. Nach einigen grundsätzlichen Informationen zum Thema Irreführung im UWG wollen wir dabei auf den Aspekt der irreführenden Werbung gezielt eingehen und dies anhand einiger Praxis-Beispiele dokumentieren. Im letzten Teil der Hausarbeit befassen wir uns dann abschließend kurz mit der Handhabung von Irreführung in anderen Ländern der Europäischen Union.
Gliederung
1. Einführung
1.1 Vorwort
1.2 Gesetzestext
1.3 Begriff und Beziehung zu § 1 UWG
1.4 Irreführende Angaben
1.5 Besondere Rolle der Werbung
1.6 Prüfungsschema
2. Methoden der Irreführung
2.1 Bedeutungswandel
2.2 Mehrdeutigkeit
2.3 Verschweigen von Tatsachen
2.4 Alleinstellung
2.5 Objektiv richtige Angaben
2.6 Objektiv falsche Angaben
2.7 Werbung mit Selbstverständlichkeiten
3. Einzeltatbestände irreführender Werbung
3.1 Beschaffenheit
3.2 Geographische Herkunft
3.3 Bezugsquelle
3.4 Herstellungsart
3.5 Lockvogelwerbung
3.6 Preisgegenüberstellung
4. Beispiele
4.1 Der Kölnisch-Wasser Fall
4.2 Kellogg’s
4.3 Regenwald-Projekt von Krombacher
5. Rechtliche Folgen
5.1 Verantwortliche Personen / Personengruppen
5.2 Sanktionen
5.2.1 Unterlassung
5.2.2 Schadensersatz
5.2.3 Freiheits-/Geldstrafe
4.2.4 Abmahnung
5.3 Rücktrittsrecht
6. Ausblick EU
6.1 Irreführungsrichtlinie 84/450/EWG Art. 2 Nr.2
6.2 Abgrenzung zu § 3 UWG
Anlagen
1. Einführung
1.1 Vorwort
In der folgenden Hausarbeit soll die Irreführungsgefahr im Wettbewerbsrecht in Deutschland verdeutlicht werden. Nach einigen grundsätzlichen Informationen zum Thema Irreführung im UWG wollen wir dabei auf den Aspekt der irreführenden Werbung gezielt eingehen und dies anhand einiger Praxis-Beispiele dokumentieren. Im letzten Teil der Hausarbeit befassen wir uns dann abschließend kurz mit der Handhabung von Irreführung in anderen Ländern der Europäischen Union.
1.1 Gesetzestext
- 3 [Irreführende Angaben] Wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs über geschäftliche Verhältnisse, insbesondere über die Beschaffenheit, den Ursprung, die Herstellungsart oder die Preisbemessung einzelner Waren oder gewerblicher Leistungen oder des gesamten Angebots, über Preislisten, über die Art des Bezugs oder die Bezugsquelle von Waren, über den Besitz von Auszeichnungen, über den Anlass oder den Zweck des Verkaufs oder über die Menge der Vorräte irreführende Angaben macht, kann auf Unterlassung der Angaben in Anspruch genommen werden. Angaben über geschäftliche Verhältnisse im Sinne des Satzes 1 sind auch Angaben im Rahmen vergleichender Werbung.
1.2 Begriff und Beziehung zu § 1 UWG
Das Wettbewerbsrecht hat grundsätzlich eine doppelte Zielrichtung. Zum einen den Schutz der Verbraucher und zum anderen den der Mitbewerber. § 1 UWG stellt eine umfassende Generalklausel gegen den unlauteren Wettbewerb als solchen dar. Durch den § 3 (die sog. „kleine Generalklausel“) wird der Anwendungsbereich eingeschränkt. Diese Klausel enthält ein umfassendes Verbot irreführender Angaben, die im geschäftlichen Verkehr, zu Zwecken des Wettbewerbs gemacht werden. §§ 1 und 3 UWG stehen selbständig nebeneinander, wenngleich ein Verstoß gegen § 3 UWG in aller Regel zugleich auch ein sittenwidriges Wettbewerbsverhalten im Sinne von § 1 UWG darstellt. Andererseits deckt § 3 UWG nur solche irreführende Verhaltensweisen ab, bei denen ein Gewerbetreibender irreführende Angaben über geschäftliche Verhältnisse macht. Die Beweislast der Irreführung trägt grundsätzlich der Kläger. Nur in Ausnahmefällen kann den Werbenden die Beweislast treffen. Geschieht die Irreführung nicht durch „Angaben“ oder beziehen sie sich nicht auf geschäftliche Verhältnisse, greift nur § 1 UWG.[1]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Skript Wettbewerbsrecht von Prof. Dr. Reese)
1.3 Irreführende Angaben
Irreführende Angaben über geschäftliche Verhältnisse beziehen sich insbesondere auf die Beschaffenheit, den Ursprung, die Herstellungsart, Bezugsquelle, Herkunft etc. einzelner Waren, gewerblicher Leistungen oder des gesamten Angebots. Diese Punkte werden unter Gliederungspunkt 3 mit der Darstellung von Einzeltatbeständen in der Werbung näher beleuchtet. Angaben werden dann als irreführend angesehen, wenn die Gefahr nicht von der Hand zu weisen ist, dass sie von einem nicht unerheblichen Teil des angesprochenen Kundenkreises falsch verstanden werden können. Dabei reicht die reine Gefahr aus, dass es zu Irrtümern kommen könnte. Was nun ein „nicht unerheblicher Teil“ ist, ist umstritten. Als Faustregel gilt dabei eine Irreführungsquote von 10 %. Dem Laien mag die Warnung reichen, dass man schon in die Gefahr einer Verurteilung läuft, wenn nur jeder 10. Kunde die Werbung falsch versteht.[2] Demgegenüber reichen reine Werturteile und bloße Anpreisungen wie „Das strahlendste Weiß meines Lebens“ (Waschmittel), „Mutti gibt mir nur das Beste“ (Fertigbrei) nicht unter Angaben im Sinne des Gesetzes.[3]
1.4 Besondere Rolle der Werbung
In aller Regel ist irreführende Werbung unwahr, d.h. die Werbeaussage stimmt nicht mit den tatsächlichen Verhältnissen überein. § 3 soll irreführender Werbung möglichst umfassend begegnen. Werbung hat die Aufgabe, die Sach- und Dienstleistung eines Unternehmens bekannt zu machen, die Einstellungen zu betrieblichen Angeboten zu beeinflussen, die Beschaffung zu unterstützen und diese Maßnahmen aufeinander abzustimmen.[4] Der Paragraph 3 des UWG stellt dabei die Generalklausel, d.h. eine ganz allgemein gehaltene Rechtsvorschrift, für jede Werbung dar, unabhängig davon ob es sich um Einzelwerbung oder öffentliche Werbung handelt.
1.5 Prüfungsschema
Die Prüfung, ob eine Angabe und somit eine Werbung irreführend ist, erfolgt üblicherweise in folgenden Schritten:
Zuerst ist festzustellen, ob überhaupt ein Handeln im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs vorliegt, weil nur dies die Anwendbarkeit des § 3 UWG eröffnet.
Maßgebliche Verkehrskreise
Die maßgeblichen Verkehrskreise sind zunächst die vom Werbenden angesprochenen. Es kommt demnach auf die Kreise an, die von der Angabe des Werbenden voraussichtlich tatsächlich erreicht werden, also die tatsächlichen und potenziellen Kunden. Die Ermittlung der maßgeblichen Verkehrskreise ist von großer Bedeutung, da von ihr auf das Verständnis geschlossen wird. Unterschieden wird hierbei zwischen Privatkunden und Händlern bzw. Fachleuten. Diese beiden Gruppen unterscheiden sich zum einen in ihrem Wissensstand und zum anderen in ihrem Sprachgebrauch.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Werden beide Gruppen von einer Werbung angesprochen, genügt Irreführung einer dieser Gruppen.
Als nächstes ist die Werbung daraufhin zu untersuchen, ob das, was angegriffen wird, eine Angabe i.S.d. § 3 UWG ist.
Verkehrsauffassung
Die Ermittlung der Verkehrsauffassung ist maßgebend für die Einordnung einer Werbemaßnahme als „Angabe“ oder nicht überprüfbares Werturteil. Wie eine Werbung zu verstehen ist, entscheidet nicht der Werbende, sondern der Verbraucher. Um den Inhalt einer Werbeaussage zu ermitteln, stellt die Rechtsprechung nicht darauf ab, was der Werbende sagen wollte, sondern darauf, wie die Verkehrskreise, an die sich die Werbung wendet, die Aussage verstehen. Als Maßstab für den Verbraucher ist, da die Prüfung nach der Auffassung der Rechtsprechung meist nur oberflächlich erfolgt, vom Eindruck des flüchtigen Durchschnittsverbrauchers auszugehen.
Tatsächliche Verhältnisse
Das festgestellte Verständnis ist daraufhin den wirklichen Verhältnissen gegenüberzustellen. Irregeführt werden muss weder die Gesamtheit, noch der überwiegende Teil der angesprochenen Personen. Ausreichend ist, dass bei einem rechtlich nicht unbeachtlichen Teil Fehlvorstellungen hervorgerufen werden können.[5] Eine Grenze ist somit nicht absolut festgelegt, sondern variiert abhängig vom jeweiligen Fall. Als Richtgröße im Normalfall gilt eine Irreführungsquote von ca. 10 %. In der Gesundheits-, Arznei- und Lebensmittelbranche besteht ein erhöhtes Schutzbedürfnis bei Werbeangaben, so dass die Quote dort bei 5 – 6 % liegt.
Ergeben sich Abweichungen, liegt eine Irreführung vor. Für den Wettbewerbsprozess gilt, dass die Richter den Inhalt einer Werbeaussage selbst beurteilen können, wenn sie, etwa bei Waren des täglichen Bedarfs, selbst zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören. Richtet sich die Werbung an Fachkreise, wird das Gericht Sachverständige einschalten, sofern es nicht selbst über ausreichende Sachkunde verfügt. Als Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsauffassung dienen so z.B. Auskünfte der Industrie- und Handelskammer, von Fach- und Wirtschaftsverbänden, sowie demoskopische Umfragen, die von Meinungsforschungsinstituten durchgeführt werden. Die Zahl der Fälle in denen die Verkehrsauffassung durch Meinungsumfragen ermittelt werden, ist jedoch relativ gering. Das liegt vor allem daran, dass Meinungsumfragen sehr kosten- und zeitintensiv sind. Umfragen werden aus diesem Grund nur angewendet, wenn kein billigeres Beweismittel zur Verfügung steht.
2. Methoden der Irreführung
Das Irrführungsverbot gewinnt Bedeutung in vielfältigen Erscheinungsformen. Es gibt dabei diverse Methoden der Irreführung:
2.1 Bedeutungswandel
Die für den Gesamteindruck maßgebliche Verkehrsauffassung kann sich im Zeitablauf ändern. So können sich beispielsweise ehemals geographische Herkunftsangaben zu Beschaffenheitsangaben wandeln. Zu beachten ist, dass sich der Bedeutungswandel bereits vollzogen haben muss, d.h. dass kein rechtlich beachtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung noch in ihrer ursprünglichen Bedeutung versteht[6] Diese Methode wird unter Punkt 3. an dem Kölnisch Wasser-Fall näher erklärt.
2.2 Mehrdeutigkeit
Lässt eine Werbeangabe begrifflich mehrere unterschiedliche Deutungen zu, muss sich der Gewerbetreibende jede mögliche, nicht ganz fernliegende Deutung zurechnen lassen. Das gilt auch für unbewusst hervorgerufene Mehrdeutigkeiten. So sah es die Rechtsprechung im „Kunstglas-Fall“ für den Tatbestand der Irreführung als ausreichend an, dass ein nicht unbeachtlicher Teil des Publikums unter Kunstglas noch die ursprüngliche Bezeichnung – nämlich künstlerisch gestaltetes Silikatglas – und nicht die neuere Bedeutung – nämlich eine Bezeichnung für glasartige Leuchten aus Kunststoff – verstand. Da somit verschiedene Auffassungen des Begriffes „Kunstglas“ bestehen, muss nach Auffassung der Rechtsprechung bei der Verwendung der Bezeichnung Kunstglas durch Zusätze deutlich gemacht werden, dass es sich um einen Kunststoff handelt[7]
2.3 Verschweigen von Tatsachen
Auch durch Verschweigen bei bestehender Aufklärungspflicht kann irregeführt werden, z.B. bei Produktänderungen (Davidoff) oder bei fehlendem Hinweis auf Auslaufmodelle.[8] So hat ein Hersteller im Regelfall die Pflicht den Verbraucher darüber aufzuklären, wenn er Produkte anbietet, die in Zukunft nicht mehr hergestellt werden (Auslaufmodelle). Diese Pflicht besteht immer dann, wenn sie nicht sowieso schon durch Gesetz, Vertrag oder vorangegangenem Tun besteht, wenn das Publikums diese Tatsache als wesentlich ansieht und somit den Kaufentschluss beeinflussen würde.
Ausnahmen von dieser Aufklärungspflicht gibt es z.B. in der Modebranche, da ein fließender Wandel stattfindet. Ein Modellwechsel ist meist nicht so auffällig, dass er sofort erkannt wird, und deshalb die auslaufenden Kleidungsstücke als veraltet angesehen werden können.
2.4 Alleinstellung
Bei der Alleinstellungswerbung versucht ein Gewerbetreibender z.B. die Spitzenstellung seines Unternehmens darzulegen. Dies geschieht meist durch Superlative wie „der größte Getränkemarkt der Welt“, oder „Deutschlands bester Lieferservice“.
[...]
[1] Gerhard Speckmann. Wettbewerbsrecht. Köln, Berlin, Bonn, München 2000. S.252/253.
[2] http://www.kanzlei-wbk.de 21.03.03
[3] http://www.feil-weigmann.de/gewerschutz3.htm 22.03.03
[4] Brockhaus. Enzyklopädie. 24.Bd. S.66 f..
[5] Thomas Dehlfing. Das Recht der irreführenden Werbung in Deutschland, Großbritannien, Frankreich. Frankfurt am Main 1999. S.20.
[6] Babett Ludwig. Irreführende und vergleichende Werbung in der Europäischen Gemeinschaft. Baden-Baden 1995. S. 76.
[7] Babett Ludwig. Irreführende und vergleichende Werbung in der Europäischen Gemeinschaft. Baden-Baden 1995. S. 78.
[8] Reese und Beer. Besonderes Wirtschaftsrecht. Stuttgart 2002. S.170.