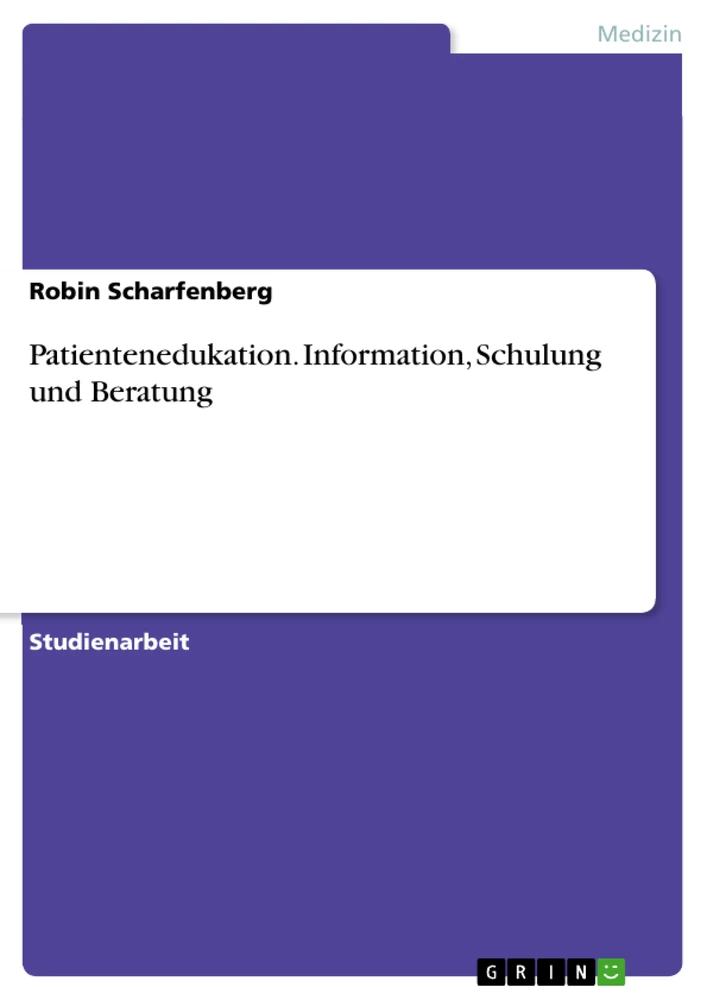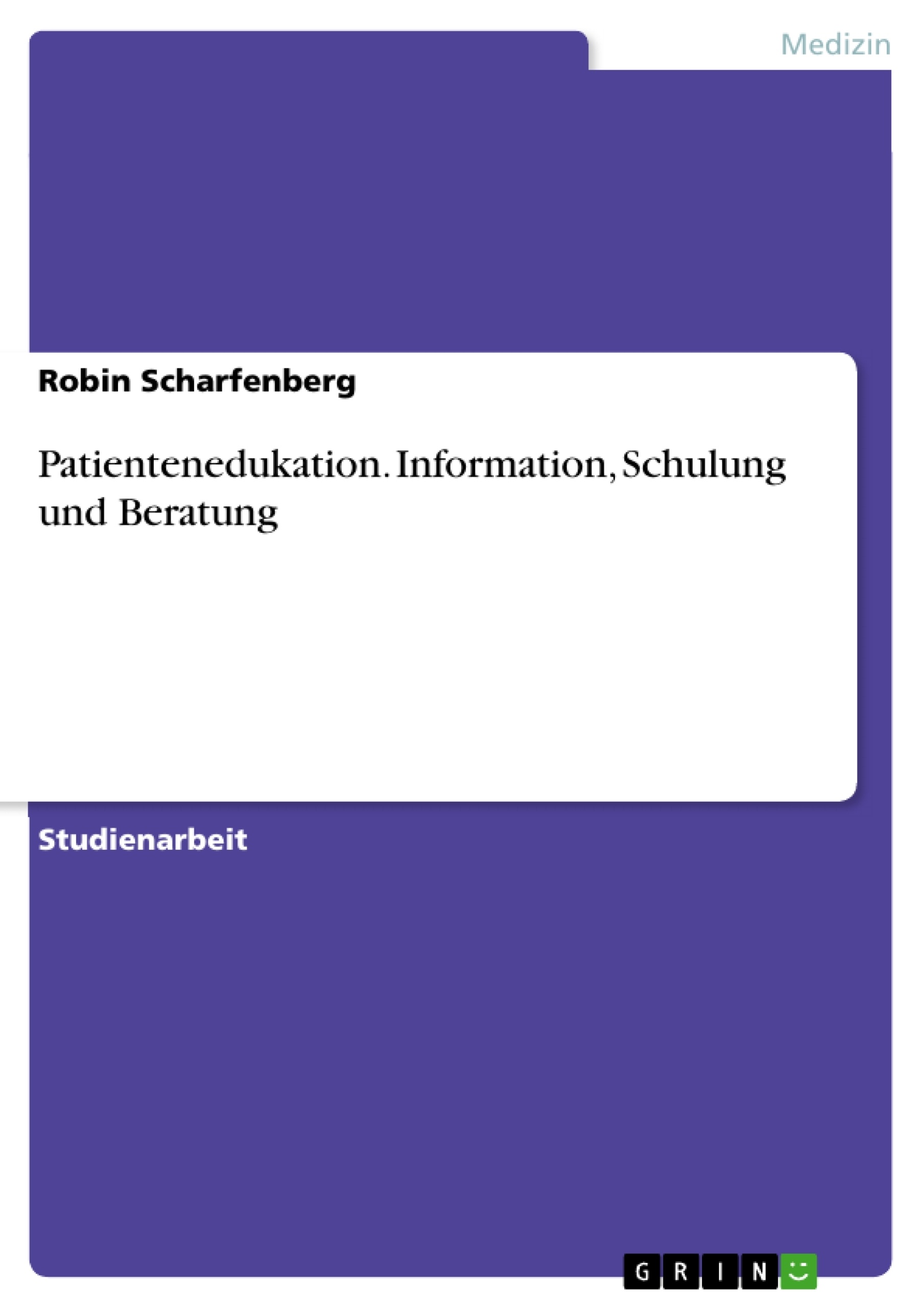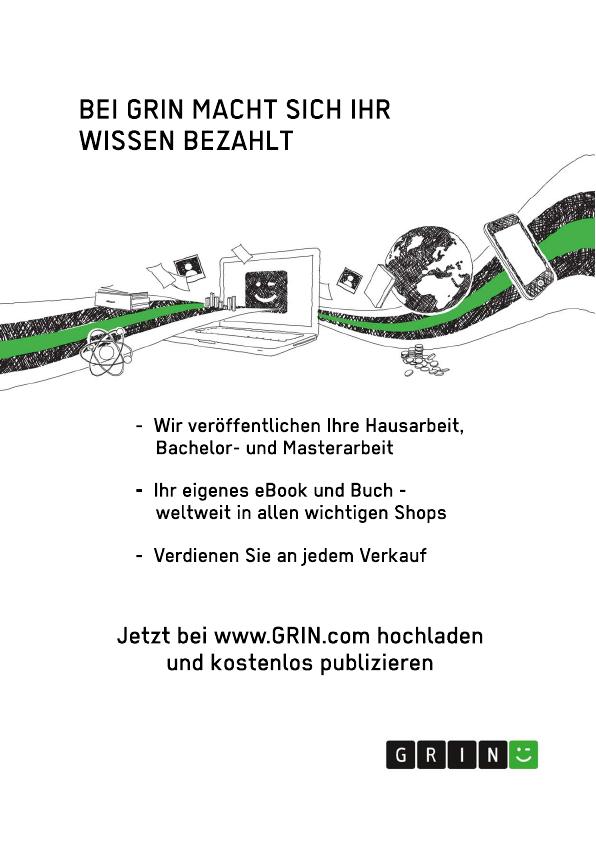Der Begriff der Edukation ist im anglo-amerikanischen Raum seit Jahren fest verankert und gehört zum Selbstverständnis der Pflegenden. Durch die lange Tradition der Akademisierung und Professionalisierung der Pflege ist die Edukation ein Kernbestandteil. Die Prämisse „Nursing is teaching“ gilt seit den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts. In Deutschland war dies lange Zeit anders. „Hands on nursing“ lautete hier die Devise. Beratende und anleitende Funktionen waren keine zentralen Aufgaben. Die Edukation war eine Domäne der Psychologen und der Verhaltensmediziner. So wurde die Medizin als zentrale Aufklärungsinstanz verstanden und die Pflege hatte in „Gesundheitsfragen“ keine eigenständige Beratungskompetenz. (Müller-Mundt, Schaeffer, Pleschberger & Brinkhoff, 2000). Neue Impulse gingen erst von der Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 1995 aus. Dies war der Anstoß zu einer Auseinandersetzung der Pflegenden mit beratenden und anleitenden Aufgaben. Durch das neue Krankenpflegegesetz im Jahr 2004 bekamen zudem die Beratung und Anleitung als zentrale Aufgaben der Pflegenden hinzu. Nach wie vor gehört jedoch die Beratung in Deutschland nicht zum pflegerischen Selbstverständnis, Gespräche und Anleitungen haben häufig einen niedrigen Stellenwert im pflegerischen Alltag.
Die Notwendigkeit einer Patientenedukation wird immer deutlicher. Die demografische Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland zeigt, dass die Zahl älterer Menschen und ihr Bevölkerungsanteil zunimmt. Dieser Alterungsprozess lässt die Anzahl von pflegebedürftigen Menschen immer mehr anwachsen. Zwischen 1999 und 2015 ist diese bereits von 2,0 auf 2,9 Millionen angestiegen. Bis zum Jahr 2060 könnte die Zahl der Pflegebedürftigen bis auf 4,8 Millionen steigen. Rund 7 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland wären dann pflegebedürftig; ein doppelt so hoher Anteil wie heute. (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, 2017). 73 Prozent aller pflegebedürftigen Menschen werden zu Hause betreut, knapp die Hälfte davon allein durch Angehörige (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, 2017).
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung
2 Patientenedukation in der Theorie
2.1 Definition
2.2 Paradigmenwechsel
2.3 Ziel
2.4 Methoden
2.4.1 Information
2.4.2 Schulung
2.4.3 Beratung
2.5 Gesetzliche Verankerung
2.6 Ablauf
3 Patientenedukation: Beispiele aus der Praxis
3.1 Patienteninformationszentrum
3.2 Broschüren
3.3 Mikroschulung
4 Fazit
Literaturverzeichnis