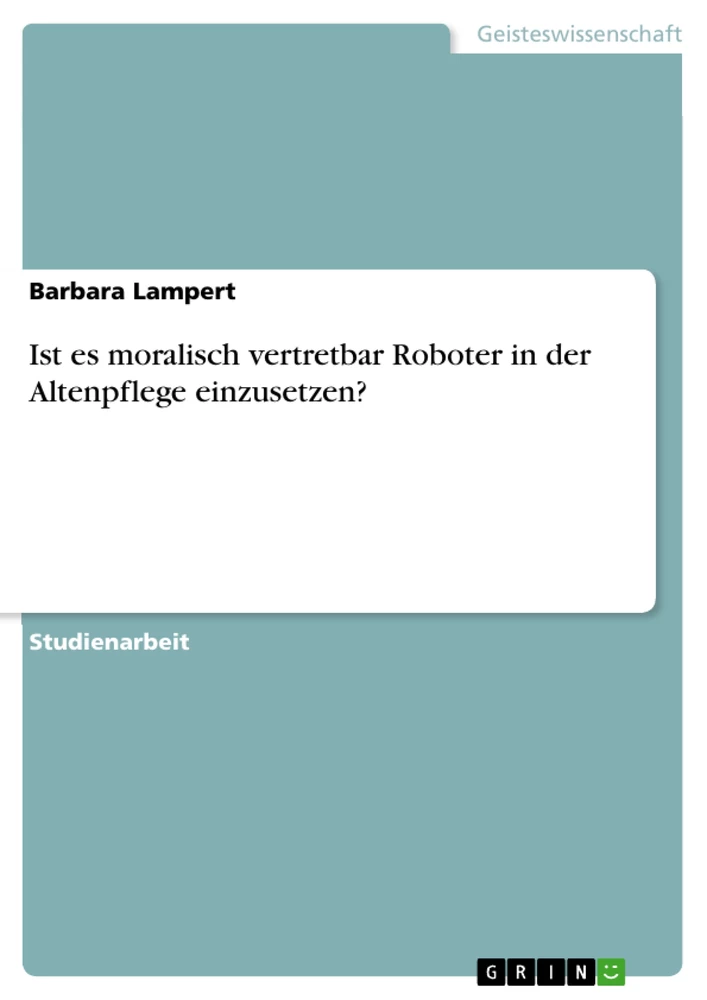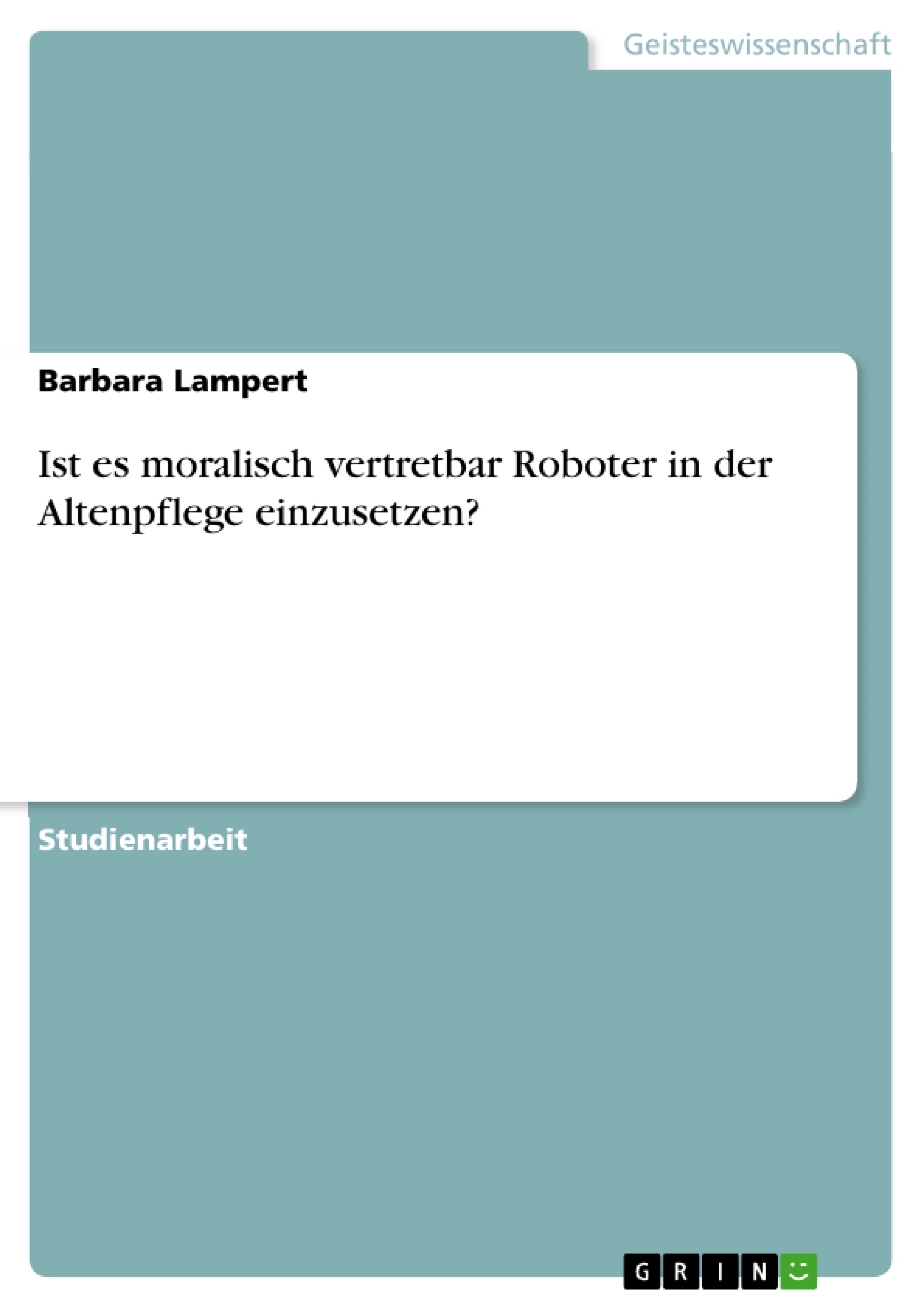In dieser Arbeit werde ich Sparrow und Sparrows Position bezüglich der Einführung von Robotern im Pflegedienst mit Misselhorn et al. vergleichen, ihre Hauptargumente herausarbeiten und kritisch reflektieren. Sparrow und Sparrow argumentieren dafür, dass mit der Einführung von Robotern nicht nur sozialer menschlicher Kontakt reduziert wird, sondern dass besonders ethisch zu bedenken sei, dass ältere Menschen getäuscht werden, da sie glauben könnten, die Interaktion zu den Robotern sei Teil der "realen" Welt. Ich werde zeigen, dass dieses Argument einer Täuschung durch Roboter nicht ethisch verwerflich ist und daher nicht ausreichend ist, um Roboter nicht in die Altenpflege zu implementieren. Des weiteren werde ich Misselhorns et al. Argument kritisieren, dass der Einsatz von Robotern am Beispiel von der Roboterrobbe "Paro" ethisch unbedenklich sei und zeigen, dass "Paro" prinzipiell nicht ethisch bedenklich sei in seiner Funktion, jedoch durchaus ethisch verwerfliche Auswirkungen beim Einsatz auftreten können, die bedacht und reflektiert werden müssen.
In vielen Teilen der Welt wächst der Anteil pflegebedürftiger älterer Menschen, gleichzeitig gibt es jedoch nicht ausreichend ausgebildete Arbeitskräfte, um den Bedürfnissen älterer Menschen gerecht zu werden. Daher drängt die Frage auf: Wie sollen wir in Zukunft mit der Pflege von alten Menschen umgehen? Aufgrund technischer Innovationen scheint es eine Lösungsmöglichkeit zu sein, spezielle "Sozialroboter" in der Altenpflege einzusetzen. Die Diskussionen um den Einsatz von Robotern in der Altenpflege reichen von dramatischen Vorstellungen eines enthumanisierten Pflegesystems, bis hin zu übermäßig optimistischen Visionen davon, dass mithilfe von Robotern gerade das erhöhte Bedürfnis von älteren Menschen erfüllt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Sparrow und Sparrow
2.1 These 1: Täuschung durch emotionale künstliche Intelligenz
2.2 These 2: Roboter sind unfähig, die Bedürfnisse älterer Menschen zu erfüllen
3. Misselhorn etal
3.1 ModifizierterFähigkeitenansatz
3.2 Kritische Auseinandersetzung mit Pflegerobotern am Beispiel von Paro
3.2.1 Wohlergehen
3.2.2 Soziale Teilhabe
3.2.3 Autonomie
4. Auswertung und Ausblick
5. Fazit