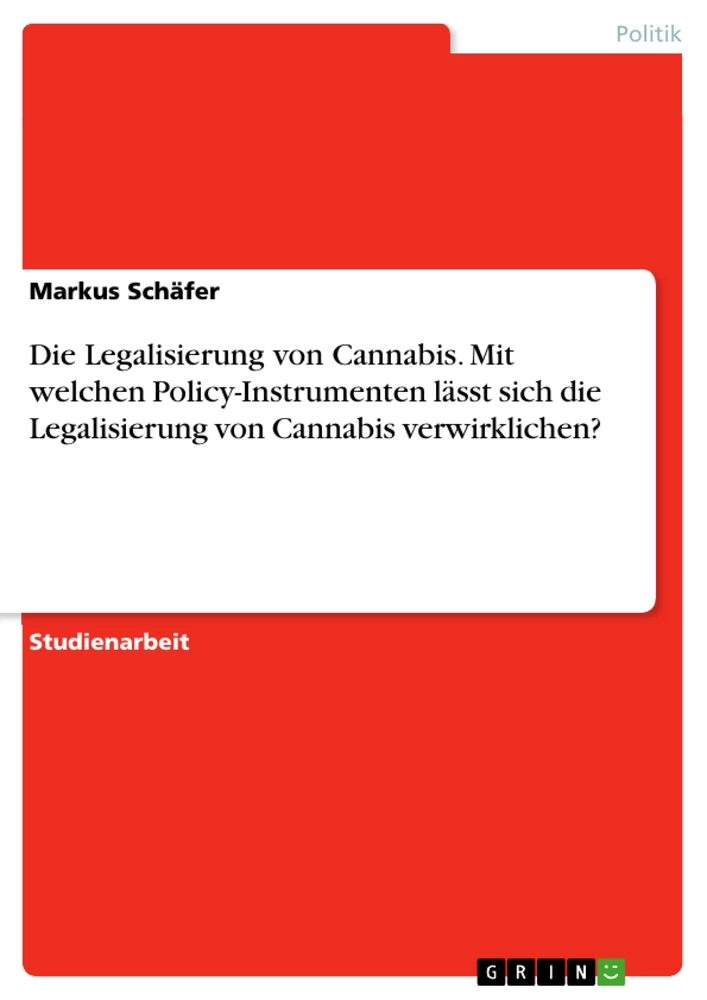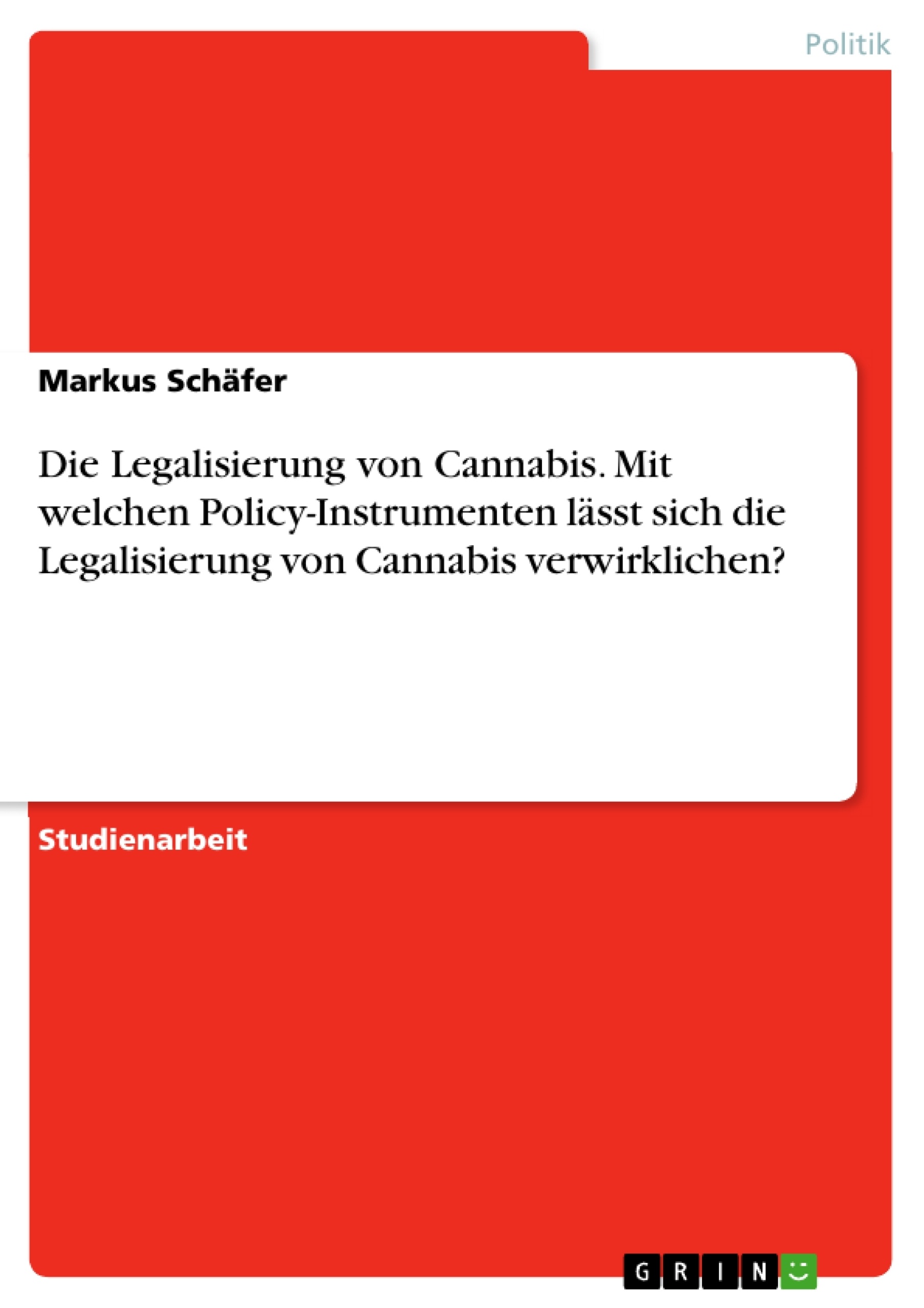"Die Legalisierung von Cannabis" diskutiert zunächst, ob eine Legalisierung der Droge als sinnvoll angesehen werden kann oder nicht. In dieser Arbeit stellt sich aber nicht die Frage, wann und durch wen eine mögliche Legalisierung durchgesetzt wird, sondern auf welche Art und Weise dies geschieht. Mit welchen politischen Instrumenten, wie zum Beispiel Gesetzen, kann eine Legalisierung von Cannabis gelingen? Aus dieser Überlegung ergibt sich folgende Forschungsfrage: Mit welchen Policy-Instrumenten lässt sich die Legalisierung von Cannabis verwirklichen? Um diese Frage zu beantworten, wird in dieser Arbeit zunächst auf die Droge Cannabis eingegangen, erläutert, was Cannabis eigentlich ist und aus welchen Gründen der Autor die Legalisierung für sinnvoll erachtet.
Die Parteien Deutschlands unterscheiden sich bezüglich ihrer Cannabispolitik ebenso wie die verschiedenen Länder in der Welt. Die CDU und die CSU im Allgemeinen verstanden in den 1990er Jahren die strafrechtliche Verfolgung als Generalprävention. In den letzten Jahren gibt es auch in den Reihen der Union mehr Befürworter einer Legalisierung oder zumindest einer Entkriminalisierung bis zu einer bestimmten Menge an Besitz. Bereits 1992 brachte die SPD einen Änderungsantrag zur Reform des Betäubungsmittelgesetzes in den Bundestag ein, da sie im Strafrecht kein geeignetes Mittel zur Bekämpfung der Drogensucht sah. Beschloss die FDP 1994 parteiintern erste Schritte zur Entkriminalisierung, ist sie heute sogar für die Legalisierung. Und auch die Partei Bündnis 90/Die Grünen sah schon 1995 die Prohibitionspolitik als gescheitert an und forderte eine Entkriminalisierung. 2015 brachten die Grünen sogar ein Cannabiskontrollgesetz (CannKG) in den Bundestag ein, welches aber von der Großen Koalition abgelehnt wurde. Unabhängig von der Tatsache, dass die Parteien verschiedene Standpunkte zur Legalisierung haben, wird dieses Thema seit Jahren einmal mehr und einmal weniger breit in der Öffentlichkeit diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Wirkung von Cannabis und seine Auswirkungen
2.1 Was ist Cannabis?
2.2 Umfragen und Statistiken
2.3 Expertenmeinungen
3. Policy-Instrumente
3.1 Gesetzesänderungen
3.2 Kampagnen und Suchthilfe
3.3 Steuern
4. Fazit
5. Anhang iv