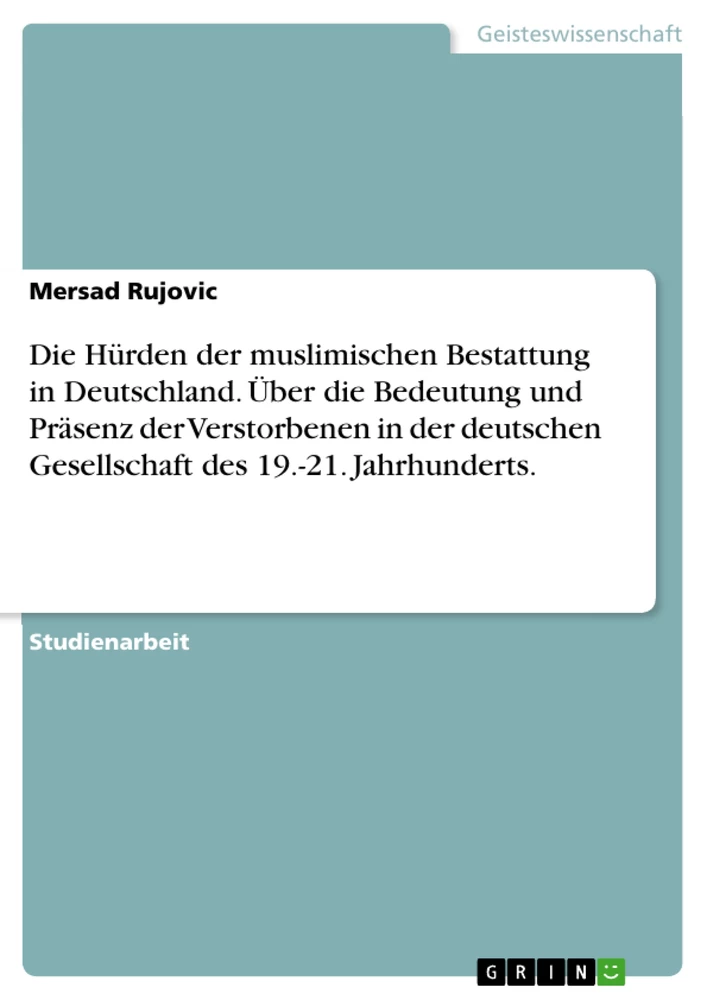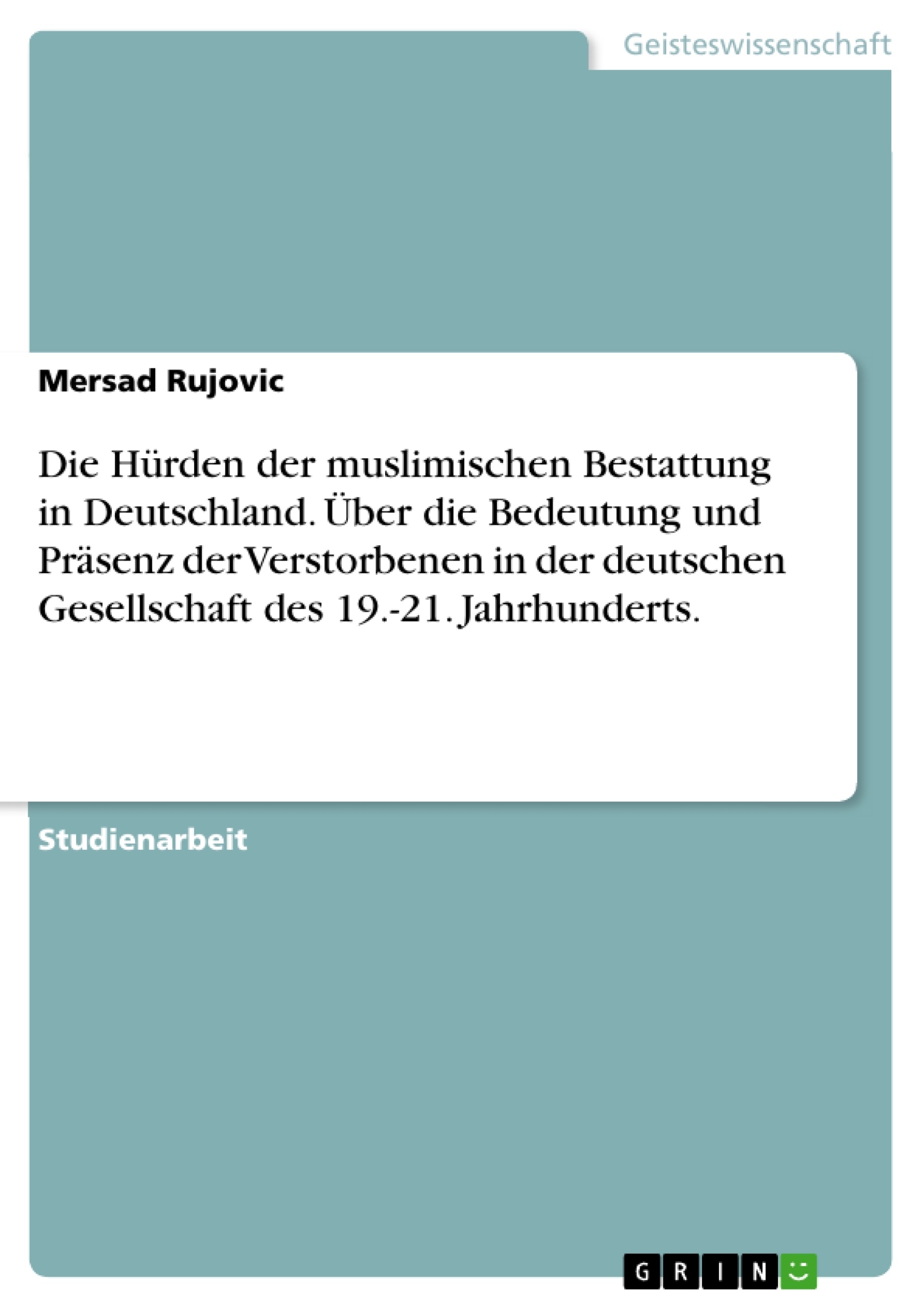Ein Problem im Zusammenleben der Religionen bezieht sich auf den Teilbereich der räumlichen Ordnung, wovon auch, und hier explizit, die Friedhöfe als Orte des Gedenkens zunehmend betroffen sind, da das veränderte Bestattungsverhalten von Muslimen bezüglich des Ortes der Beisetzung Konflikte auslösen. Dieses anwachsende Konfliktfeld ist seit jüngerer Zeit beobachtbar und hat seinen Ursprung in den religiösen Unterschieden zwischen Muslimen und der christlichen Mehrheitsgesellschaft in Deutschland. Ziel der vorliegenden schriftlichen Ausarbeitung ist es, dieses Konfliktfeld näher zu beleuchten, um darzulegen, woraus sich die Schwierigkeiten der Bestattung zwischen Muslimen und der christlichen Mehrheitsgesellschaft ergeben. In diesem Wege soll die übergeordnete Fragestellung nach den Hürden der muslimischen Bestattung in Deutschland im Kontext des erwarteten gesellschaftlichen Wandels beantwortet werden.
Die seit 1949 vom parlamentarischen Rat beschlossene Religionsfreiheit wurde vorbehaltlos in das Grundgesetz aufgenommen, womit ein besonders großer Toleranzraum für Glaubens- und Gewissensfreiheit geschaffen wurde, welcher nur unter besonderen Umständen beschränkt werden darf. Der durch das Grundgesetz geschaffene Toleranzraum zur Koexistenz religiöser Unterschiede wurde plötzlich mit Leben gefüllt, indem religiöse Minderheiten – so bspw. die türkischen Muslime – ihren Glauben tatsächlich nach Deutschland transferierten und Gebetsstätten, Vereine und sonstige Organisationen gründeten, womit also Gesellschaftsräume von religiösen Minderheiten und deren Lebensweise gestaltet und auch geprägt wurden.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Problem- und Fragestellung
2. Die begrifflichen Grundlagen
2.1 Der Tod als Ende des körperlichen Lebens
2.2 Das Ritual als Teil religiöser Konventionen
2.3 Der Friedhof als Ort der Trauer und Erinnerung
2.4 Die Funktionen der Friedhofsordnung
3. Das Zusammenleben der Religionen in Deutschland
3.1 Die multikulturelle und multireligiöse Gesellschaft
3.2 Die möglichen Ursachen für den Wandel im Bestattungsverhalten
4. Die Hürden muslimischer Bestattung in Deutschland
4.1 Die Elemente der muslimischen Bestattung
4.1.1 Die rituelle Waschung
4.1.2 Die Bestattung im Leichentuch
4.1.3 Die Bestattungsfrist
4.1.4 Das Totengebet
4.1.5 Das ewige Ruherecht
4.1.6 Der muslimische Friedhof
5. Schlussbetrachtung
5.1 Fazit
5.2 Ausblick
Literaturverzeichnis