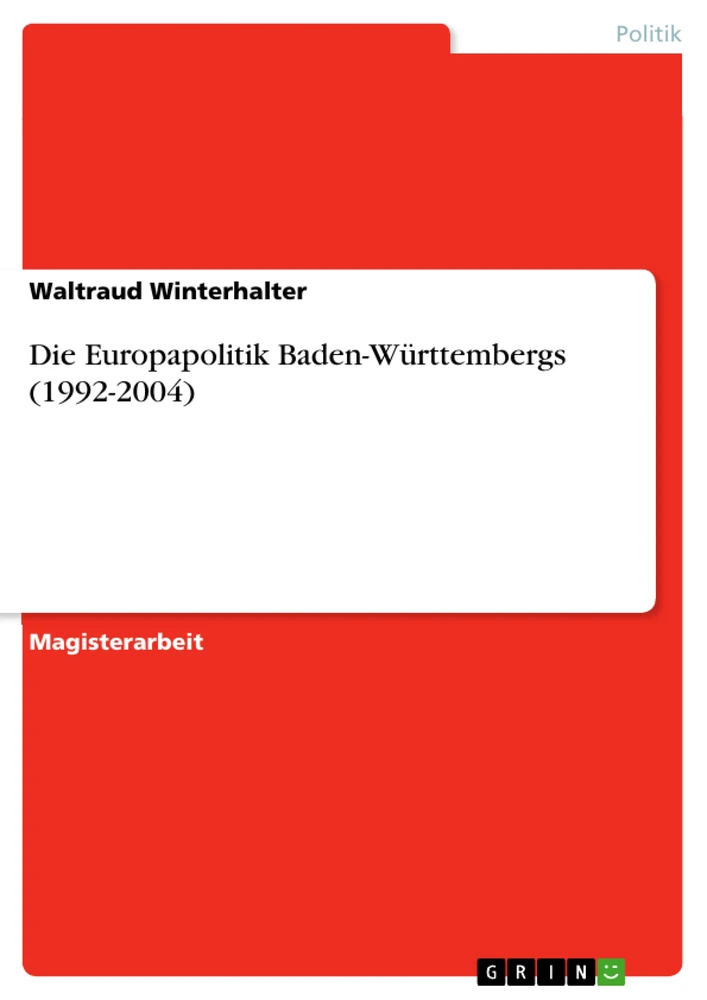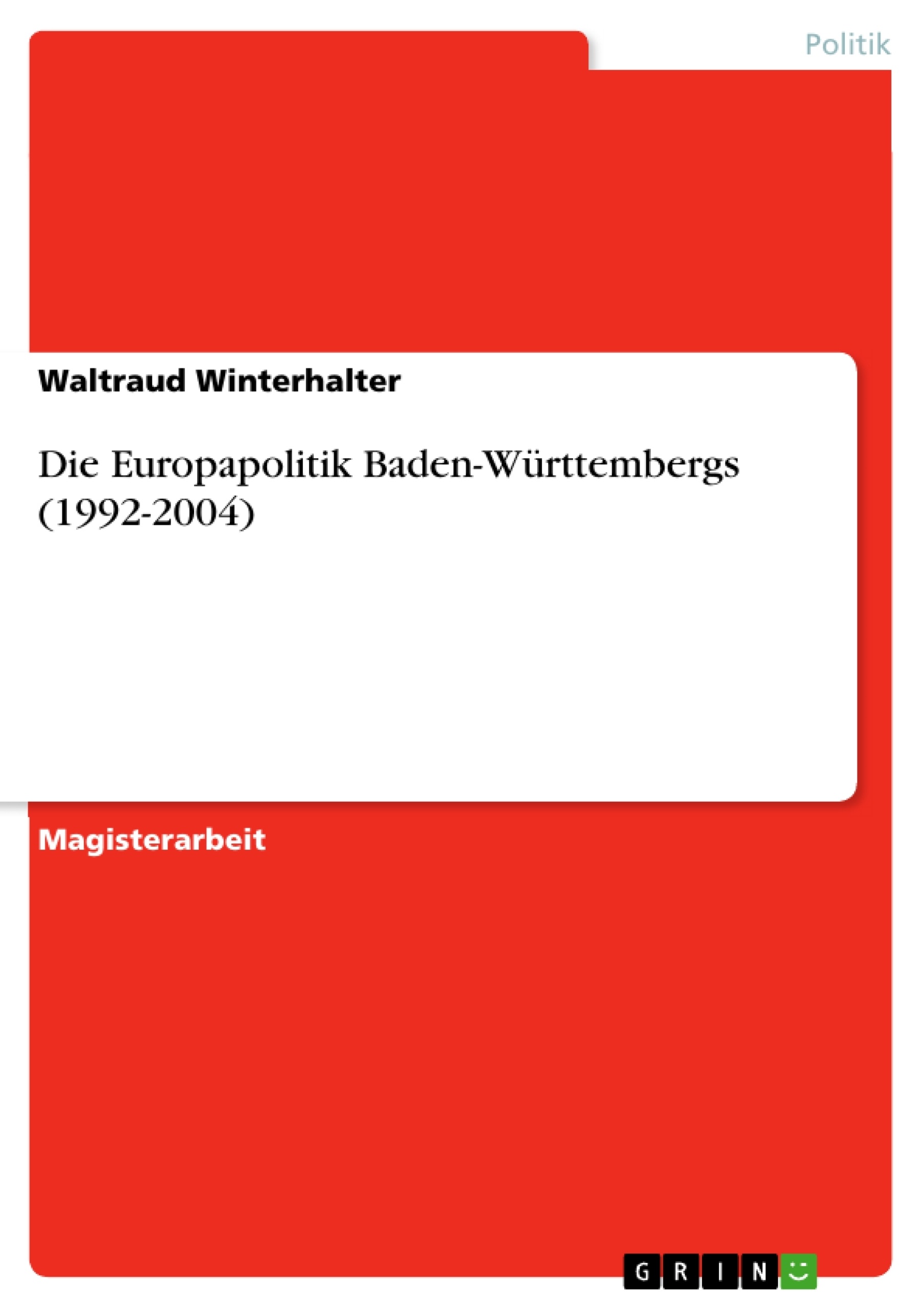Europapolitik, verstanden als Politik, die im Zusammenhang mit der Mitwirkung an europäischen Entscheidungsprozessen im Rahmen der Europäischen Union steht, lässt sich nicht auf einen Akteur oder auf eine Institution reduzieren, will man der komplexen Thematik gerecht werden. Denn wollen die Länder als subnationale Ebene ihre politische Steuerungsfähigkeit sichern, so sind sie gezwungen, sich auf die verschiedenen Ebenen des europäischen Systems einzulassen. Durch diese Interaktion vollzieht sich auch ein Wandel politischer Institutionen auf der Länderebene.
Deshalb wird im Rahmen dieser Arbeit eine Institutionenanalyse durchgeführt und der Versuch unternommen, die Aufgaben und Rechte aller an der Europapolitik beteiligter Gremien zu thematisieren und gleichzeitig zu analysieren, welchen Stellenwert die jeweilige Institution innerhalb der Politikformulierung und Meinungsbildung einnimmt, welche Wandlungsprozesse stattgefunden haben und welche Ziele innerhalb des Organs oder gemeinsam mit anderen Organen verfolgt werden.
Eine Analyse der Zielsetzungen der baden-württembergischen Landesregierung in einzelnen Politikfeldern wird im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt, da sie zur Beantwortung nachfolgend formulierter Leitfragen und der Forschungsfrage nicht beitragen könnte. Außerdem sind es nicht die spezifischen Charaktereigenschaften einer bestimmten Policy, die die Mitwirkungsmöglichkeiten und die Interaktionen der Institutionen determinieren.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
Fragestellung
Relevanz
Forschungsstand
Methodik
2. Relevante theoretische Ansätze
2.1 Integrationstheorien
2.2 Regieren im Mehrebenensystem
2.3 Politikverflechtung
2.4 Nebenaußenpolitik der Länder
3. Mitwirkungsmöglichkeiten der deutschen Länder im europäischen Mehrebenensystem Landesebene
3.1.1 Landesparlamente
3.1.2 Landesregierung
3.2 Bundesebene
3.2.1 Ländervertretungen beim Bund
3.2.2 Bundesrat
3.2.2.1 Mitwirkungsrechte bis 1992
3.2.2.2 Mitwirkungsrechte seit 1992
3.2.2.3 Bewertung der Mitwirkungsrechte
3.3 Europäische Ebene
3.3.1 Länderbeobachter
3.3.2 Länderbüros in Brüssel
3.3.3 Ausschuss der Regionen (AdR)
4. Die Europapolitik Baden-Württembergs
Das Land Baden-Württemberg
Europapolitik auf Landesebene
Mitwirkungsmöglichkeiten des Landtags von Baden-Württemberg
Europapolitische Positionen der Parteien
Die Europapolitik der Landesregierung
Länder-Länder-Kooperation
Europapolitik auf Bundesebene
Die europapolitischen Aufgaben der Landesvertretung in Berlin
Positionen im Vorfeld des Vertrages von Amsterdam
Positionen im Vorfeld der Vertrages von Nizza
Positionen in der Diskussion zur Zukunft der EU
Positionen in der Bundesstaatskommission
Europapolitik auf europäischer Ebene
Zusammenarbeit mit dem Länderbeobachter
Die Vertretung des Landes Baden-Württemberg bei der Europäischen Union
Die Bedeutung des Ausschusses der Regionen für Baden-Württemberg
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
7. Anhang
Anhang 1: Die Entwicklung europäischer Integration im Überblick
Anhang 2: Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 21.12.1992
Anhang 3: Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union vom 12.03.1993
Anhang 4: Abkommen über den Beobachter der Länder bei der Europäischen Union vom 24.10.1996
Anhang 5: Organisationsplan des Staatsministeriums Baden-Württemberg
Anhang 6: Interview mit Frau Dr. Alexandra Zoller, Leiterin Referat Europapolitik, Staatsministerium Baden-Württemberg
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
Erwin Teufel betonte wiederholt, es müsse geregelt werden, „wer für was in Europa verantwortlich“[1] sei. Dieses Zitat stammt aus einem Interview über die Ziele des Ministerpräsidenten für den Konvent zur Zukunft der Europäischen Union. Die Forderung nach einer stärkeren Abgrenzung der Kompetenzen und Aufgaben der Länder im europäischen Mehrebenensystem wird von Baden-Württemberg jedoch nicht erst seit dem Konvent, sondern schon seit Mitte der 90er Jahre verfochten und ist charakteristisch für die Europapolitik Baden-Württembergs der letzten zehn Jahre.
Zusammen mit der Untersuchung der europapolitischen Forderungen Baden-Württembergs im Zeitraum von 1992 bis 2004, soll im Rahmen dieser Arbeit auch analysiert werden, welche Mitwirkungsmöglichkeiten die an der baden-württembergischen Europapolitik beteiligten Institution besaßen.
Da ein Bundesland nicht nur auf Landesebene, sondern auch auf Bundes- und auf europäischer Ebene in die Europapolitik involviert ist, sieht man sich bei der Sichtung der Literatur über die Europapolitik der Länder[2] schnell mit Publikationen über eine Vielzahl von Organen, Gremien und Ausschüssen konfrontiert, welche allesamt an der Europapolitik der Länder mitwirken. Denn auf jeder dieser Ebenen gibt es diverse Institutionen, die an der Meinungsbildung durch formelle bzw. informelle Mitsprachemöglichkeiten beteiligt sind. Auch ist ein Bundesland nicht isoliert zu betrachten, denn sonst würde man die diversen Gremien der Länder-Länder-Kooperation und der Bund-Länder-Kooperation außer Acht lassen. Die Europapolitik der Länder findet im Rahmen des „kooperativen Föderalismus“[3] in einem ebenenübergreifenden verflochtenen System statt. Deshalb bereitet es Mühe, aus dem kaum mehr entwirrbaren Ineinander von Zuständigkeiten und Funktionen, eine klare Zuordnung politischer Kompetenzen vorzunehmen.
Nachfolgend soll versucht werden, die Beteiligungsmöglichkeiten der Länder an der Europapolitik knapp zu schildern. Eine ausführliche Untersuchung der Zuständigkeiten und Funktionen der an der Europapolitik der Länder beteiligten Institutionen liefert Kapitel 3.
Normalerweise bestimmt der Ministerpräsident zusammen mit dem Europaminister die Zielsetzung der Europapolitik. Die Landtage haben in den meisten Bundesländern die Möglichkeit, zu europapolitischen Themen eine Stellungnahme abzugeben. In der Europaministerkonferenz und der Fachministerkonferenz werden gemeinsam Standpunkte erarbeitet, die Grundlage für ein Bundesratsvotum sein können. Die Ministerpräsidenten behandeln in der Ministerpräsidentenkonferenz als hochrangigstes Gremium der horizontalen Koordination der Länderinteressen nochmals die Themen von erheblicher Bedeutung und stimmen die Positionen ab. Meistens werden die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz wortgleich als Anträge in den Bundesrat eingebracht. Im Bundesrat wird mit Mehrheit beschlossen und je nach Beratungsgegenstand müssen die Bundesratsvoten von der Bundesregierung „berücksichtigt“ oder „maßgeblich berücksichtigt“ werden. Damit ist die Kette der Länderbeteiligung jedoch längst noch nicht vervollständigt. Seit 1993 ist es möglich, dass Ländervertreter in europäischen Gremien, einschließlich des Ministerrates, Verhandlungen führen, wenn es sich um Belange handelt, die der ausschließlichen Zuständigkeit der Länder zuzurechnen sind, wie z.B. Kultur oder Innere Sicherheit. Zusätzlich zu dieser Möglichkeit werden jährlich etwa 265 Ländervertreter[4] temporär nach Brüssel in die deutsche Delegation entsandt und wirken dort bei den Verhandlungen in den Beratungsgremien des Rates und der Kommission mit. Doch noch nicht genug der Mitwirkung. In Brüssel unterhält mittlerweile jedes Bundesland ein Länderbüro, das als „Frühwarnsystem“ für die Landesregierung oder auch als „Schaufenster des Landes“ dienen soll.
Der gemeinsame Länderbeobachter unterrichtet die Länder über die Verhandlungen im Europäischen Rat und ist somit der einzige Ländervertreter, der zu diesem Gremium Zutritt hat.
Nicht vergessen werden darf der Ausschuss der Regionen (AdR), für den sich die deutschen Länder im Vorfeld der Verhandlungen zum Maastrichter Vertrag stark gemacht haben. Mit dem AdR, der aus Regional- und Kommunalvertretern besteht, war die Hoffnung verbunden, ein „Europa der Regionen“ etablieren zu können und die Mitspracherechte der Regionen und somit auch der deutschen Länder steigern zu können.
Die Analysen in dieser Arbeit erfolgen vor dem Hintergrund der Ansätze politikwissenschaftlicher Theoriebildung. Die in Kapitel 2 vorgestellten Ansätze versuchen die Entscheidungsmuster europäischer Politikformulierung aus den Strukturen des europäischen Mehrebenensystems und der Politikverflechtung heraus theoretisch einzuordnen.
Der Mehrebenenansatz[5] besagt, dass es sich bei der Europäischen Union um eine Herrschaftsordnung eigener Art (sui generis) handelt. Diese Herrschaftsordnung kann mit dem Begriff des Mehrebenensystems gefasst werden. Im Mehrebenensystem verteilen sich Handlungskompetenzen und Ressourcen zwischen öffentlichen und privaten Akteuren über mehrere territorial definierte Ebenen. Das Interesse der Forschungsrichtung fokussiert sich auf die institutionellen Konturen, seine Eigenschaften und Eigenheiten und die Bedingungen des Regierens in der EU.
Ein weiterer wichtiger Ansatz, um die Komplexität der föderalen Strukturen und in der Erweiterung die Strukturen der Europapolitik der Länder zu verstehen, ist die Theorie der Politikverflechtung von Fritz Scharpf.[6] Diese besagt, dass die Kompetenzverflechtung über unterschiedliche Ebenen hinweg, die Entscheidungsautonomie der einzelnen Ebene verhindere und in eine Politikverflechtungsfalle führe.[7]
Scharpf beschreibt die Politikverflechtungsfalle als „eine zwei oder mehr Ebenen verbindende Entscheidungsstruktur, die aus ihrer institutionellen Logik heraus systematisch (…) ineffiziente und problem-unangemessene Entscheidungen erzeugt, und die zugleich unfähig ist, die institutionellen Bedingungen ihrer Entscheidungslogik zu verändern – weder in Richtung auf mehr Integration noch in Richtung auf Desintegration“[8].
Ein zusätzlich zu berücksichtigender Aspekt bei der Analyse der Europapolitik der Länder ist der Vorwurf, die deutschen Länder betrieben eine unerlaubte „Nebenaußenpolitik“, der in den 80er Jahren von der Bundesregierung erhoben wurde.[9] Wie dieser Vorwurf begründet wurde, und wie die aktuelle Position der Bundesregierung dazu aussieht, wird im Rahmen dieser Arbeit zu erörtern sein.
Wie eben erläutert, widmet sich Kapitel 2 dieser Arbeit den theoretischen Ansätzen. Kapitel 3 bespricht die Mitwirkungsmöglichkeiten der deutschen Länder im europäischen Mehrebenensystem und beantwortet damit die im folgenden Kapitel formulierten Leitfragen. Kapitel 4 stellt den Hauptteil dieser Arbeit dar und behandelt die Europapolitik Baden-Württembergs. Die Analyse erfolgt anhand nachfolgend aufgestellter Forschungsfrage und der dazugehörigen Hypothesen. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse in einem abschließenden Fazit zusammen.
Fragestellung
Europapolitik, verstanden als Politik, die im Zusammenhang mit der Mitwirkung an europäischen Entscheidungsprozessen im Rahmen der Europäischen Union steht[10], lässt sich nicht auf einen Akteur oder auf eine Institution reduzieren, will man der komplexen Thematik gerecht werden. Denn wollen die Länder als subnationale Ebene ihre politische Steuerungsfähigkeit sichern, so sind sie gezwungen, sich auf die verschiedenen Ebenen des europäischen Systems einzulassen. Durch diese Interaktion vollzieht sich auch ein Wandel politischer Institutionen auf der Länderebene.
Deshalb wird im Rahmen dieser Arbeit eine Institutionenanalyse durchgeführt und der Versuch unternommen, die Aufgaben und Rechte aller an der Europapolitik beteiligter Gremien zu thematisieren und gleichzeitig zu analysieren, welchen Stellenwert die jeweilige Institution innerhalb der Politikformulierung und Meinungsbildung einnimmt, welche Wandlungsprozesse stattgefunden haben und welche Ziele innerhalb des Organs oder gemeinsam mit anderen Organen verfolgt werden.
Eine Analyse der Zielsetzungen der baden-württembergischen Landesregierung in einzelnen Politikfeldern wird im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt, da sie zur Beantwortung nachfolgend formulierter Leitfragen und der Forschungsfrage nicht beitragen könnte. Außerdem sind es nicht die spezifischen Charaktereigenschaften einer bestimmten Policy, die die Mitwirkungsmöglichkeiten und die Interaktionen der Institutionen determinieren.
Im Rahmen dieser Arbeit stellen sich folgende Leitfragen:
Welche Mitwirkungsmöglichkeiten besitzen die an der Europapolitik beteiligten Institutionen, wie sind sie organisiert, wie haben sie sich gewandelt, welchen Stellenwert haben sie im Mehrebenengefüge und welche Ziele werden von diesen Institutionen verfolgt?
Der Beantwortung dieser Leitfragen soll im Kapitel 3 „Mitwirkungsmöglichkeiten der deutschen Länder im europäischen Mehrebenensystem“ nachgegangen werden.
Sind diese Grundlagen geklärt, so kann der Fokus auf die Europapolitik Baden-Württembergs gerichtet werden. Hierbei stellt sich die Frage, wie Baden-Württemberg die in Kapitel 3 erläuterten Rahmenbedingungen konkret nutzt, wie es seine Institutionen organisiert, welchen Stellenwert die Landesregierung den einzelnen Institutionen beimisst und welche Ziele von den handelnden Akteuren verfolgt werden.
Für die Analyse der Europapolitik Baden-Württembergs soll folgende Forschungsfrage gestellt werden:
Wie gestaltete Baden-Württemberg seine Europapolitik hinsichtlich der institutionellen Verankerung, der Mitwirkungsmöglichkeiten der Institutionen und der politischen Zielsetzung?
Für die eben formulierte Forschungsfrage werden folgende Hypothesen aufgestellt:
Hypothese 1:
Baden-Württemberg verstärkte seine Europatätigkeit und Europafähigkeit in sämtlichen Institutionen durch den Ausbau von Planstellen für Europapolitik und durch gezielte Fortbildungsmaßnahmen. Der Stellenwert der Europapolitik hat deutlich zugenommen.
Hypothese 1 soll daran untersucht werden, ob ein Personalausbau in den Institutionen statt gefunden hat, d.h. ob neue Stellen für europäische Angelegenheiten geschaffen wurden. Weiterhin ist zu untersuchen, welcher Stellenwert der Europapolitik in den einzelnen Institutionen zukommt und welche Akteure für die Europapolitik verantwortlich sind.
Hypothese 2:
Baden-Württemberg misst der Mitwirkung über den Bundesrat im Rahmen der Europapolitik die größte Bedeutung bei und versucht, die Mitwirkungsmöglichkeiten über den Bundesrat noch zu stärken.
Zur Bestätigung von Hypothese 2 soll untersucht werden, in welchen Gremien und mit welchen Verfahren Baden-Württemberg versucht, Politikziele durchzusetzen.
Hypothese 3:
Baden-Württemberg verfolgt eine Sinatra-Strategie[11]. Im Rahmen der Sinatra-Strategie fordert Baden-Württemberg von der Europäischen Union die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips und eine eindeutige Kompetenzabgrenzung. Das Ziel, den AdR als dritte Kammer der EU auszubauen, tritt immer mehr in den Hintergrund.
Hypothese 3 wird anhand von Forderungen Baden-Württembergs zum Vertrag von Amsterdam, zum Vertrag von Nizza und zum Konvent zur Zukunft der Europäischen Union analysiert. Die Einschätzungen, Ziele und Zukunftsvisionen hinsichtlich des AdR werden anhand von Stellungnahmen des Staatsministeriums sowie anhand von Aussagen weiterer beteiligter Beamter untersucht.
Es werden folgende Ergebnisse erwartet:
Baden-Württemberg verstärkte seine Europatätigkeit seit 1992 kontinuierlich. Mittlerweile ist der Personalaufbau in den meisten Institutionen abgeschlossen. Die Anstrengungen, die Europafähigkeit des Landes zu verbessern, werden weiter vorangetrieben. Der Stellenwert der Europapolitik nahm kontinuierlich zu und gipfelte in der Teilnahme Erwin Teufels als Vertreter des Bundesrates im Europäischen Konvent.
Die Beteiligungsmöglichkeiten über den Bundesrat sind im Rahmen der Europapolitik Baden-Württembergs prioritär und sollen weiter ausgebaut werden. Durch die Mitwirkung an der Europapolitik über Art. 23 GG im Bundesrat hat Baden-Württemberg die größten Einflussmöglichkeiten auf die Entscheidungsprozesse auf europäischer Ebene.
Baden-Württemberg wird das Ziel nicht aus dem Auge lassen, weiter die strikte Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips von der EU zu fordern.
Das Ziel der eindeutigen Kompetenzabgrenzung zwischen den Kompetenzen der EU und den Befugnissen der Mitgliedstaaten bzw. der Regionen wird von Baden-Württemberg vehement weiterverfolgt. Außerdem wird versucht, den Wettbewerbsföderalismus unter den deutschen Ländern sowie unter den europäischen Regionen zu etablieren.
Der Ausschuss der Regionen soll zwar ausgebaut werden, doch ist man sich intern durchaus einig, dass diesem Gremium ein eher symbolischer Wert für Baden-Württemberg zukommt. Eine wirkungsvolle Vertretung baden-württembergischer Interessen ist über den Ausschuss der Regionen nicht möglich.
Relevanz
In der wissenschaftlichen Literatur wird, insofern die Europapolitik der Länder aufgefächert wird, immer von den „großen Drei“ der deutschen Europapolitik gesprochen, die den Ton angeben und auch ab und an Alleingänge starten. Dabei handelt es sich um die Flächenstaaten Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Für Bayern liegt bereits eine Studie von Martin Hübler mit dem Titel „Die Europapolitik des Freistaates Bayern“ vor, allerdings mit einer anderen Akzentuierung. Ihm geht es bei seiner Dissertation weniger um die Einbeziehung sämtlicher an der Europapolitik beteiligter Institutionen in die Analyse, sondern darum, „wie Bayern auf die verschiedenen Etappen der europäischen Integration reagiert und welche Interessen seine Europapolitik von 1986 bis 1998 leiteten“[12]. Nordrhein-Westfalen zeigte sich in seiner Auskunftsbereitschaft, sei es auf Internetseiten der einzelnen Institutionen oder von Seiten der Mitarbeiter, wenig entgegenkommend, was eine Einbeziehung Nordrhein-Westfalens in diese Studie unmöglich machte.
Für die Auswahl Baden-Württembergs als Untersuchungsobjekt spricht, dass das Land als nach Fläche und Einwohnerzahl drittgrößtes Bundesland, in ungefähr 70% der Fälle die Bund-Länder-Koordination für die Europapolitik übernimmt. Deshalb ist davon auszugehen, dass Baden-Württemberg ein Vorreiter in der Themensetzung für die Europapolitik der deutschen Länder ist und die Europapolitik einen hohen Stellenwert für das Land einnimmt.
Außerdem kann der Faktor Ministerpräsident für den gesamten Untersuchungszeitraum konstant gehalten werden, da Erwin Teufel (CDU) seit 1991 Ministerpräsident von Baden-Württemberg ist. Er regierte von 1992 bis 1996 in einer großen Koalition, und seit 1996 zusammen mit der FDP/DVP. Die große Koalition von 1992 bis 1996 stellt für die Untersuchung insofern keinen Störfaktor dar, als die Europapolitik gouvernemental geprägt ist und vom baden-württembergischen Staatsministerium gesteuert wird. Da die CDU, vom ersten Ministerpräsidenten Reinhold Maier (FDP) abgesehen, seit 1953 alle Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg stellte, und das Staatsministerium dem Ministerpräsidenten untersteht, ist davon auszugehen, dass das Staatsministerium über einen langen Zeitraum hinweg konservativ geprägt wurde. Von daher ist anzunehmen, dass im Staatsministerium während der Zeit der großen Koalition keine abweichende Europapolitik betrieben wurde. Außerdem herrscht beim Thema Europa ohnehin eine große Einigkeit unter den Landesparteien. Wesentlicher als Parteipolitik, sind für die erfolgreiche Partizipation an der Europapolitik die Faktoren Wirtschaftskraft, Finanzkraft, handelnde Akteure sowie die Fähigkeit zur europapolitischen Interaktion eines Landes.
Forschungsstand
Die Literatur zum Thema Europapolitik Baden-Württembergs ist sehr dünn gesät. Eine Untersuchung der Europapolitik Baden-Württembergs mit oben beschriebener Zielsetzung liegt bislang nicht vor. In dem Band „Baden-Württemberg und seine Partnerregionen“ findet sich ein Aufsatz von Claus-Peter Clostermeyer über „Die Europapolitik Baden-Württembergs“, der alle beteiligten Institutionen und Beteiligungsmöglichkeiten knapp beschreibt und zusätzlich auf die grenzüberschreitende, interregionale und transnationale Zusammenarbeit eingeht.[13] Bei dieser Darstellung wird jedoch auf die politischen Forderungen Baden-Württembergs und die Entwicklung der Institutionen im Zeitverlauf nicht eingegangen.
Eine Dissertation von Roland Johne beschäftigt sich mit den deutschen Landtagen im Entscheidungsprozess der Europäischen Union und geht dabei vertieft auf die Landtage von Baden-Württemberg und Hessen ein.[14] Die Dissertation von Petra Zimmermann-Steinhart vergleicht anhand der Politikfelder Wettbewerbspolitik, Umweltpolitik und Forschungs- und Technologiepolitik die Regionen Baden-Württemberg und Rhône-Alpes.[15]
Es werden also einzelne Institutionen oder Politikfelder durchaus herausgegriffen und vergleichenden Studien unterzogen, eine Untersuchung sämtlicher institutioneller Rahmenbedingungen in einem gegebenen Zeitraum fehlt jedoch bislang.
Die mangelhafte Literaturlage erschwerte die Recherchen und machte es nötig, die meisten Informationen, die sich auf Baden-Württemberg beziehen, über Primärquellen zu recherchieren.
Als wichtige Primärquelle erwies sich der vom Staatsministerium herausgegebene „Bericht über die Europapolitik der Landesregierung“, der aufgrund einer Vereinbarung mit dem Landtag von Baden-Württemberg seit 1995 jährlich dem Landtag zugeleitet wird. Eine weitere Fundgrube waren Antworten des Staatsministeriums auf Anfragen von Landtagsabgeordneten zum Thema Europapolitik oder Positionspapiere der Landesregierung. Weiterhin wurden Beschlüsse der Europaministerkonferenz und Beschlüsse des Bundesrates zu europapolitischen Themen ausgewertet. Aufschlussreich waren Regierungserklärungen, Reden und Stellungnahmen des Ministerpräsidenten Teufel, des Ministers im Staatsministerium und für europäische Angelegenheiten, Dr. Christoph Palmer, sowie Auskünfte von Mitarbeitern der an der Europapolitik Baden-Württembergs beteiligten Institutionen.
Dank der umfangreichen Informationspolitik des Landes Baden-Württemberg konnten auf den Internetseiten der beteiligten Institutionen einführende Informationen zu deren Aufgaben und der jeweiligen Organisationsstruktur gefunden werden.
Nachfolgend sollen einige Publikationen vorgestellt werden, die einen ersten Überblick über das weite Feld der europäischen Föderalismusforschung liefern.
Die Materialien des Europäischen Zentrums für Föderalismus-Forschung (EZFF) in Tübingen erwiesen sich bei der Behandlung vieler Aspekte als hilfreich. Vom EZFF werden „Occasional Papers“ zu aktuellen europapolitischen Themen veröffentlicht und auch seit dem Jahr 2000 ein Jahrbuch des Föderalismus herausgegeben, das wesentliche neue Forschungen aufgreift, Politiker ihre Standpunkte vertreten lässt und Studien über den Föderalismus in den einzelnen EU-Ländern vorstellt.
Weiterhin von Bedeutung waren die Publikationen des Tübinger Professors und Leiters des EZFF, Rudolf Hrbek, der die Europapolitik der Länder seit ihren Anfängen Mitte der 80er Jahre wissenschaftlich begleitet.
Für die Entwicklung der Sinatra-Strategie in Bezug auf die deutschen Länder sei auf den Aufsatz “From Cooperative Federalism to a ‘Sinatra Doctrine’ of the Länder?”[16] von Charlie Jeffery und auf die Ausarbeitung von Michèle Knodt „Europäisierung à la Sinatra: Deutsche Länder im europäischen Mehrebenensystem”[17] hingewiesen.
Weitere verwendete wissenschaftliche Aufsätze und Monographien finden im Verlauf der Arbeit ihre Würdigung und können den Angaben in den Fußnoten und im Literaturverzeichnis entnommen werden.
Die Fundstellen in der Berichterstattung der Presse waren eher dürftig, da der Europapolitik der Länder in regionalen und überregionalen Zeitungen keine große Bedeutung beigemessen wird.
Methodik
Bei der Untersuchung wurde ein Methoden-Mix aus qualitativen Methoden angewandt. Dabei wurden Primärquellen, wie Europaberichte, Landtags- und Bundesratsdrucksachen, Reden und Regierungserklärungen analysiert. Ein ebenso wichtiger Bestandteil war die Analyse der Sekundärquellen wie Monographien und wissenschaftliche Aufsätze. Aufgrund der unzureichenden Literaturlage für Baden-Württemberg war eine eigene Aufarbeitung notwendig. Durch qualitative Interviews konnten wichtige Informationen, vertiefende Einblicke über den Stellenwert der Europapolitik sowie aufschlussreiche Selbsteinschätzungen der eigenen Rolle der Beteiligten gewonnen werden.
Interviews wurden mit Akteuren folgender Institutionen geführt:
Ausschuss der Regionen, Brüssel
Landtag von Baden-Württemberg, Stuttgart
Staatsministerium Baden-Württemberg, Stuttgart
Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund, Berlin
Vertretung des Landes Baden-Württemberg bei der Europäischen Union, Brüssel
Bei den offenen Interviews orientierten sich die Fragen an den formulierten Hypothesen. Somit interessierten die Aufgaben und die Organisation der Institutionen, die Selbsteinschätzung über den Stellenwert der Institution im Mehrebenensystem, die Zufriedenheit mit den Mitwirkungsmöglichkeiten sowie die Zielsetzungen.
Im Anhang ist das Interview mit Frau Dr. Alexandra Zoller, Leiterin Referat Europapolitik des baden-württembergischen Staatsministeriums, nachzulesen. Die restlichen Interviews können aufgrund von Absprachen mit den Interviewpartnern nicht abgedruckt werden. Die erhaltenen Informationen werden anonym zitiert.
2. Relevante theoretische Ansätze
2.1 Integrationstheorien
Neofunktionalismus und Intergouvernementalismus waren von der Forschungsfrage geleitet, weshalb es überhaupt zur Integration souveräner Staaten kommt und welche Faktoren diesen Prozess vorantreiben.
Der Neofunktionalismus versuchte die Integration als Folge funktionaler Sachzwänge zu erklären, da die Probleme pluralistisch verfasster Industriegesellschaften nur noch akteursübergreifend zu lösen seien. Nach der Logik des Neofunktionalismus werden zunächst unpolitische Teilbereiche („Low Politics“) vergemeinschaftet. Erfolgreiche Lösungsansätze greifen auf weitere Teilbereiche über, schwappen dann in politische Bereiche („High Politics“) über und führen schrittweise zu deren Integration. Dieses „Überschwappen“ in die politischen Bereiche wird als als „Spill-over-Effekt bezeichnet“.[18]
Die Intergouvernementalisten erklärten den Zusammenschluss von Staaten als Zweckverband zur Bearbeitung spezifischer Kooperationsaufgaben. Staaten kooperieren beispielsweise zur Reduzierung der Transaktionskosten und zur Erzielung von Kooperationsgewinnen. Kooperation findet nur dann statt, wenn sich die Interessen der Beteiligten decken oder wenn sie ihre Interessen in einer Serie von Abkommen ausgleichen können. In dieser realistischen Sichtweise stellt die Europäische Gemeinschaft lediglich eine Organisation zur Koordination von Staateninteressen dar, in der die Souveränität der Nationalstaaten nicht etwa überwunden, sondern gemeinsam ausgeübt wird. Die Mitgliedstaaten bleiben nach Ansicht der Intergouvernementalisten die entscheidenden Akteure im Integrationsprozess und behalten die Kontrolle über die institutionelle Entwicklung in der Hand.[19]
Beide Ansätze, der Neofunktionalismus und der Intergouvernementalismus, versuchen die Integration mit einer einzigen Interaktionebene, nämlich der der Nationalstaaten, zu erklären. Dabei vernachlässigen diese Ansätze die Möglichkeit transnationaler Beziehungen auf Interaktionsebenen unterhalb des Nationalstaates völlig. So werden die entstandenen Politiknetze oder die Interessenvertretungen subnationaler Akteure in der Analyse nicht berücksichtigt.
2.2 Regieren im Mehrebenensystem
In der politikwissenschaftlichen Europaforschung hat in den letzten Jahren ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Dieser führte weg von den Forschungsansätzen des Neofunktionalismus und des Intergouvernementalismus und hin zu neueren Ansätzen, für die sich die Begriffe „Regieren im Mehrebenensystem“ bzw. „multilevel governance“ etabliert haben.
Ein Aspekt des Paradigmenwechsels betrifft die Fragen nach der Erscheinungsform des Staatengefüges „Europäische Union“. Weder ist diese Modell mit den Konzepten des föderalen Bundesstaates vereinbar noch mit denen des Staatenbundes. Vielmehr setzt sich die Auffassung durch, die Union als ein Gebilde eigener Art (sui generis) zu sehen, in dem sich die europäische (supranationale), die nationalstaatliche und die regionale sowie kommunale (subnationale) Ebene zunehmend verschränken und zivilgesellschaftliche Akteure in Verhandlungs- und Kommunikationsnetzwerken in verstärktem Maße an politischen Steuerungsprozessen beteiligt werden.[20] So spricht denn auch das Bundesverfassungsgericht in seinem „Maastricht-Urteil“ von einem „Staatenverbund“.
Bei den „Mehrebenenansätzen“ werden weniger die Ursachen der Integration untersucht, als vielmehr die Folgen des Integrationsprozesses analysiert. Die Erklärungsansätze entfernen sich so von der reinen Lehre der Internationalen Politik und mischen sich mit Ansätzen aus der Vergleichenden Regierungslehre. Denn auf europäischer Ebene wird regiert und aus dieser Tatsache heraus müssen die Institutionen und Verfahren auf die Regierungstätigkeit hin untersucht werden.
Bei der Bestimmung konstitutiver Merkmale des europäischen Mehrebenensystems lassen sich aus der dazu vorliegenden Literatur unterschiedliche Herangehensweisen eruieren. Zum einen lässt sich ein funktionales Verständnis von Mehrebenensystemen von einem institutionellen abgrenzen. Das institutionelle Verständnis von Mehrebenensystemen wurde vor allem in Forschungsarbeiten zur europäischen Regionalpolitik vertreten.[21] Nach diesem Verständnis lassen sich zwar mehrere institutionelle Handlungsebenen identifizieren (Europäische Union, Nationalstaaten, Regionen, Kommunen) und auf ihren je spezifischen Beitrag zum Entscheidungsprozess und der Implementation europarechtlicher Bestimmungen befragen, der Akteursstatus der handelnden Subjekte erfährt jedoch keine Berücksichtigung. Auch werden so Interdependenzbeziehungen zwischen den einzelnen Akteuren auf den unterschiedlichen Ebenen nicht hinreichend in die Darstellung einbezogen. Demnach fördert dieses Verständnis eine eher undifferenzierte Betrachtungsweise und erfasst in nicht ausreichendem Maße die Vielgestaltigkeit der Kommunikationsbeziehungen in einem Mehrebenensystem.[22]
Erst durch ein funktionales Verständnis von Mehrebenensystemen lässt sich die reale Komplexität europäischer Politikprozesse angemessen begreifen. Ein Mehrebenensystem in diesem Sinne konstituiert sich aus formal unabhängigen, aber funktional interdependenten politischen Akteuren und Politikarenen und ermöglicht so auch Formen der „horizontalen Politikverflechtung“.
In einem solchen Mehrebenensystem gibt es supranationale Kooperationsbeziehungen zwischen Akteuren der intragemeinschaftlichen Ebene. Dies sind die verschiedenen Organe der EU.
Wenn nationale Akteure in supranationalen Entscheidungsgremien, wie dem Rat der Europäischen Union, zusammenkommen, so stellt dies die internationale Kommunikationsarena dar. So wirkt der Bundesrat als Vertreter der Bundsländer an der Entscheidung über die Position der Bundesrepublik als Mitgliedstaat mit.
Neben den intragemeinschaftlichen und den internationalen Verhandlungsgremien bilden die intersubnationalen Organe, wie der Ausschuss der Regionen, einen weiteren Bereich. Nationale Akteure handeln auf der intranationalen Ebene. In den nationalen Entscheidungsgremien werden die jeweiligen Standpunkte zu europäischen Politiken ermittelt.
Die Beteiligung der Bundesländer über den Bundesrat als Form der Mitwirkung regionaler Akteure auf der nationalen Ebene ist eine weitere Form der Kooperationsbeziehungen innerhalb des europäischen Mehrebenensystems.
Vielfältige Kooperationsbeziehungen zwischen den deutschen Ländern, z.B. in der Europaministerkonferenz, sichern die Einheitlichkeit des Standpunktes der auf der nationalen Ebene involvierten regionalen Akteure in den intraregionalen Beziehungen.[23]
Das Merkmal des europäischen Mehrebenensystems ist somit die komplexe Verflechtung der oben dargestellten Ebenen. Sie agieren nicht autonom, sondern zeichnen sich durch Vernetzungen und Kooperationsbeziehungen vielfältiger Art aus. Hinzu kommen Akteure der unterschiedlichsten Interessenverbände und Organisationen.
Da Mehrebenensysteme über eine weit größere Anzahl von „Schnittstellen“ zwischen autonomen Organisationen und Institutionen als hierarchisch strukturierte Systeme verfügen, erhöht sich der Koordinationsbedarf staatlicher Politik in Mehrebenensystemen immens.[24]
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein Mehrebenensystem ein politisches System darstellt, in dem Akteure und Institutionen von unterschiedlichen territorialen und funktionalen Einheiten interagieren. Die Kompetenzbereiche der Akteure beziehen sich nicht nur auf eine Ebene, sondern können auf subnationaler, nationaler und supranationaler Ebene verankert sein. Die Handelnden versuchen, allgemein verbindliche Entscheidungen zu treffen. Die Folgen der Entscheidungen betreffen das gesamte EU-System. Das Mehrebenensystem umfasst zum einen eine vertikale und horizontale Politikverflechtung zwischen verschiedenen staatlichen Einheiten und Ebenen. Zum anderen gibt es diverse sektoral organisierte Interessengruppen, die in Organisationen, Verbänden und anderen gesellschaftlichen Gruppierungen organisiert sind und so im Mehrebenensystem mitwirken.
2.3 Politikverflechtung
Fritz W. Scharpf sieht die institutionelle Besonderheit der Europäischen Union in der Tatsache begründet, dass es sich dabei um ein verflochtenes Mehrebenensystem handelt. Um ein solches nicht-hierarchisches interdependentes Mehrebenensystem zu beschreiben, hat Scharpf den Begriff der Politikverflechtung geprägt und auf die europäische Politik angewandt.[25]
Politikverflechtung bedeutet, dass der Politikprozess, der die Entscheidungsfindung, Planungsvorgänge und Implementationsvorgänge beinhaltet, in einem komplexen Verbund von mehreren territorialen Einheiten durchgeführt wird. Die Zuständigkeiten der verschiedenen Einheiten sind über unterschiedliche Ebenen verteilt. Die durch die Kompetenzverflechtung zwischen den einzelnen Ebenen verhinderte Entscheidungsautonomie der einzelnen Ebenen führt in eine Politikverflechtungsfalle.[26] Scharpf beschreibt die Politikverflechtungsfalle als „eine zwei oder mehr Ebenen verbindende Entscheidungsstruktur, die aus ihrer institutionellen Logik heraus systematisch (…) ineffiziente und problem-unangemessene Entscheidungen erzeugt, und die zugleich unfähig ist, die institutionellen Bedingungen ihrer Entscheidungslogik zu verändern – weder in Richtung auf mehr Integration noch in Richtung auf Desintegration“[27]. Das Politikverflechtungssysstem führt wegen der zeit- und arbeitsaufwendigen Abstimmungsprozesse zwischen den Ebenen zu mangelnder Effizienz und zur Einengung des Gestaltungsspielraums durch die Koordinierung mit den anderen Verhandlungspartnern. Eine weitere Folge des Verbundsystems ist die Vermischung der Verantwortung aufgrund der fehlenden Möglichkeit, politische Verantwortung den Entscheidungsträgern zuzuordnen und die daraus resultierende mangelnde Transparenz der Politikprozesse. Außerdem lässt sich eine Tendenz zur Entparlamentarisierung feststellen, da nur die Exekutiven von Bund und Ländern an dem Entscheidungssystem beteiligt sind.[28] Die Folgen eines verflochtenen Entscheidungssystems liegen dementsprechend in der langwierigen Entscheidungsfindung, in den suboptimalen Entscheidungsergebnissen und der schwerfälligen administrativen Umsetzung der Entscheidungen.[29] Solange ein Verhandlungspartner gegen die Beschlussfassung stimmt, kann die veraltete Regelung nicht neu gestaltet werden oder eine Regelung zur Lösung eines neuen Problems nicht eingeführt werden.
Die Mitgliedschaft der föderalen Bundesrepublik in einem internationalen Integrationssystem führt zur doppelten Politikverflechtung.[30] Scharpf verknüpft den Begriff der doppelten Politikverflechtung mit der These, dass „die institutionellen Strukturen der Europäischen Gemeinschaft suboptimale Politik-Ergebnisse systematisch begünstigen“[31]. Es bestehe die Gefahr, dass die größere Gemeinschaft durch Schwierigkeiten der Konsensbildung handlungsunfähig wird. Die Konsensbildung wird durch das Einstimmigkeitsprinzip, welches den institutionellen Eigeninteressen ihrer Gliedstaaten entspricht, auf EG-Ebene erschwert. Unter sonst gleichen Bedingungen müsste die Problemlösungsfähigkeit der Europäischen Gemeinschaft hinter der von Einzelstaaten zurückfallen.[32]
Scharpf macht für seine Theorie der Politikverflechtung jedoch Einschränkungen in Bezug auf die Generalisierbarkeit. Die Politikverflechtungsfalle entstehe nur unter der Bedingung von Zwangsverhandlungen, d.h. nur dann, wenn die Akteure entweder aus eigenen Interessen oder durch institutionelle Regeln kooperative Lösungen gegenüber autonomen Entscheidungen vorziehen. Nur wenn keine alternativen Entscheidungsstrukturen oder –verfahren existieren, auf die im Falle einer drohenden Entscheidungsblockade im Verhandlungssystem zurückgegriffen werden kann, treten die in der Theorie der Politikverflechtung beschriebenen fatalen Folgen auf.[33]
Arthur Benz versucht in seinem 1998 erschienen Aufsatz „Politikverflechtung ohne Politikverflechtungsfalle – Koordination und Strukturdynamik im europäischen Mehrebenensystem“, die Theorie der Politikverflechtung weiter zu entwickeln. Dabei geht er im Besonderen auf den Zusammenhang von Verflechtungsstrukturen und institutioneller Dynamik ein. Seine Hypothese lautet, dass Mehrebenensysteme, wie sie in raumbedeutenden Politikfeldern der EU vorhanden sind, grundsätzlich wenig anfällig für Politikverflechtungsfallen sind.[34] Das Auftreten von Blockaden der Kooperation und Koordination kann hier nicht nur durch Konflikt vermeidende Entscheidungen, sondern auch durch Differenzierung und Variabilität von lose gekoppelten Strukturen verhindert werden. Er versucht zu zeigen, dass im europäischen Mehrebenensystem Strukturierungsprozesse feststellbar sind, die gegen das Auftreten von Politikverflechtungsfallen sprechen. Indikatoren dafür sind Veränderungen regionaler Politikstrukturen sowie Differenzierungsprozesse zur Bewältigung von Entscheidungskosten und des Koordinationsbedarfs, die im Prozess der Integration der regionalen Ebene in das europäische Mehrebenensystem erforderlich sind.[35]
Die eigentliche Politikkoordination in der europäischen Mehrebenenverflechtung laufe zwischen Regionen, Nationalstaat und EU verstärkt über bi- oder trilaterale Beziehungen ab. Zwischen diesen Ebenen existierten eine Vielzahl an vertikalen Verhandlungssystemen, jedoch kein multilaterales Verhandlungssystem. Diese horizontale Differenzierung der Mehrebenenstrukturen führe zu einer erheblichen Reduktion des Konfliktniveaus in den politischen Prozessen.[36] Benz folgert in seiner Analyse, dass die Ausdehnung von Strukturen der Politikverflechtung auf drei oder vier Ebenen nicht zur Verringerung der Regierbarkeit führen muss. Sie enthalte zwar genügend Fallen, in welche die Politik hineingeraten könne, aber sie biete auch genügend Auswege, auf denen die Politik diese Fallen vermeiden oder aus ihnen herauskommen kann. Man erkenne sie, wenn man analytisch zwischen unterschiedlichen Mustern von Verflechtung unterscheide sowie die interne Differenzierung, das Zusammenspiel der verschiedenen Governance-Formen und die Eigendynamik des Mehrebenensystems berücksichtige.[37]
2.4 Nebenaußenpolitik der Länder
In den 80er Jahren wurde der Vorwurf seitens des Auswärtigen Amtes und der Staatsrechtslehre laut, dass die deutschen Länder auf außenpolitischem Terrain eine unerlaubte Außenpolitik betrieben.
Staatssekretär a.D. Dr. Klaus Nass bescheinigte den Handlungen der Länder einen „ambivalenten Charakter“[38]. Für diese „Nebenaußenpolitik“[39] gebe es verfassungsrechtliche Schranken für die Bundesländer. Das Grundgesetz habe die auswärtigen Angelegenheiten ausschließlich dem Bund vorbehalten und hierfür das Auswärtige Amt vorgesehen. Die einzige Ausnahme bestehe in dem Recht der Bundesländer über den Bundesrat und die „Ständige Vertragskommission der Länder“, an der Ratifikation völkerrechtlicher Verträge teilzuhaben.[40] Darüber hinaus hatten die Bundesländer das Recht, Verträge mit auswärtigen Staaten und internationalen Organisationen zu schließen, soweit sie für die Gesetzgebung ausschließlich oder mit dem Bund konkurrierend zuständig waren. Auch bei diesen Vertragsschlüssen, die die Länder in den Status beschränkt völkerrechtsfähiger Akteure hob, brauchten die Länder zu den Vertragsverhandlungen die Zustimmung der Bundesregierung. In der Konsequenz behielt die Bundesregierung auch in ausschließlichen Angelegenheiten der Länder das letzte Wort.[41]
Die Behandlung der Aktivitäten von Landesregierungen im Ausland und die damit zusammenhängende Interpretation des Artikels 32 GG[42] wurde kontrovers diskutiert. Es standen sich zwei Rechtsauffassungen gegenüber. Die eine Auffassung des Artikels 32 GG besagte, dass damit nur der diplomatische und konsularische Verkehr sowie sonstige rechtserhebliche Willensbekundungen gegenüber Staaten und internationalen Organisationen geregelt seien. Sonstige Handlungen wären den Ländern nach dieser Rechtsauffassung unter Beachtung des Grundsatzes der Bundestreue erlaubt. Die konkurrierende Rechtsauffassung besagte, dass der Bundesstaat nach außen als Einheit aufzutreten habe und dass daher eine irgendwie geartete Außenpolitik einzelner Bundesländer ausgeschlossen sei.[43]
Nass stellt in seinem Aufsatz mit Bedauern fest, dass das Monopol des Auswärtigen Amtes für die Außenpolitik dahin sei. „’Nebenaußenpolitik’ der Bundesländer ist systembedingt und liegt in der Natur vieler Probleme unserer Zeit.“[44] Joseph Kaiser stellte bei einer Anhörung des Bundesrates 1985 fest, dass die Repräsentanz der Länder durch Vertreter bei den europäischen Organen nach Art von Lobbyisten nicht im Einklang mit dem Charakter und dem Verantwortungsbereich der Länder als Staaten stehe.[45]
Ottokar Hahn, Minister für Bundesangelegenheiten und besondere Aufgaben, der für die Eröffnung des saarländischen Bureau d´Information et de Promotion économique in Brüssel als einem Vorgänger des saarländischen Länderbüros im Jahre 1985 verantwortlich zeichnete, begegnete dem Vorwurf, ein „Neben-Außenministerium“ zu betreiben, mit Molières Worten „Tant de bruit pour une omelette“[46]. Er wollte die Tätigkeiten des saarländischen Büros bewusst unter der diplomatischen Ebene ansiedeln.[47] „Dies hat mit Neben-Außenpolitik nichts zu tun. Es geht schlicht um die Vertretung der Landesinteressen im Rahmen unserer föderalistischen Staatsverfassung.“[48]
Im Jahr 1993 wurden die Meinungsverschiedenheiten zwischen Bund und Ländern offiziell beseitigt, indem die Bundesregierung in der Bund-Länder-Vereinbarung die Länderbüros anerkannte und sich verpflichtete die Länderbüros, insbesondere über die Ständige Vertretung, zu unterstützen. Nicht nur die rechtliche Fixierung, sondern auch die politische Realität liefert reichlich Anschauungsmaterial dafür, dass die Vorstellung des einheitlich nach außen auftretenden Gesamtstaates längst zu einer Illusion geworden ist.[49]
Will man nicht Gefahr laufen, die Europapolitik der Bundesrepublik Deutschland nur eindimensional zu erfassen, so ist es angebracht, sich mit den formellen und informellen Mitwirkungsmöglichkeiten der deutschen Länder im europäischen Mehrebenensystem zu beschäftigen.
3. Mitwirkungsmöglichkeiten der deutschen Länder im europäischen Mehrebenensystem
Landesebene
Die vermeintlich schwächste Ebene im Pokerspiel um Einfluss auf die EU-Gesetzgebung im europäischen Mehrebenensystem ist die Landesebene.
Durch die zunehmende Intensivierung des Integrationsprozesses wurden immer mehr Kompetenzen von der nationalen Ebene auf die europäische Ebene verlagert. Bis 1993 war es dem Bund sogar möglich, Kompetenzen, die auf ehemaligem Landesrecht beruhten, ohne Mitsprachemöglichkeit der Länder an die EU zu übertragen. Durch eine Grundgesetzänderung wurde diesem Handeln ein Riegel vorgeschoben und den Ländern vermehrte Mitspracherechte auf europäischer Ebene eingeräumt. Der Bund hat zwar nach wie vor die Möglichkeit, Hoheitsrechte auf die EU zu übertragen, die Länder müssen aber seit Inkrafttreten des neuen Art. 23 GG im Bundesrat einer Hoheitsübertragung im Zusammenhang mit der Europäischen Union erst zustimmen.[50]
Spricht man in diesem Zusammenhang von Ländern, so sind die Länderexekutiven gemeint. Die europapolitischen Handlungsmöglichkeiten der Landesparlamente sind zwar in den meisten Ländern Mitte der 90er Jahre durch Informationsrechte gestärkt worden, ihr Einfluss auf die Politikformulierung der Exekutive bleibt in den meisten Ländern jedoch marginal. Die Handelnden in den Gremien des Bundesrates, der Ministerpräsidentenkonferenz oder der Europaministerkonferenz sind Mitarbeiter der Landesregierungen. Das daraus resultierende Problem ist ein Zuständigkeitsverlust der Landesparlamente.[51] Denn die Landesparlamente sind an der Mitwirkung der Länder über Art. 23 GG im Bundesrat nicht beteiligt. Durch das Mitwirkungsrecht der Länderexekutiven im Bundesrat, erlangten diese auch Beteiligungsrechte in Politikfeldern, in denen zuvor allein die Landesparlamente eine gesetzgeberische Gestaltungsfunktion hatten.
Im Folgenden soll gezeigt werden, welche unterschiedlichen Möglichkeiten und Formen der landesparlamentarischen Einbindung in den deutschen Ländern bestehen.
3.1.1 Landesparlamente
Die Konferenz der Landtagspräsidenten verabschiedete im Mai 1992 einen Beschluss „zum Informationsrecht des Abgeordneten und des Parlamentes sowie zu den Informationspflichten der Regierung“, worin Empfehlungen für eine verfassungsrechtliche Verankerung des Informationsrechts des Parlaments gegeben werden. Darin werden auch konkrete Formulierungsvorschläge für eine Pflicht der Landesregierung gemacht, das Parlament unaufgefordert über bestimmte Politikbereiche laufend zu informieren. So heißt es in dem vorgeschlagenen Artikel unter Ziffer (1) „Die Landesregierung unterrichtet den Landtag rechtzeitig über Vorhaben, die für das Land von grundsätzlicher Bedeutung sind, insbesondere über (…) Angelegenheiten der Europäischen Gemeinschaften“. In der Entschließung vom Oktober 1994 „in Angelegenheiten der Europäischen Union und des Ausschusses der Regionen“ wurden die Empfehlungen präzisiert. Das Landesparlament solle „umfassend und frühzeitig“ über Vorhaben der Europäischen Union informiert werden und die Beschlüsse des Landesparlamentes sollten von der Landesregierung beachtet werden. In diesem Verfahrensvorschlag ist auch eine „Begründungspflicht der Landesregierung bei Abweichen von Stellungnahmen des Landesparlaments“ vorgesehen.[52]
Die Informationsrechte für die Landtage wurden flächendeckend umgesetzt, jedoch bedeuten Informationsrechte noch kein weiteres Recht zur Mitwirkung an der Europapolitik. Hier reicht die Spannweite der Regelungen in den Landtagen von einer bloßen Unterrichtungspflicht bis hin zur Möglichkeit, Stellungnahmen abzugeben, die von der Landesregierung berücksichtigt werden müssen.
Zur intensivierten Behandlung europapolitischer Themen sind in allen Landtagen, außer dem Landtag von Baden-Württemberg, eigenständige Ausschüsse gegründet worden, die sich mit europapolitischen Fragen befassen. Im Landtag von Baden-Württemberg befasst sich der Ständige Ausschuss mit Fragen der Europapolitik.[53]
Neben der Ausschussarbeit sind die Landesparlamentarier noch am Benennungsverfahren für die Vertreter des Ausschuss der Regionen aus dem eigenen Bundesland beteiligt. Unter den deutschen Mitgliedern finden sich hauptsächlich Mitarbeiter der Landesexekutiven und nur wenige Parlamentarier. Somit beanspruchen die Landesregierungen auch für die Mitarbeit im Ausschuss der Regionen die Entscheidungs- und Handlungsprärogative für sich.[54] Trotzdem kann es sich auszahlen, dass sich die Landtage bei der inhaltlichen Arbeit auf ihre Landesvertreter, seien es Parlamentarier oder Regierungsvertreter, im AdR konzentrieren. Denn obwohl die Mitglieder des AdR weisungsungebunden sind, schließt dies eine Einflussnahme auf informell-politischem Wege nicht aus.[55]
Es kann festgestellt werden, dass die Landtage eine zunehmende Ausgrenzung von politischen Entscheidungsprozessen erfahren und gestaltend in den Gesetzgebungsprozess nur sehr eingeschränkt eingreifen können.
Deshalb ist es die Aufgabe der Landtage, eine stärkere Mitsprache im föderalen Entscheidungsprozess einzufordern. Denn für die einzelnen Landtage ist hinsichtlich der parlamentarischen Mitwirkungsmöglichkeiten noch erheblicher Spielraum geboten.[56]
Bei allem Beklagen der fehlenden Mitwirkungsrechte der Landesparlamentarier darf nicht übersehen werden, dass die Europapolitik auf landespolitischer Ebene nicht das beliebteste Betätigungsfeld ist. Da die Europapolitik auf Landesebene von den Bürgern kaum wahrgenommen wird, bietet sie für den einzelnen Landespolitiker wenig Raum zur Profilierung.[57]
3.1.2 Landesregierung
Einen erheblich größeren Einfluss als die Landtage auf die Politikformulierung eines Landes hat die Landesregierung.
[...]
[1] FAZ.NET: „Teufel: Ein vereintes Europa braucht eine Verfassung“. Interview mit Erwin Teufel in FAZ.NET vom 26.02.2002.
[2] Wenn von der „Europapolitik der Länder“ gesprochen wird, ist stets die Europapolitik der deutschen Bundesländer gemeint.
[3] Hartmut Klatt definiert den kooperativen Föderalismus als ein „(…) System der gemeinsamen Aufgabenplanung und –finanzierung sowie (…) der ebenenübergreifenden Verflechtung (…)“ der Kompetenzen, zitiert in: Michèle Knodt: Tiefenwirkung europäischer Politik: Eigensinn oder Anpassung regionalen Regierens?. Baden-Baden 1998, S. 42.
[4] Diese Angabe bezieht sich auf die Jahre 2001-2003.
[5] Wichtige Beiträge zum Mehrebenensystem liefern Gary Marks: Structural Policy and Multilevel Governance in the EC, in: Alan W. Cafruny und Glenda Rosenthal (Hrsg.): The State of the European Community, The Maastricht Debates and Beyond, Band 2, Essex 1993, S. 387-410; Liesbet Hooghe (Hrsg.): Cohesion Policy and European Integration, Building Multi-Level Governance, New York 1996; Markus Jachtenfuchs und Beate Kohler Koch: Einleitung: Regieren im dynamischen Mehrebenensystem, in: Markus Jachtenfuchs und Beate Kohler-Koch (Hrsg.): Europäische Integration. Opladen 1996, S. 15-44.
[6] Vgl. Fritz W. Scharpf: Die Politikverflechtungs-Falle: Europäische Integration und deutscher Föderalismus im Vergleich, in: Politische Vierteljahresschrift, 04/1985, S. 323-356.
[7] Vgl. Scharpf 1985, S. 326.
[8] Scharpf 1985, S 350.
[9] Vgl. Klaus Otto Nass: „Nebenaußenpolitik“ der Bundesländer, in: Europa-Archiv, 21/1986, S. 619-628.
[10] Auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die interregionale und transnationale Zusammenarbeit sowie auf kommunale Aktivitäten kann im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen werden. Als Einstieg zu diesen Themen lohnt die Lektüre von: Michèle Knodt: „Vier Motoren für Europa“: Symbolische Hochglanzpolitik oder erfolgsversprechende regionale Strategie des Landes Baden-Württemberg?, in: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung (Hrsg.): Jahrbuch des Föderalismus 2000. Baden-Baden 2000, S. 405-416; Thomas Fischer und Siegfried Frech (Hrsg.): Baden-Württemberg und seine Partnerregionen. Stuttgart 2001.
[11] Die Sinatra-Strategie „steht für die Forderung nach größerer Eigenverantwortung, die Entflechtung der Kompetenzen im europäischen Mehrebenensystem und zugleich für einen Zuwachs bzw. eine Rückgewinnung an eigenen Kompetenzen. Geleitet wird diese Strategie von der Idee eines erhöhten Wettbewerbs der Länder untereinander als einem spezifischen Verständnis von subsidiärer Verantwortung für die eigene Länderwohlfahrt“. Siehe: Michèle Knodt: Europäisierung à la Sinatra: Deutsche Länder im europäischen Mehrebenensystem, in: Michèle Knodt und Beate Kohler-Koch (Hrsg.): Deutschland zwischen Europäisierung und Selbstbehauptung (= Mannheimer Jahrbuch für Europäische Sozialforschung Band 5). Frankfurt 2000, S. 255.
[12] Martin Hübler: Die Europapolitik des Freistaates Bayern. Von der Einheitlichen Europäischen Akte bis zum Amsterdamer Vertrag. München 2002. S. 15.
[13] Vgl. Claus-Peter Clostermeyer: Die Europapolitik Baden-Württembergs, in: Thomas Fischer und Siegfried Frech (Hrsg.): Baden-Württemberg und seine Partnerregionen. Stuttgart 2001, S. 35-47.
[14] Vgl. Roland Johne: Die deutschen Landtage im Entscheidungsprozeß der Europäischen Union. Parlamentarische Mitwirkung im europäischen Mehrebenensystem. Baden-Baden 2000.
[15] Vgl. Petra Zimmermann-Steinhart: Europas erfolgreiche Regionen. Handlungsspielräume im innovativen Wettbewerb. Baden-Baden 2003.
[16] Vgl. Charlie Jeffery: From Cooperative Federalism to a ‘Sinatra Doctrine’of the Länder?, in: Charlie Jeffery (Hrsg.): Recasting German Federalism: The Legacies of Unification. London 1999, S. 329-342.
[17] Vgl. Michèle Knodt: Europäisierung à la Sinatra: Deutsche Länder im europäischen Mehrebenensystem, in: Michèle Knodt und Beate Kohler-Koch (Hrsg.): Deutschland zwischen Europäisierung und Selbstbehauptung
(= Mannheimer Jahrbuch für Europäische Sozialforschung Band 5). Frankfurt 2000, S. 237-263.
[18] Ein wichtiger Vertreter des Neofunktionalismus ist Ernst B. Haas. Siehe: Ernst B. Haas: Beyond the Nation-State: Functionalism and International Organization. Stanford, 1964.
[19] Vgl. Andrew Moravcsik: Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmental Approach, in: Journal of Common Market Studies 31/1993, S. 473-524.
[20] Vgl. Markus Jachtenfuchs: Die Europäische Union – ein Gebilde sui generis?, in: Klaus Dieter Wolf (Hrsg.): Projekt Europa im Übergang?. Baden-Baden 1997, S. 15-36.
[21] Vertreter dieses Ansatzes sind z.B. Hubert Heinelt (Hrsg.): Politiknetzwerke und europäische Strukturfondsförderung. Ein Vergleich zwischen EU-Mitgliedstaaten. Opladen 1996; Lie sbet Hooghe (Hrsg.): Cohesion Policy and European Integration: Building Multi-Level Governance, Oxford 1996; Gary Marks: Politikmuster und Einflußlogik in der Strukturpolitik, in: Markus Jachtenfuchs und Beate Kohler-Koch (Hrsg.): Europäische Integration, Opladen 1996, S. 313-343.
[22] Vgl. Arthur Benz: Entflechtung als Folge von Verflechtung: Theoretische Überlegungen zur Entwicklung des europäischen Mehrebenensystems, in: Edgar Grande und Markus Jachtenfuchs (Hrsg.): Wie problemlösungsfähig ist die EU? Regieren im europäischen Mehrebenensystem. Baden-Baden 2000, S. 143ff.
[23] Vgl. Grande: Multi-Level Governance, 2000, S. 14ff.
[24] Vgl. ebd. S. 18.
[25] Vgl. Fritz W. Scharpf: Die Politikverflechtungs-Falle: Europäische Integration und deutscher Föderalismus im Vergleich, in: Politische Vierteljahresschrift, 04/1985, S. 323-356.
[26] Vgl. Scharpf 1985, S. 326.
[27] Scharpf 1985, S 350.
[28] Vgl. Scharpf 1985, S. 350f. und Fritz Ossenbühl: Föderalismus nach 40 Jahren Grundgesetz, in: Deutsches Verwaltungsblatt, 104/ 1989, S. 1236.
[29] Vgl. Edgar Grande: Forschungspolitik in der Politikverflechtungsfalle? Institutionelle Strukturen, Konfliktdimensionen und Verhandlungslogiken europäischer Forschungs- und Technologiepolitik, in: Politische Vierteljahresschrift, 36/1995, S. 462.
[30] Diese Bezeichnung findet sich bei Scharpf 1985 sowie bei Hrbek 1986, vgl. Rudolf Hrbek: Doppelte Politikverflechtung: Deutscher Föderalismus und Europäische Integration. Die deutschen Länder im Entscheidungsprozeß, in: Rudolf Hrbek und Uwe Thaysen (Hrsg.): Die Deutschen Länder und die Europäischen Gemeinschaften, Baden-Baden 1986, S. 17.
[31] Scharpf 1985, S. 324.
[32] Vgl. Scharpf 1985, S. 338.
[33] Vgl. Scharpf 1985, S. 350ff und Benz 1998, S. 562.
[34] Vgl. Benz 1998, S. 560.
[35] Benz 1998, S. 566.
[36] Benz 1998, S. 583.
[37] Benz 1998, S. 586
[38] Klaus Otto Nass: „Nebenaußenpolitik“ der Bundesländer, in: Europa-Archiv, 21/1986, S. 626.
[39] Nass 1986 S. 623.
[40] Diese Rechte wurden im sog. „Lindauer Abkommen“ verankert. Siehe: „Verständigung zwischen der Bundesregierung und den Staatskanzleien der Länder über das Vertragsschließungsrecht des Bundes“ vom 14. November 1957, abgedruckt in: Theodor Maunz u.a.: Grundgesetz Kommentar, 1994.
[41] Vgl. Nass 1986, S. 624.
[42] Art. 32 GG Abs. 1 im Wortlaut: „Die Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten ist Sache des Bundes.“
[43] Vgl. Nass 1986, S. 625.
[44] Nass, 1986, S. 627.
[45] So Prof. Dr. Joseph H. Kaiser bei einer Anhörung von Sachverständigen zu den mit der europäischen Integration verbundenen Rechtsfragen in der Sitzung des Ständigen Beirats des Bundesrates am 06.11.1985, zitiert in: Rudolf Hrbek: Doppelte Politikverflechtung: Deutscher Föderalismus und Europäische Integration. Die deutschen Länder im EG-Entscheidungsprozess, in: Rudolf Hrbek und Uwe Thaysen (Hrsg.): Die Deutschen Länder und die Europäischen Gemeinschaften. Baden-Baden 1986, S. 33.
[46] Vgl. Ottokar Hahn: EG-Engagement der Länder: Lobbyismus oder Nebenaußenpolitik?, in: Rudolf Hrbek und Uwe Thaysen (Hrsg.): Die deutschen Länder und die Europäischen Gemeinschaften. Baden-Baden 1986, S. 105.
[47] Vgl. Hahn 1986, S. 109.
[48] Hahn 1986, S. 110.
[49] Vgl. Thomas Fischer: Die Außenbeziehungen der deutschen Länder als Ausdruck „perforierter“ nationalstaatlicher Souveränität?, in: Hans-Georg Wehling (Hrsg.): Die Deutschen Länder. Geschichte, Politik, Wirtschaft, Opladen 2002, S. 369ff.
[50] Vgl. Konrad Zumschlinge: Die Europakompetenzen der Landesregierung und die Rolle der Landesvertretungen in Brüssel, in: Hans-Ulrich Derlien und Axel Murswieck (Hrsg.): Der Politikzyklus zwischen Bonn und Brüssel, Opladen 1999, S. 54.
[51] Vgl. Aloys Lenz und Roland Johne: Die Landtage vor der Herausforderung Europa. Anpassung der parlamentarischen Infrastruktur als Grundlage institutioneller Europafähigkeit, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 6/2000, S. 20ff.
[52] Vgl. Roland Johne: Die deutschen Landtage im Entscheidungsprozeß der Europäischen Union. Parlamentarische Mitwirkung im europäischen Mehrebenensystem. Baden-Baden 2000, S. 105ff.
[53] Vgl. Lenz/Johne 2000, S. 22.
[54] Vgl. Roland Johne: Vertretung der Landtage im Ausschuss der Regionen. Zur parlamentarischen Komponente unmittelbarer Interessenvertretung der deutschen Bundesländer in der Europäischen Union, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Heft 01/2000, S. 108.
[55] Vgl. ebd., S. 114.
[56] Vgl. Lenz/Johne 2000, S. 27 und vgl. Franz Greß: Die Rolle der deutschen Landesparlamente im Prozeß der europäischen Integration, in: Peter Straub und Rudolf Hrbek (Hrsg.): Die europapolitische Rolle der Landes- und Regionalparlamente in der EU, Baden-Baden 1998, S. 165.
[57] Vgl. Greß 1998, S. 173.