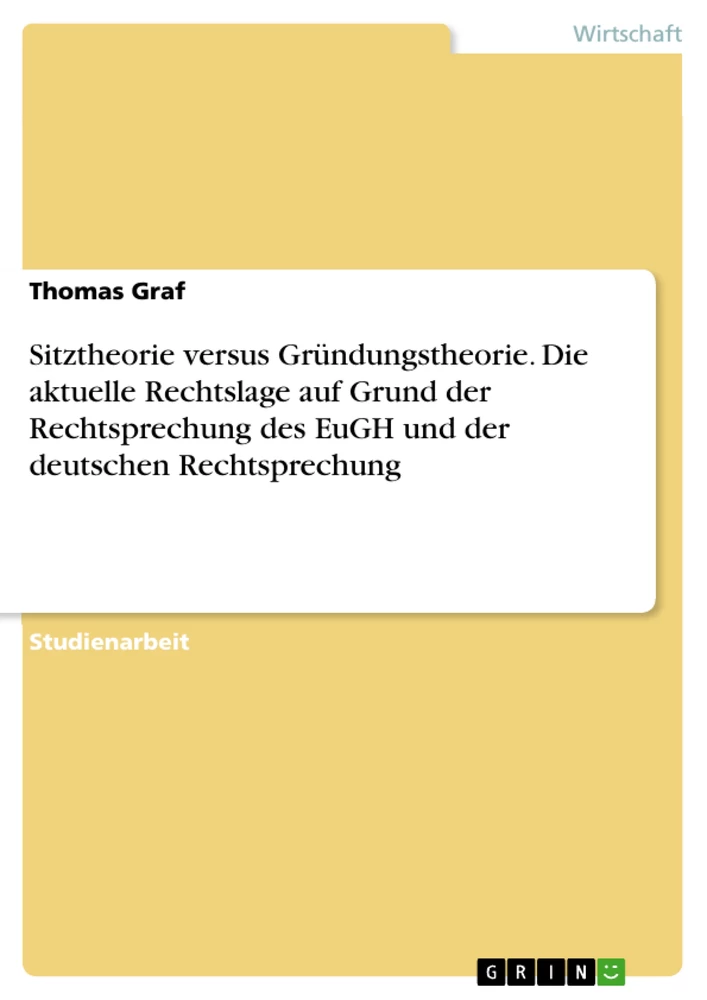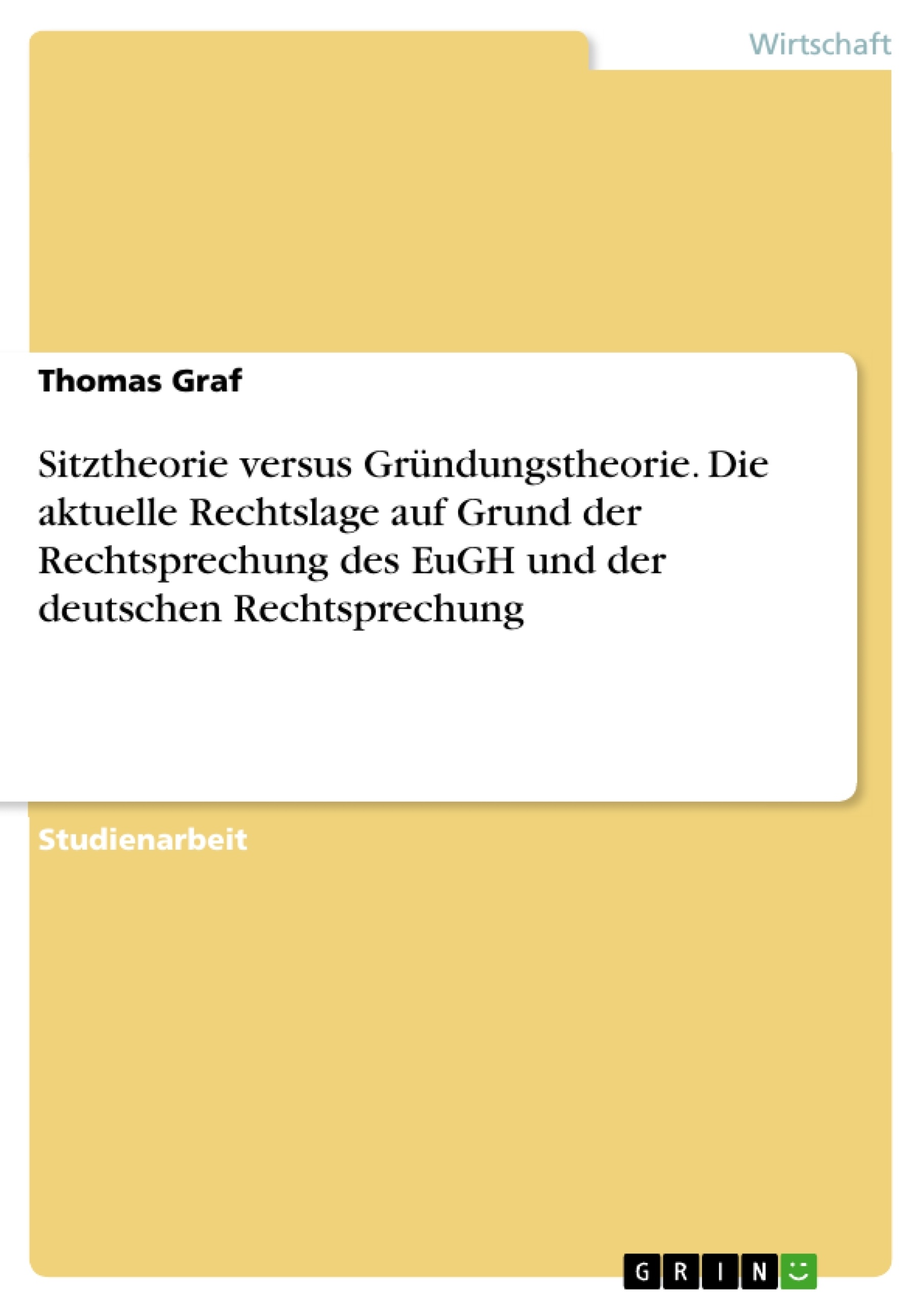Die Europäische Union gewinnt immer stärker an Bedeutung. Europäisches Recht beeinflußt schon seit längern die deutsche Rechtssprechung. Aus diesem Hintergrund wird die Fragestellung, ob die im deutschen Gesellschaftsrecht geltende Sitztheorie zu Gunsten der Gründungstheorie vollständig aufgegeben wurde, betrachtet.
Die Niederlassungsfreiheit ist ein europäisches Grundrecht. Es ermöglicht Gesellschaften ihre Hauptniederlassung in jedes Staatsgebiet eines Mitgliedstaates zu verlegen und Agenturen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften zu gründen.
Nach der im deutschen Gesellschaftsrecht vorherrschenden Sitztheorie richtet sich die Bestimmung des Gesellschaftsstatuts nach dem Ort, an welchem die Gesellschaft ihren tatsächlichen Verwaltungssitz hat. Im Gegensatz dazu steht die Gründungstheorie, nach der sich die Bestimmung des Gesellschaftsstatuts ausschließlich nach dem Ort der Gründung der Gesellschaft richtet.
Der EugH erklärte in dem Fall „Daily Mail“ die nationalen Rechtsordnungen des Gründungsstaates für die Existenz der Gesellschaft als maßgeblich und Wegzugsbeschränkungen für zulässig. In dem Fall „Centros“ hat der EuGH entschieden, dass es gegen die Niederlassungsfreiheit verstößt, wenn ein Zuzugsstaat die Eintragung einer Tochtergesellschaft verweigert, auch wenn diese nationale Beschränkungen umgeht. In dem Fall „Überseering“ entschied der EuGH, dass jede Gesellschaft, die ihren Satzungs- und Verwaltungssitz in einen anderen Staat verlegt, ihre volle Rechts- und Parteifähigkeit beibehält. Dies wurde durch das Urteil im Fall „Inspire Art“ bekräftigt, da jede Gesellschaft, die nach ausländischem Recht ordnungsgemäß gegründet wurden, im Zuzugsstaat genauso wie im Gründungsstaat behandelt werden muss und die Anerkennung nicht durch strengere gesellschaftsrechtliche Regelungen abhängig gemacht werden darf.
Damit verstoßen staatliche Zuzugsbeschränkungen gegen die Niederlassungsfreiheit, Wegzugsbeschränkungen sind aber weiterhin zulässig. Ob die Möglichkeit eines Umzugs besteht, richtet sich nach dem Recht des Wegzugstaates.
Damit läßt sich feststellen, dass die Sitztheorie in Deutschland nur noch für den Wegzug, in Deutschland gegründeten Gesellschaften, anwendbar ist. Im Zuzugsfall ausländischer Gesellschaften nach Deutschland ist hingegen die Gründungstheorie anzuwenden.
Inhaltsverzeichnis
II. Abkürzungsverzeichnis
1. Grundlagen und Begriffsbestimmung
1.1. Niederlassungsfreiheit
1.2. Sitz der Gesellschaft
1.2.1. Satzungssitz
1.2.2. Verwaltungssitz
1.3. Gesellschaftsstatut und Bestimmung
1.3.1. Gesellschaftsstatut
1.3.2. Sitztheorie
1.3.3. Gründungstheorie (Inkorporationstheorie)
2. Aktuelle Rechtsprechungen des EuGH zur Niederlassungsfreiheit und Gesellschaftsstatut
2.1. Entscheidung des EuGH zu „Daily Mail“, vom 27.09.1988, RS. 81/87
2.1.1. Sachverhalt:
2.1.2. Urteil:
2.2. Entscheidung des EuGH zu „Centros“, vom 09.03.1999, RS. C-212/97
2.2.1. Sachverhalt:
2.2.2. Urteil:
2.3. Entscheidung des EuGH zu „Überseering“, vom 05.11.2002, RS. C-208/00
2.3.1. Sachverhalt:
2.3.2. Urteil:
2.4. Entscheidung des EuGH zu „Inspire Art“, vom 30.09.2003, RS. C-167/01
2.4.1. Sachverhalt:
2.4.2. Urteil:
3. Auswirkung der europäischen und deutschen Rechtsprechung auf den Umzug von Gesellschaften im europäischen Binnenmarkt
3.1. Sitzverlegung im europäischen Binnenmarkt
3.1.1. Zuzug ausländischer Gesellschaften nach Deutschland aus einem EU- Mitgliedstaat, der der Gründungstheorie folgt
3.1.2. Zuzug ausländischer Gesellschaften nach Deutschland aus einem EU- Mitgliedstaat, der der Sitztheorie folgt
3.1.3. Wegzug deutscher Gesellschaften in einen EU- Staat, der der Gründungstheorie folgt
3.1.4. Wegzug deutscher Gesellschaften in einen EU- Staat, der der Sitztheorie folgt
3.2. Zusammenfassung
3.3. Zuzugs- und Wegzugsbeschränkungen
4. Fazit: Verdrängung der Sitz- durch die Gründungstheorie?
5. Zusammenfassung
II. Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Grundlagen und Begriffsbestimmung
1.1. Niederlassungsfreiheit
Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft gewährt allen Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der EU, sich ohne „Beschränkungen der freien Niederlassung“[1]auf dem Staatsgebiet jedes Mitgliedstaates niederzulassen und dort einer selbständigen Tätigkeit nachzugehen. Diese Niederlassungsfreiheit ist ein in Art. 43, 48 EGV kodifiziertes Grundrecht. Unter diesen Artikel fallen auch die für die effektive Wahrnehmung der Freizügigkeit notwendigen Grundrechte, wie das Recht auf freie Einreise, Aufenthalt und Wegzug[2].
Gem. Art. 48 EGV gilt die Niederlassungsfreiheit nicht nur für natürliche, sondern auch für juristische Personen wie Kapitalgesellschaften[3]. Zu unterscheiden ist dabei zwischen primärer und sekundärer Niederlassungsfreiheit.
Unter primärer Niederlassungsfreiheit ist, gem. Art. 43 Abs.1, S.1 48 EGV, das Recht einer in der EU beheimateten Gesellschaft zu verstehen, den Schwerpunkt ihrer unternehmerischen Tätigkeit -die Hauptniederlassung- in das Staatsgebiet eines anderen EU-Mitgliedstaates zu verlegen[4].
Art. 43 Abs.1 S.2 EGV gewährt die „Gründung von Agenturen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften“. Unter sekundärer Niederlassungsfreiheit ist demnach die Möglichkeit der Ausdehnung der Geschäftstätigkeit in einen anderen Mitgliedstaat unter Beibehaltung des Hauptsitzes und Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit im Heimatstaat[5]zu verstehen.
Die in Art. 43 48 EGV kodifizierte Niederlassungsfreiheit ermöglicht folglich den im Staatsgebiet der EU ansässigen Gesellschaften, ihre wirtschaftliche Tätigkeiten durch zusätzliche Gründung von Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen auf das gesamte Staatsgebiet der EU auszuweiten und darüber hinaus, durch Verlegung ihrer Hauptniederlassung in jeden Staat der EU „umzuziehen“.
1.2. Sitz der Gesellschaft
1.2.1. Satzungssitz
Der Satzungssitz oder statutarischer Sitz ist der in Satzung oder Gesellschaftsvertrag angegebene Sitz einer Gesellschaft. Nach ihm richtet sich die Zuständigkeit des Registergerichtes (§ 7 GmbHG), an dem die Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen werden muss, und des zuständigen Prozessgerichtes (§ 17 ZPO)[6]. Im Regelfall befindet sich der Satzungssitz am Ort einer Betriebsstätte, der Geschäftsleitung oder der Verwaltung. Ausnahmen bleiben möglich[7]. In den meisten Fällen fallen alle drei Möglichkeiten zusammen.
Der Satzungssitz ist folglich für Bestimmung der Zuständigkeiten von Gerichten und Verwaltungsbehörden maßgeblich.
1.2.2. Verwaltungssitz
Der Verwaltungssitz ist der Ort, an dem sich die Hauptverwaltung tatsächlich befindet[8]. Damit ist der Ort an dem die Geschäftsführung tatsächlich tätig wird gemeint. Das heißt, dass an diesem Ort die grundlegenden Entscheidungen der Unternehmensleitung effektiv in laufende Geschäftsführungsakte umgesetzt werden[9]. Der Verwaltungssitz hat im nationalen Sachenrecht nur eine untergeordnete Funktion.
Große Bedeutung erlangt er dagegen bei Bestimmung des Gesellschaftsstatuts nach der Sitztheorie im internationalen Kollisions- und Gesellschaftsrecht[10].
1.3. Gesellschaftsstatut und Bestimmung
1.3.1. Gesellschaftsstatut
Das Gesellschaftsstatut bezeichnet das Recht, welches sich grundsätzlich auf alle Fragen bezüglich des Innen- und Außenverhältnisses[11]der Gesellschaft von Beginn bis zur Beendigung erstreckt[12]. Das Gesellschaftsstatut ist folglich unter anderen entscheidend für die Beurteilung von Gründung, Entstehung, Eintragung, Form, Haftung, Organe, Satzung, Abwicklung, Auflösung und Beendigung, Rechts-, Partei- und Prozessfähigkeit der Gesellschaft, aber auch für die Festlegung von Kapitalaufbringung, Unternehmensstruktur und –verfassung[13].
Die Bestimmung des Gesellschaftsstatuts und der damit verbundenen Festlegung der Rechtsverhältnisse einer juristischen Person, stellt eine umstrittene Grundsatzfrage dar. Literatur und Rechtsprechung haben im Wesentlichen mit Sitz- und Gründungstheorie zwei Ansätze entwickelt[14].
1.3.2. Sitztheorie
Die Sitztheorie ist der in Deutschland vorherrschende, in Literatur und Rechtsprechung vertretene Ansatz zur Bestimmung des Gesellschaftsstatuts. Grundidee ist, dass für die Gründung einer Gesellschaft das Recht des Staates maßgeblich ist, in dem sie ihren tatsächlichen Verwaltungssitz hat[15]. Ziel ist der Schutz nationaler Interessen und eine effektive Kontrolle juristischer Personen. Die wirtschaftlichen Aktivitäten einer Gesellschaft sollen dem rechtlichen Rahmen des Staates unterliegen, der durch diese am stärksten betroffen ist[16].
Der Verwaltungssitz der Gesellschaft muss bei der Sitztheorie im Gründungsstaat liegen. Der Staat bestimmt die Gesellschaftsformen, die in dem Staatsgebiet zulässig sind. Ausländische Gesellschaften verlieren demnach ihre Rechtsfähigkeit wenn sie ihren Verwaltungssitz nach Deutschland verlegen würden, da sie als Kapitalgesellschaft nicht anerkannt, in das Handelsregister nicht eingetragen werden können[17].
Vorteile der Sitztheorie liegen in ihrer Schutzfunktion[18]. Durch sie wird verhindert, dass Gesellschaften solche ausländische Gesellschaftsformen annehmen, die durch ihre all zu liberale Ausgestaltung Gläubiger, Arbeitnehmer, Minderheitsgesellschafter und Dritte schädigen könnten.
Nachteile liegen neben der nicht immer ersichtlichen und möglichen Feststellung des Gesellschaftsstatuts in der starken Einschränkung der grenzüberschreitenden Sitzverlegung. Insbesondere die Beeinträchtigung der europaweiten Bewegungsfreiheit wird als unzulässige Beschränkung der Niederlassungsfreiheit kritisiert und soll im Rahmen dieser Arbeit eingehend betrachtet werden.
Die Sitztheorie gilt neben Deutschland in Frankreich, Belgien, Luxemburg und Österreich, in eingeschränkter Form auch in Spanien und Griechenland.
1.3.3. Gründungstheorie (Inkorporationstheorie)
Die Gründungstheorie hat ihren historischen Ursprung im anglo-amerikanischen Rechtsraum[19]des 18. Jahrhundert. Ihre Intension war der Schutz englischen Gesellschaften bei Gründungen in den Kolonien des Empires. Sie ermöglichte im britischen Mutterland ansässigen Handelsgesellschaften, auf der ganzen Welt, nach englischen Recht Gesellschaften zu betreiben.
Nach der Gründungstheorie bestimmen sich Gesellschaftsstatut und Rechtsform nach der Rechtsordnung des Staates, in dem die Gesellschaft gegründet wurde. Die Rechtsform des Gründungsstaates wird in andere Rechtsformen inkorporiert. Den Gründern steht es demnach weitgehend frei, nach welchem Recht sie die Gesellschaft gründen[20]. Die einmal erlangte Rechtfähigkeit bleibt auch bei einer Verlegung des Verwaltungssitzes in einen anderen Staat ohne rechtlichen Identitätsverlust[21]erhalten.
Vorteil der Gründungstheorie ist neben der einfachen Feststellung des Gesellschaftsstatuts und der dadurch herrschenden Rechtsklarheit, die grenzüberschreitende Mobilität der Sitzverlegung. Das Risiko der Rechtsunfähigkeit bei Tätigkeiten im Ausland wird vermieden.
Der weite Gestaltungsraum birgt die Gefahr des Missbrauchs. Wenn durch Wahl ausländischer Rechtformen nationale Schutzvorschriften, zu Lasten von Mitarbeitern, Gläubigern oder Minderheitsgesellschafter, umgangen werden. Um diese Missbrauchsgefahr abzuschwächen, werden auf nationaler Ebene verschiedenste Ausgestaltungen, wie die Einschränkung der Wahlfreiheit für Gesellschafter[22], als Hilfsmittel herangezogen[23].
Durch die gewährte Wahlfreiheit werden die verschiedenen Gesellschaftsrechte der Staaten in Wettbewerb zueinander gestellt. Staaten mit rigideren Regelungen werden, um eine Abwanderung der Gesellschaften aus ihrem Rechtsbereich zu verhindern, gezwungen ihr Rechtssystem liberaler zugestalten um Gesellschaften zur Ansiedelung zu bewegen (Delaware Effekt). Dies führt insgesamt zu einer Verschlechterung der nationalen Schutzinteressen.
Die Gründungstheorie wird heute in England, USA und mit Einschränkungen in den Niederlanden, der Schweiz, Italien, Spanien, Dänemark, Schweden, Lichtenstein und Japan angewandt[24].
Die Wahl des Standortes hat für Gesellschaften folglich nicht nur rein ökonomische Auswirkungen wie unterschiedliche Lohnkosten, Infrastruktur, Besteuerung usw. Auch das jeweilige Gesellschaftsrecht kommt zum Tragen. Durch die Wahl des Standortes ergeben sich umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten der Gesellschaftsform, die sich aufgrund der unterschiedlichen Gesellschaftsrechte und –statute ergeben.
[...]
[1]Art. 43 Abs. 1 S.1 EGV
[2]Vgl: Bechtel: „Umzug von Kapitalgesellschaften unter der Sitztheorie“ S. 59
[3]Dazu auch: Bayer: „Die EuGH- Entscheidung „Insprie Art“ und die deutsche GmbH im Wettbewerb der europäischen Rechtsordnung“, BB, 2003, S. 2357
[4]Vgl.: Habersack, EuGesR, Rdnr. 10
[5]Vgl.: Habersack, EuGesR, Rdnr. 11
[6]Vgl.: Crezelius, G. u. Schneider, H. u. Emmerich, V. u.a. : „Scholz Kommentar zum GmbHG“ 9. Auflage, 2000, Dr. Otto Schmidt Verlag (Köln), S. 304
[7]Crezelius, G. u. Schneider, H. u. Emmerich, V. u.a. : „Scholz Kommentar zum GmbHG“ 9. Auflage, 2000, Dr. Otto Schmidt Verlag (Köln), S. 306
[8]Vgl.:Münch/HandB- § 78 Rd. 26
[9]Vgl.:Münch/HandB- § 78 Rd. 26
[10]Siehe Kap. 1.3.
[11]Vgl.:Münch/HandB- § 78 Rd. 32
[12]Vgl.: Behrens in Hachenburg 7. Auflage Allgemeine Einleitung Rd. 88
[13]Vgl.:Münch/HandB- § 78 Rd. 33, 34ff
[14]Vgl.: Rosenbach: „Beck`sches Handbuch der GmbH“ 3. Auflage, 2002, Beck (München) S. 1409
[15].: Rosenbach: „Beck`sches Handbuch der GmbH“ 3. Auflage, 2002, Beck (München) S. 1409
[16]Vgl: Bechtel: „Umzug von Kapitalgesellschaften unter der Sitztheorie“ Band 6, 1999, Lang (Frankfurt am Main),S. 2
[17]Rosenbach: „Beck`sches Handbuch der GmbH“ 3. Auflage, 2002, Beck (München) S. 1409
[18]Rosenbach: „Beck`sches Handbuch der GmbH“ 3. Auflage, 2002, Beck (München) S. 1410
[19]Rosenbach: „Beck`sches Handbuch der GmbH“ 3. Auflage, 2002, Beck (München) S. 1410
[20]Vgl: Bechtel: „Umzug von Kapitalgesellschaften unter der Sitztheorie“ Band 6, 1999, Lang (Frankfurt am Main),S. 2
[21]Rosenbach: „Beck`sches Handbuch der GmbH“ 3. Auflage, 2002, Beck (München) S. 1410
[22]Vgl: Bechtel: „Umzug von Kapitalgesellschaften unter der Sitztheorie“ Band 6, 1999, Lang (Frankfurt am Main),S. 9
[23]Rosenbach: „Beck`sches Handbuch der GmbH“ 3. Auflage, 2002, Beck (München) S. 1410
[24]Rosenbach: „Beck`sches Handbuch der GmbH“ 3. Auflage, 2002, Beck (München) S. 1410