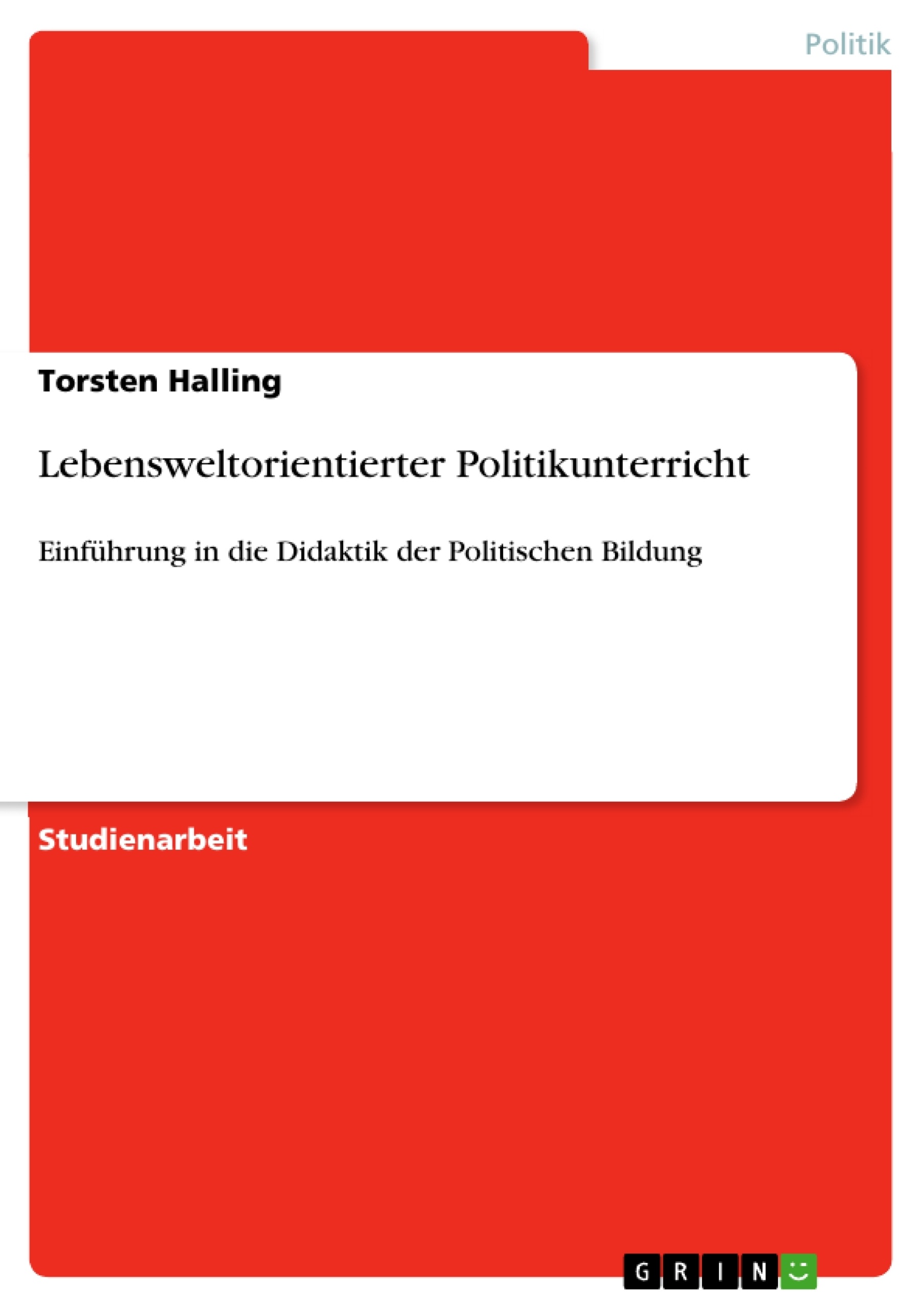Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob die Orientierung an der Lebenswelt der Schüler ein unverzichtbarer Bestandteil eines modernen Politikunterrichts sein sollte oder ob dieser Ansatz eher abzulehnen ist, da er möglicherweise das Fach Politik "unpolitisch" werden ließe und dadurch die Daseinsberechtigung des Faches in Frage stellen könnte. Hierfür werden zunächst allgemeine Überlegungen zu den beiden Begriffen "Lebenswelt" und "Politik" angestellt, wobei konstatiert wird, dass beide Ebenen zu Unrecht von vielen als vollkommen voneinander getrennte Sphären angesehen werden, was häufig zu Desinteresse an politischen Fragen führt. Anschließend wird die didaktische Umsetzung eines lebensweltorientierten Politikunterrichts diskutiert. Hierbei wird hervorgehoben, dass ein solcher Unterricht auf die Schüler in hohem Maße motivierend wirken kann, wobei jedoch zu beachten ist, dass der Unterricht nie bei den lebensweltlichen Problemen verharren darf, sondern immer den Bezug zur "großen" Politik herstellen muss.
Lebensweltorientierter Politikunterricht
Einführung in die Didaktik der Politischen Bildung
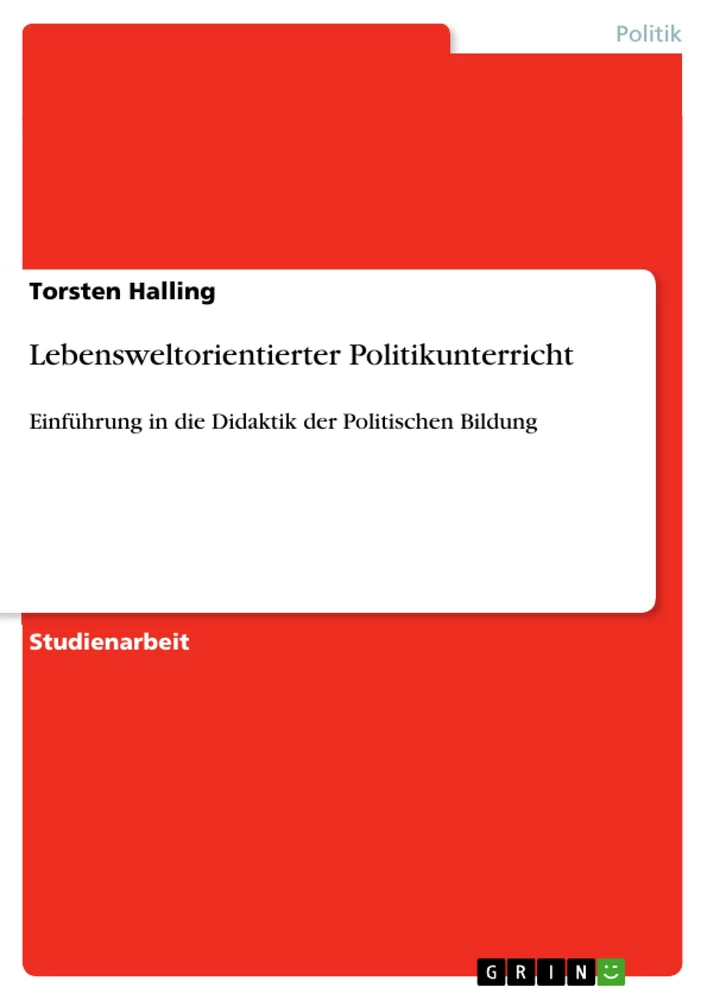
Seminararbeit , 2000 , 9 Seiten , Note: 1.0
Autor:in: Torsten Halling (Autor:in)
Didaktik - Politik, politische Bildung
Leseprobe & Details Blick ins Buch