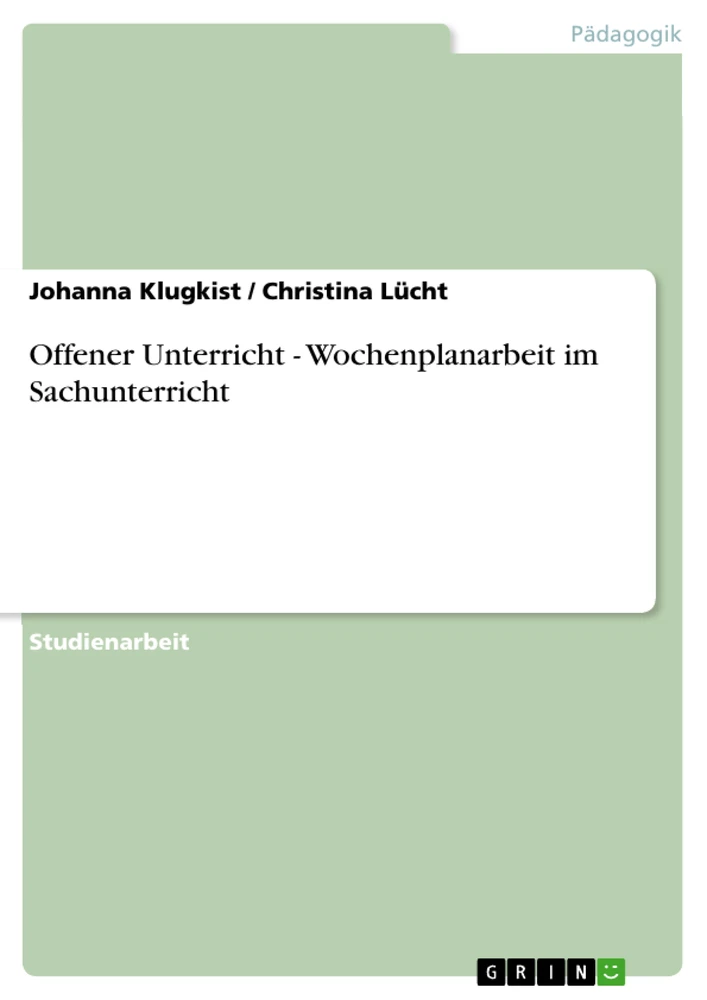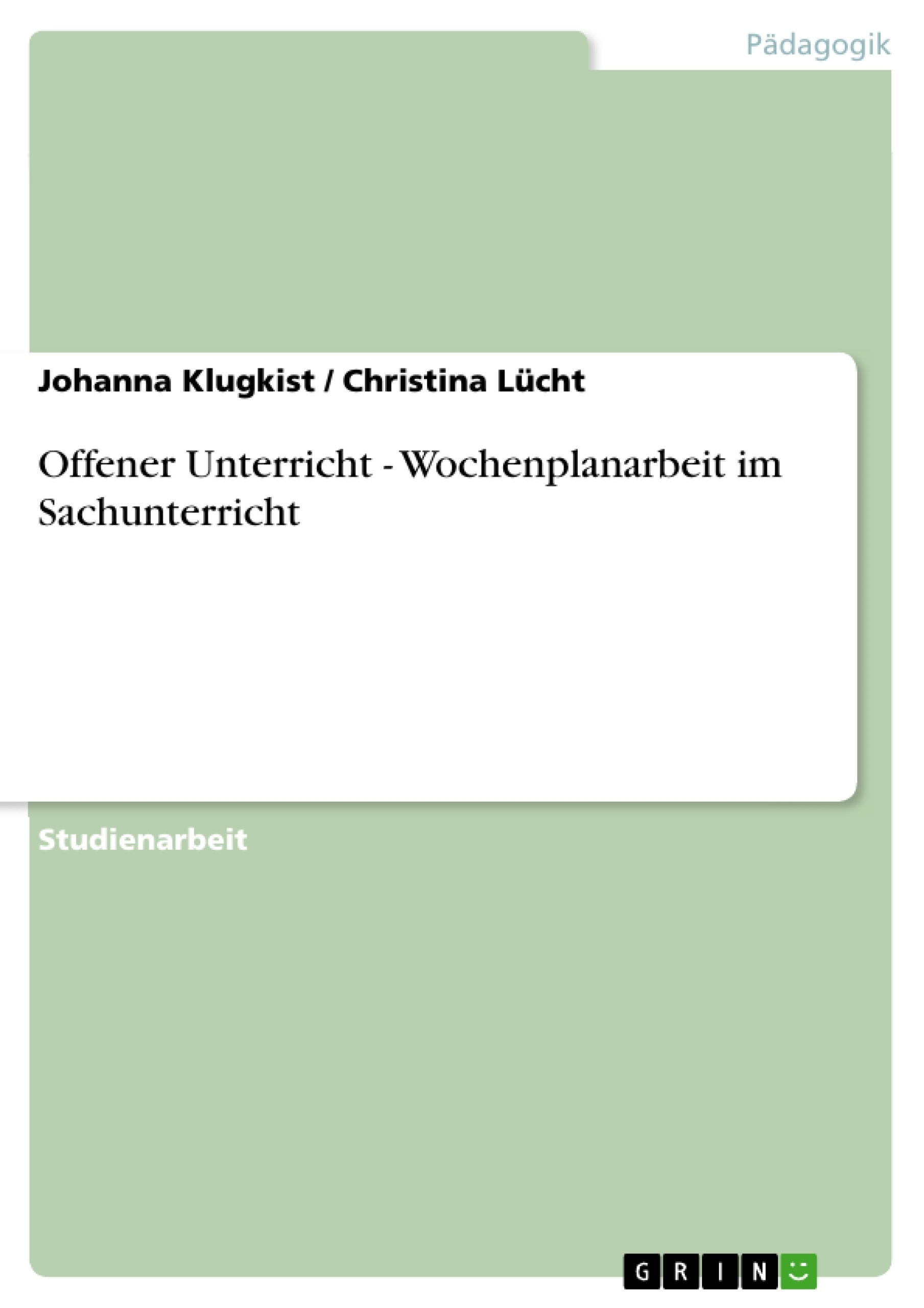Kinder stellen hohe Anforderungen an ihren Lehrer und den Unterricht. Sie erwarten keine eintönige Belehrung, sondern fordern Abwechslung und Freude am Lernen. Wie ist es nun dem Lehrer möglich, Kindern einen interessanten und zugleich lehrreichen Unterricht zu bieten?
Bis zu den 80er Jahren war der Frontalunterricht / lehrerorientierter Unterricht die hauptsächlich verwendete Unterrichtsform in deutschen Schulen. Doch mit dieser Art der Wissensvermittlung erreichte der Lehrer immer seltener Interesse bei den Schülern. Jörg Ramseger brachte 1977 in seinem Buch „Offener Unterricht in der Erprobung: Erfahrungen mit einem didaktischen Modell“ als erster die neue Idee der Öffnung des Unterrichts an die Öffentlichkeit. In diesem Buch wurde unter anderem anhand von Fallstudien, Unterrichtsdokumenten und Beobachtungsprotokollen überprüft, inwiefern Kinder einen Einfluss auf den Ablauf des Unterrichts haben (vgl. Ramseger, 1977, S.1). Dieser neu gelegte Grundstein „Offener Unterricht“ bildete nach und nach eine weitere Unterrichtsform neben dem Frontalunterricht.
Offener Unterricht fasst verschiedene Instrumente des abwechslungsreichen Lehrens zusammen. Dazu gehören zum Beispiel Freiarbeit, Tagespläne und Wochenpläne.
In dieser Arbeit wird im Theorieteil die Definition und Bestandteile des Offenen Unterrichts vorgestellt und dabei hauptsächlich auf die Funktion des Wochenplans eingegangen. Im darauffolgenden Praxisteil wird anhand eines selbsterstellten Unterrichtsbeispiels die Wochenplanarbeit dargestellt und Vor- sowie Nachteile ausgearbeitet. Dies basiert auf dem Hintergrund eines typischen Themenbereiches aus dem Sachunterricht. Im Resümee folgt eine kurze Zusammenfassung des Schwerpunktthemas und eine Prognose über die pädagogische Bedeutung der Wochenplanarbeit in der zukünftigen Unterrichtsgestaltung.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Definition und Bestandteile des Offenen Unterricht
2.1 Definition Offener Unterricht
2.1.1 Formen Offenen Unterrichts
2.2 Der Begriff Wochenplan
2.2.1 Verschiedene Varianten des Wochenplans
3. Wochenplan in der Praxis mit Bezug zum Sachunterricht
3.1 Skizzierung einer Unterrichtseinheit
3.2 Der Wochenplan zum Thema Pflanzen
Sachunterricht
3.3 Auswertung der Wochenplanarbeit und ihre pädagogische Bedeutung
4. Resümee
Literaturverzeichnis
Anhang
Abbildung I
Abbildung II
Arbeitsblatt Nummer
Arbeitsblatt Nummer
Arbeitsblatt Nummer
1. Einleitung
Kinder stellen hohe Anforderungen an ihren Lehrer und den Unterricht. Sie erwarten keine eintönige Belehrung, sondern fordern Abwechslung und Freude am Lernen. Wie ist es nun dem Lehrer möglich, Kindern einen interessanten und zugleich lehrreichen Unterricht zu bieten?
Bis zu den 80er Jahren war der Frontalunterricht / lehrerorientierter Unterricht die hauptsächlich verwendete Unterrichtsform in deutschen Schulen. Doch mit dieser Art der Wissensvermittlung erreichte der Lehrer immer seltener Interesse bei den Schülern. Jörg Ramseger brachte 1977 in seinem Buch „Offener Unterricht in der Erprobung: Erfahrungen mit einem didaktischen Modell“ als erster die neue Idee der Öffnung des Unterrichts an die Öffentlichkeit. In diesem Buch wurde zum Beispiel anhand von Fallstudien, Unterrichtsdokumenten und Beobachtungsprotokollen überprüft, inwiefern Kinder einen Einfluss auf den Ablauf des Unterrichts haben (vgl. Ramseger, 1977, S.1). Dieser neu gelegte Grundstein „Offener Unterricht“ bildete nach und nach eine weitere Unterrichtsform neben dem Frontalunterricht.
Offener Unterricht fasst verschiedene Instrumente des abwechslungsreichen Lehrens zusammen. Dazu gehören zum Beispiel Freiarbeit, Tagespläne und Wochenpläne.
In dieser Arbeit stellen wir im Theorieteil die Definition und Bestandteile des Offenen Unterrichts vor und werden uns dabei hauptsächlich mit der Funktion des Wochenplans beschäftigen. Im darauffolgenden Praxisteil stellen wir anhand eines Unterrichtsbeispiels die Wochenplanarbeit dar und werden Vor- sowie Nachteile ausarbeiten. Dies basiert auf dem Hintergrund eines typischen Themenbereiches aus dem Sachunterricht. Im Resümee folgt eine kurze Zusammenfassung des Schwerpunktthemas und eine Prognose über die pädagogische Bedeutung der Wochenplanarbeit in der zukünftigen Unterrichtsgestaltung.
2. Definition und Bestandteile des Offenen Unterricht
2.1 Definition Offener Unterricht
„Sammelbegriff für unterschiedliche Reformansätze in vielfältigen Formen inhaltlicher, methodischer und organisatorischer Öffnung mit dem Ziel eines veränderten Umgangs mit dem Kind auf der Grundlage eines veränderten Lernbegriffs“ (Wallrabenstein, 1994, S. 54).
Jörg Ramseger, der das erste Mal 1977 vom Offenen Unterricht sprach (s.o.), baute seine Theorie auf bekannte pädagogische Traditionen von Pestalozzi bis Montessori, von den deutschen bis zu den französischen Reformpädagogen auf (vgl. Wallrabenstein, 1994, S. 54). Erst zehn Jahre später wurde diese neue Unterrichtsform durch Diedrich Benner pädagogisch anerkannt. Zudem forderte er eine Öffnung des Unterrichts in drei Dimensionen hinsichtlich der Thematik, der Methodik und der Institution. Die Ziele der thematischen Öffnung beziehen sich auf Inhalte und Erfahrungen, die aus der Lebenswirklichkeit der Kinder stammen oder mit ihnen in Bezug gebracht werden sollen. Daneben sollen Selbstverantwortung und gemeinsames Handeln gefördert werden. Die methodische Öffnung knüpft an neue Lernformen und die Einbeziehung der Schüler in die Unterrichtsgestaltung an. Durch die individuellen und gemeinsamen Lernformen wird die gemeinsame Unterrichtsplanung und die gegenseitige Hilfe durchführbar. Mittels einer institutionellen Öffnung soll die klassische Rollenverteilung Lehrer – Schüler aufgehoben werden. Schüler und Lehrer erarbeiten hierbei in Zusammenarbeit die für die Schüler ansprechenden Themen (vgl. Hintz / Pöppel / Rekus, 2001, S. 247f). Die Öffnung des Unterrichts in den drei Dimensionen wird deshalb für die Schüler immer relevanter, weil sich in der Lebenswelt der Kinder heutzutage einiges verändert hat. Kinder fordern immer mehr Abwechslung und die Behandlung für sie interessanter Themen. Durch das Einbringen eigener Wünsche sollen die Schüler motiviert werden, sich mit den Unterrichtsinhalten auseinander zusetzen. Der Lehrer verbindet in diesem Modell Unterricht und Erziehung, indem er den Kindern Handlungsspielräume, Herausforderungen, abwechselnde Aktivitäten und eine anregungsreiche Lernumwelt bietet (vgl. Drews, Schneider, Wallrabenstein, 2000, S. 141f). Durch dieses Konzept sollen die Kinder ganzheitliche Erfahrungen sammeln.
Die Öffnung soll nach innen und nach außen stattfinden. Innere Öffnung bezieht sich auf die Veränderung der Unterrichts- sowie der Klassenraumgestaltung. Die „Veränderung der Institution Schule zu ihrer Umwelt und zur außerschulischen Erfahrungswelt der Kinder“ (Wallrabenstein, 1994, S. 35) schlägt sich in der äußeren Öffnung nieder.
Die Ziele des Offenen Unterrichts beinhalten die Förderung des eigenverantwortlichen Handelns und die Stärkung des Selbstvertrauens und der Persönlichkeitsbildung der Schüler. Gleichzeitig werden Fertigkeiten, Wissen und Können, sowie Leistungs-, Sozial- und Arbeitsverhalten gewonnen und erweitert (vgl. www.offener-unterricht.de). Dabei ist es wichtig, die kultursichernde und qualifizierende Funktion der Schule beizubehalten.
2.1.1 Formen Offenen Unterrichts
Offener Unterricht setzt sich aus verschiedenen Methoden zusammen, welche nicht zur Kategorie Frontalunterricht oder lehrerorientierter Unterricht gezählt werden. Solche Methoden sind zum Beispiel der fächerübergreifend-projektorientierte Unterricht, die Freiarbeit und der Wochenplan.
Der fächerübergreifend-projektorientierte Unterricht beschreibt eine Form des Offenen Unterrichts, in der die Schüler durch eigenständiges Ergründen von Arbeitsweisen und Methoden über mehrere Unterrichtsstunden hinweg fachbezogene Zusammenhänge erarbeiten müssen. Zielsetzungen seitens der Schüler bestimmen die Unterrichtsinhalte und decken Schwierigkeiten und Fragestellungen anderer Fächer auf, wobei aber der Schwerpunkt auf einem bestimmten Fach liegen sollte. Der Lehrer hat hierbei die Aufgabe, dem Schüler in der Anfangsphase Orientierungsmöglichkeiten im Bezug auf die Unterrichtseinheit zu bieten und ihm die Wahl eines Lernziels zu ermöglichen. Der Schüler soll durch eigene Methoden und selbstgewählte Medien das Unterrichtsziel erreichen, bei dem ihm der Lehrer als Berater zur Seite steht (vgl. Hintz / Pöppel / Rekus, 2001, S.103ff).
Die Freiarbeitsmethode unterscheidet sich nur in einigen Bereichen vom fächerübergreifend-projektorientierten Unterricht. Viele Ziele, wie zum Beispiel das selbstständige Arbeiten und die Ausweitung der Sozialkompetenz sind in beiden Unterrichtsformen von großer Bedeutung. Bei der Freiarbeit ist die fächerübergreifende Komponente jedoch nicht gegeben. Hierbei ist es wichtiger, dass der Schüler sich über Gegenstände, Ziele, Methoden, Partner, Zeit und Ort seines Lernens entscheiden muss. Dadurch werden die didaktischen, methodischen, sozialen, zeitlichen und räumlichen Aspekte erfüllt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Schüler vor der Aufgabe steht, die gestellten Aufgaben durch verfügbare Materialien auf seine eigene Art und Weise zu lösen. Auch bei dieser Methode hat der Lehrer eine beratende Funktion und soll den Schülern selbstständiges Arbeiten und Lernbereitschaft zutrauen (vgl. Hintz / Pöppel / Rekus, 2001, S.116ff).
Auf die Wochenplanmethode wird im Weiteren näher eingegangen.
2.2 Der Begriff Wochenplan
Der Wochenplan bildet eine weitere Methode des Offenen Unterrichts. Die Schüler erhalten in diesem Rahmen einen individuellen Plan mit zu erfüllenden Aufgaben für eine Woche. Diesen erhält jedes Kind entweder für sich oder es gibt einen großen für alle ersichtlichen Plan. Die Aufgaben sind teilweise verpflichtend, zum Teil als freiwilliges Angebot. Diese sollen die Schüler alleine oder in Gruppen bearbeiten und möglichst selbst überprüfen. Die Aufgaben des Wochenplanes ergeben sich aus dem aktuellen Unterrichtsthema. Sowohl die freiwilligen als auch die Pflichtaufgaben werden daher vom Lehrer ausgewählt und zusammengestellt. Die freie Arbeit im Rahmen eines Wochenplans hat dadurch den Nutzen, die Arbeit der Kinder relativ eng am Lehrplan anzubinden und kann zusätzlich fächerübergreifende Aspekte beinhalten. Durch Beinhaltung der Pflichtaufgaben sollten alle Schüler am Ende der Woche ein bestimmtes Pensum der Aufgaben bewältigt haben. Die freiwilligen Aufgaben dienen zum Auffangen der unterschiedlichen Lerntypen und dem damit verbundenen Leistungsstandart jedes einzelnen Kindes. Das bedeutet im Idealfall, dass jedes Kind durchgängig beschäftigt ist.
Der Wochenplan ist ein wichtiges Hilfsmittel für die Gestaltung, Planung und Kontrolle der Lernarbeit im Offenen Unterricht. Dies sollte nur als methodisches Instrument verstanden werden, nicht als eine eigenständige Lernform, dies bildet nur der Offene Unterricht im Allgemeinen. Dennoch zieht der Wochenplan eine relativ große Wirkung nach sich, da er den Kindern einen „Freiraum für ein entdeckendes, praktisches Lernen und Selbstverantwortung“ (Wallrabenstein, 1994, S.97) ermöglicht und Aspekte und Durchsichtigkeit des Lernens festigt. Ein Ziel des Wochenplanes liegt darin, den Kindern das Organisieren ihrer eigenen Pläne anzueignen, sodass sie Selbstständigkeit und Pflichtbewusstsein, nicht nur ihren Aufgaben gegenüber, entwickeln. Zusätzlich hierzu dient die Protokollierung der Arbeiten durch die Schüler, welches den Kindern hilft, ihr eigenes Arbeitstempo selbst abwägen zu können (vgl. Wallrabenstein, 1994, S.97f; vgl. Schloms, 1993, S.63f).
2.2.1 Verschiedene Varianten des Wochenplans
Der Wochenplan kann in drei verschiedenen Varianten ausgeführt werden:
Der geschlossene Wochenplan enthält nur Pflichtaufgaben, welches eine eigene Beteiligung der Schüler an der Themenauswahl ausschließt. Alle Schüler sollen im Rahmen des Wochenplans das gleiche Pensum an Aufgaben erledigen, wobei die Reihenfolge der Aufgabenbearbeitung frei wählbar ist. Der Lehrer steht den Schülern als individueller Berater zur Verfügung, gibt Hilfestellungen und leitet an.
Im differenzierten Wochenplan erhalten die Schüler sowohl für alle verbindliche Pflichtaufgaben, als auch freiwillige Zusatzaufgaben, die die Neigungen und Vorlieben der Schüler berücksichtigen. Im Unterschied zum geschlossenen Wochenplan sollte der Lehrer den Schülern die Möglichkeit geben, ihre eigene Ideen und Interessen in die Planung einzubringen. Diese Art der Wochenplanarbeit wird sich auch im praktischen Teil unserer Hausarbeit wiederspiegeln.
Der offene Wochenplan stellt gegenüber den anderen Varianten des Wochenplans wesentlich höhere Ansprüche an die Kinder. Das ergibt sich dadurch, dass die Schüler völlig eigenständig ihre Aufgaben und Aktivitäten angesichts der bereitgestellten Materialien für eine Woche planen müssen. Schon zu Beginn der Woche stehen die Schüler vor der Aufgabe, alles genau durchzuplanen und aufzuschreiben. Durch diese Komplexität ist diese Art des Wochenplanes nur für die Kinder geeignet, die bereits einschlägige Erfahrungen mit dieser Arbeitsform gemacht haben.
[...]