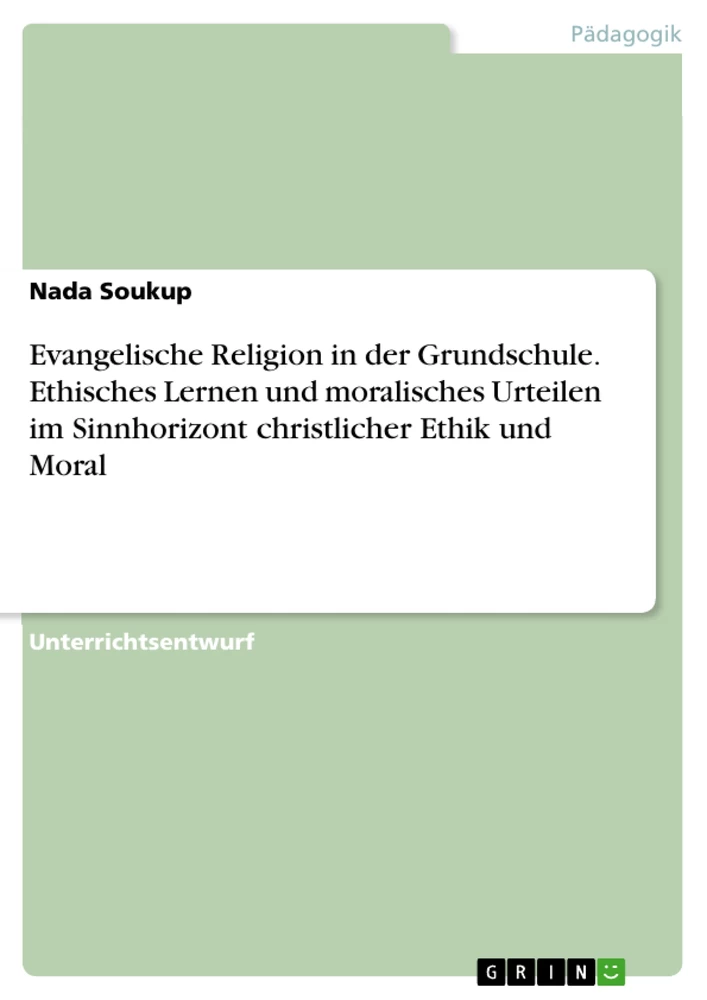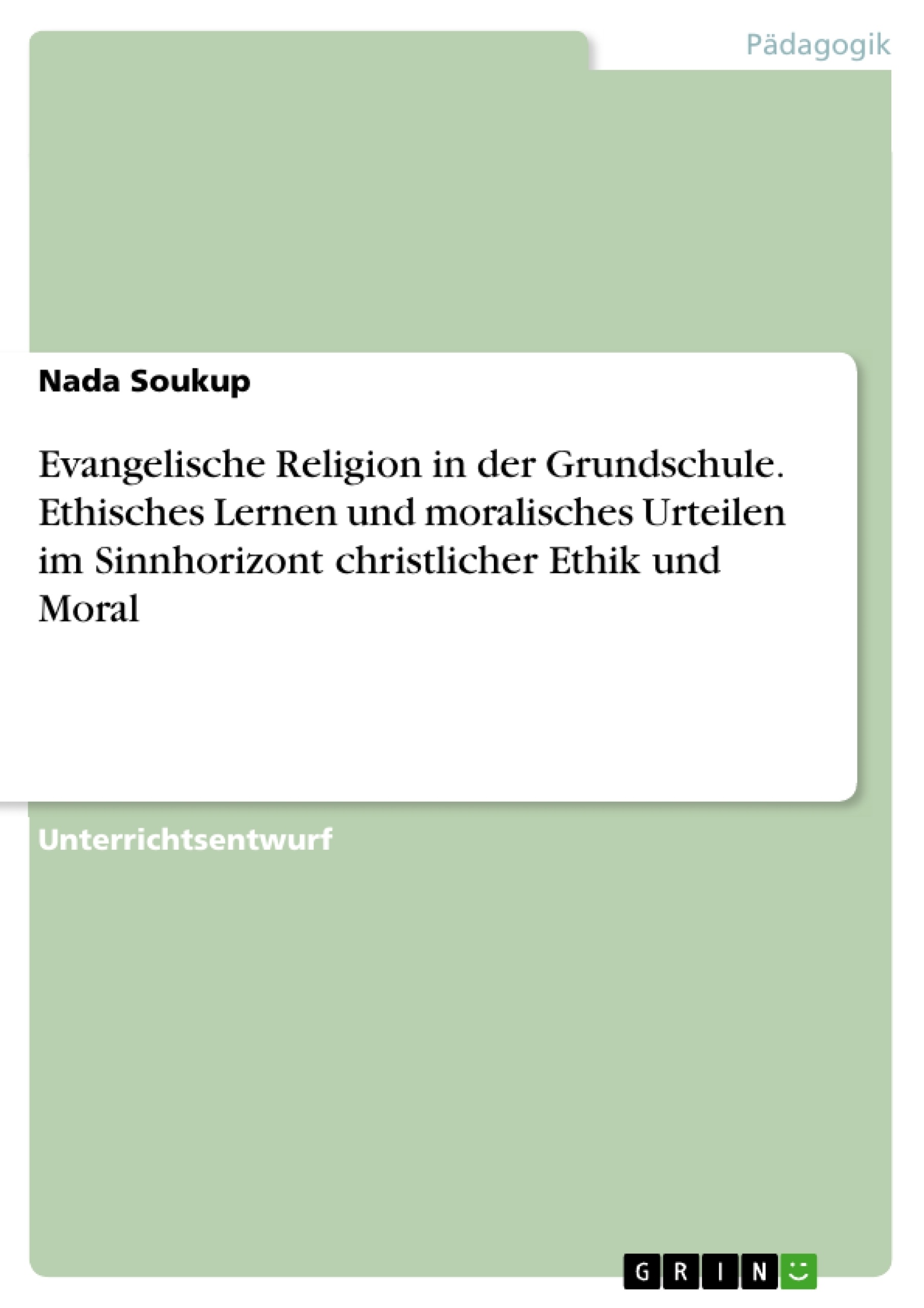Im Rahmen der Modulabschlussprüfung des Seminars „Unterrichtsgestaltung RU in der Primarstufe“ wird ein Unterrichtsentwurf für eine Unterrichtsstunde verfasst. Die Planung des Unterrichts soll ausgehend von der zu erwerbenden Kompetenz erfolgen und ist somit kompetenzorientiert. Neben der Vorgehensweise gilt es an dieser Stelle darauf aufmerksam zu machen, dass für die Planung der Unterrichtsstunde keine greifbare Lerngruppe zur Verfügung steht. Der Unterricht wird nicht auf spezifische Voraussetzungen der Lerngruppe abgestimmt, sondern die Planung orientiert sich an allgemein anzunehmenden entwicklungspsychologischen Leistungsständen der Schülerschaft.
Die Unterrichtseinheit ist geplant für die Durchführung in einer dritten Klasse. Für die Einheit ist ein Zeitraum von 4,5 Wochen angedacht, wobei wöchentlich von zwei Unterrichtsstunden Religion à 45 Minuten ausgegangen wird. Die Unterrichtsreihe zum Thema „Ethisches Lernen und moralisches Urteilen im Sinnhorizont christlicher Ethik und Moral“ soll insgesamt 9 Unterrichtsstunden umfassen. Ausführlich dargestellt wird die Unterrichtsstunde 7. in der eine Dilemmageschichte zum Thema „Freundschaft und Verantwortung“ behandelt werden soll. Die behandelte Thematik lässt sich dem Inhaltsfeld „Mensch und Welt“ (Hessisches Kultusministerium, 2011) zuordnen.
Die kompetenzorientierte Aufgabe unterteilt sich in zwei Arbeitsaufträge, welche aufeinander aufbauen und in zwei verschiedenen Unterrichtsstunden bearbeitet werden sollen. Der Leistungsnachweis dient in diesem Fall nicht der Bewertung, sondern soll zur Diagnose des Lernstands der Schüler und Schülerinnen dienen. Folgende kompetenzorientierte Aufgabe orientiert sich an den Kriterien von Feind und Wittmann (2010) hinsichtlich der Konstruktion einer solchen Aufgabenstellung.
Inhaltsverzeichnis:
1 Einleitung
1.1 Einleitung
1.2 Hinführung zum Thema
2 Kompetenzorientierte Anforderungssituation
3 Elementarisierung
3.1 elementare Zugänge
3.2 elementare Erfahrungen
3.3 elementare Strukturen
3.4 elementare Lernformen
3.5 elementare Wahrheiten
4 Beschreibung der Unterrichtsstunde
4.1 Bezug der Unterrichtseinheit/-stunde zum hessischen Kerncurriculum
4.2 Einordnung in die Unterrichtseinheit
4.3 Kriteriengeleitete Begründung der Methoden, Medien und Sozialformen
5 Unterrichtsverlauf in Tabellenform
6 Literaturverzeichnis und Anhang
7 Genderhinweis