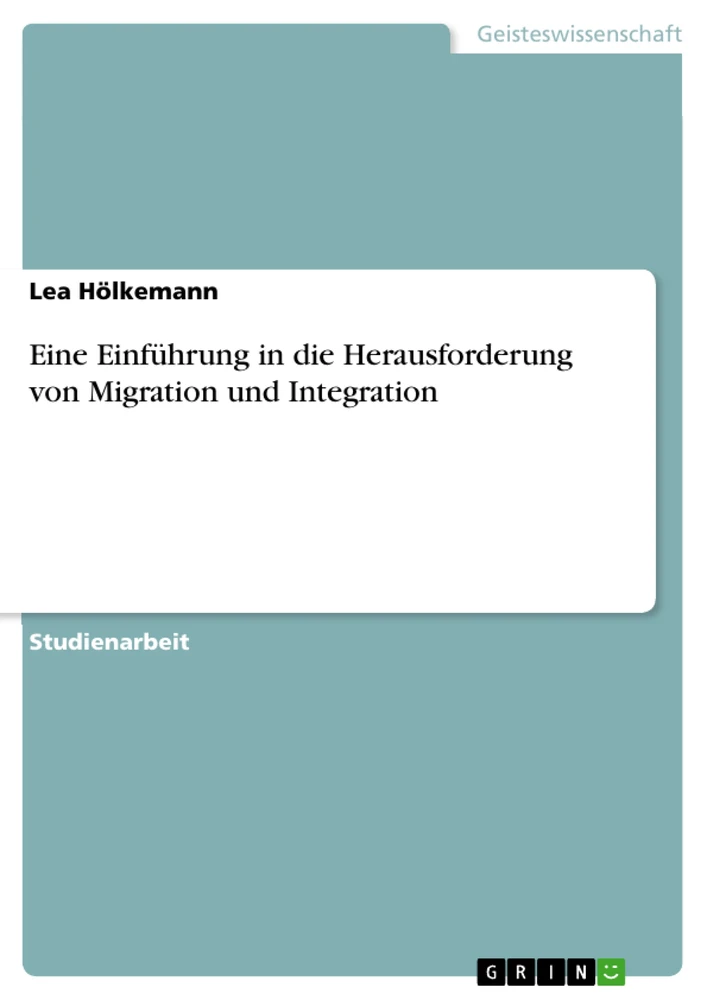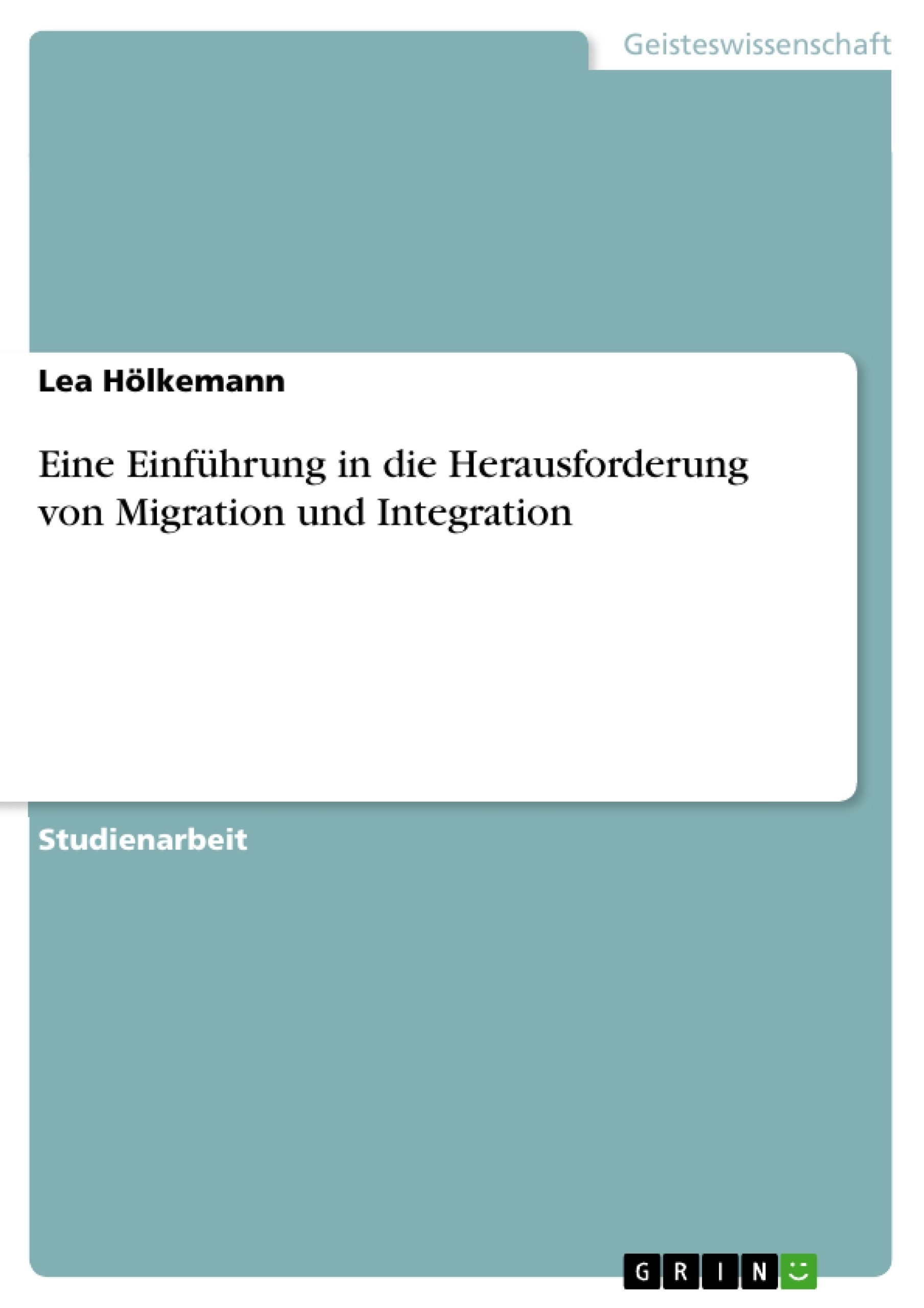In den letzten Jahren ist der Anteil der ausländischen Bevölkerung in Deutschland bezogen auf die Gesamtbevölkerung stetig angewachsen. Im Jahre 2013 lag der Anteil der Ausländer bei 8,7%. Fünf Jahre später ist der Anteil bereits auf 12,2% gestiegen. Wesentliche Gründe sind die gewaltsamen Konflikte in den Ländern Syrien, Afghanistan, Iran und Irak. Besonders in Syrien wurden schätzungsweise 400.000 Menschen bereits im Jahre 2016 getötet. Ein weiterer Grund liegt in der Verfolgung und Diskriminierung der Menschen durch Terrororganisationen, wie der Islamische Staat in Syrien, die Taliban in Afghanistan und Pakistan oder al-Shabaab in Somalia.
Diese Arbeit untersucht, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und wissenschaftlicher Studien, in welcher Situation Migranten bzw. Geflüchtete sind, wenn sie im Zielland angekommen sind und wenn sie versuchen müssen, sich zu integrieren.
Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Migration. Diese wird definiert und anhand der Ursachen und der Unterscheidung wesentlicher Zuwanderungsgruppen tiefer erläutert. Hierbei wird zwischen (Spät-)Aussiedlern, Arbeitsmigranten und Kriegsflüchtlingen/ Asylsuchenden unterschieden. Anschließend werden vier Beispiele psychosozialer Folgen der Migranten untersucht.
Des Weiteren wird in dieser Arbeit der Prozess der Integration analysiert. Hierbei wird die Integration in der Soziologie von der allgemeinen Definition des Integrationskonzepts abgegrenzt. In der Definition der Integration in der Soziologie wird zwischen der Sozial- und Systemintegration unterschieden. Innerhalb der Sozialintegration werden vier Grundprozesse der Integration erläutert. Bevor im Fazit die Arbeitsergebnisse zusammengefasst werden, wird im allgemeinen Integrationskonzept zwischen der Integration als Ergebnis oder als Prozess segregiert.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Migration
2.1 Migrationsursachen
2.2 Zuwanderungsgruppen
2.2.1 Arbeitsmigration
2.2.2 (Spät-)Aussiedler
2.2.3 Asylsuchende und Kriegsflüchtlinge
2.3 Psychosoziale Folgen von Migration
3 Einführung in die Integration
3.1 Integration in der Soziologie
3.2 Definition des Integrationskonzepts
4 Fazit
Literaturverzeichnis
1 Einleitung
In den letzten Jahren ist der Anteil der ausländischen Bevölkerung in Deutschland bezogen auf die Gesamtbevölkerung stetig angewachsen. Im Jahre 2013 lag der Anteil der Ausländer bei 8,7%. Fünf Jahre später ist der Anteil bereits auf 12,2% gestiegen (vgl. Statistisches Bundesamt 2019: S.19). Wesentliche Gründe sind die gewaltsamen Konflikte in den Ländern Syrien, Afghanistan, Iran und Irak. Besonders in Syrien wurden schätzungsweise 400.000 Menschen bereits im Jahre 2016 getötet. Ein weiterer Grund liegt in der Verfolgung und Diskriminierung der Menschen durch Terrororganisationen, wie der Islamische Staat in Syrien, die Taliban in Afghanistan und Pakistan oder al-Shabaab in Somalia (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung).
Diese Arbeit untersucht, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und wissenschaftlicher Studien, in welcher Situation Migranten1 bzw. Geflüchtete sind, wenn sie im Zielland angekommen sind und wenn sie versuchen müssen, sich zu integrieren.
Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Migration. Diese wird definiert und anhand der Ursachen und der Unterscheidung wesentlicher Zuwanderungsgruppen tiefer erläutert. Hierbei wird zwischen (Spät-)Aussiedlern, Arbeitsmigranten und Kriegsflüchtlingen/ Asylsuchenden unterschieden. Anschließend werden vier Beispiele psychosozialer Folgen der Migranten untersucht.
Des Weiteren wird in dieser Arbeit der Prozess der Integration analysiert. Hierbei wird die Integration in der Soziologie von der allgemeinen Definition des Integrationskonzepts abgegrenzt. In der Definition der Integration in der Soziologie wird zwischen der Sozial- und Systemintegration unterschieden. Innerhalb der Sozialintegration werden vier Grundprozesse der Integration erläutert. Bevor im Fazit die Arbeitsergebnisse zusammengefasst werden, wird im allgemeinen Integrationskonzept zwischen der Integration als Ergebnis oder als Prozess segregiert.
2 Migration
Das Wort Migration stammt von dem lateinischen Wort „ migrare“ ab und bedeutet wandern. Die Migration beschreibt die Wanderung Einzelner oder Gruppen und kann innerhalb von Staaten oder über Grenzen geschehen (vgl. Tießler-Marenda 2017: S. 583).
Das Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge versteht unter Migration, „wenn eine Person ihren Lebensmittelpunkt räumlich verlegt. Von internationaler Migration spricht man dann, wenn dies über Staatgrenzen hinweg geschieht.“ (Razum, O. & Spallek, J. 2009).
2.1 Migrationsursachen
Bei den Ursachen für Migration unterscheidet man zwischen Push- und Pull-Faktoren. Zu Push-Faktoren zählen die tatsächlichen Gründe für die Migration. Hierzu zählen Vertreibung, politische oder religiöse Verfolgung sowie Krieg und Naturkatastrophen. Im Gegensatz zu den Push-Faktoren, begründen sich die Pull-Faktoren in der jeweiligen Attraktivität des Ziellandes. Damit sind Menschen gemeint, die aus eigenem Antrieb auf der Suche nach besseren Lebensperspektiven ihr Heimatland verlassen. Anreize können Arbeitschancen oder weitere soziale Gründe im Zielland sein (vgl. Han 2009: S.12).
Die Analyse der Migrationsursachen kann subjektiv, wie auch objektiv durchgeführt werden. Die subjektive Analyse bezieht sich auf die jeweilige individuelle Lage des Migranten mit seinen persönlichen Empfindungen. Eine objektive Analyse konzentriert sich dagegen auf die jeweilige politische und wirtschaftliche Lage des Herkunftslandes (vgl. Hamburger 2018: S.1013).
2.2 Zuwanderungsgruppen
Innerhalb der Migranten unterscheidet man aufgrund von verschiedenen Erwartungen und Motiven zwischen drei wesentlichen Zuwanderungsgruppen: den Arbeitsmigranten, den (Spät-)Aussiedlern und den Asylsuchenden und Kriegsflüchtlingen.
2.2.1 Arbeitsmigration
Ein Arbeitsmigrant hat in der Regel die Hoffnung auf eine Verbesserung des Lebens durch besser bezahlte Arbeit. In der Arbeitsmigration unterscheidet man zwischen zwei rechtlichen Zugängen: dem Nachfragemodell und dem Angebotsmodell. Beim Nachfragemodell ist in der Regel der Arbeitsvertrag bereits geschlossen. Der Migrant wird vom Zielland eingeladen Das Angebotsmodell basiert auf einem Auswahlverfahren mit einem Punktesystem. Wenn man ausgewählt wird darf man sich als Arbeitskraft im Einwanderungsland anbieten. Für das Auswahlverfahren ist der Qualifikationsgrad von Bedeutung. Einreisechancen werden verbessert, wenn im Zielland Engpässe bestehen. Beispielhaft kann dies bei Pflegeberufen aber auch im akademischen Umfeld beobachtet werden (vgl. Heckmann 2015: S. 26).
In den Jahren 1955 bis 1973 fand die Gastarbeitermigration in der Bundesrepublik Deutschland und in der Deutschen Demokratischen Republik statt. Es wurden Arbeitnehmer für den inländischen Markt gesucht und hierfür Anwerbeabkommen unter anderem mit Italien, Griechenland, Spanien und der Türkei abgeschlossen. Die Bundesrepublik sah ein sogenanntes Rotationsprinzip vor. Gastarbeiter sollten für drei Jahre bleiben und nach Ablauf der Zeit wieder zurück in ihr Herkunftsland geschickt und durch neue Gastarbeiter ersetzt werden. Dieses Rotationsprinzip ist aufgrund der Familienzuführungen von Gastarbeitern gescheitert. Mit dem Beginn der Ölkrise im Jahre 1973 und dem damit verbundenen Anstieg der Arbeitslosigkeit wurden diese Anwerbeabkommen von der Bundesrepublik gekündigt. Im Gegensatz zu der Bundesrepublik wurden in der DDR nur befristete Arbeitsverträge geschlossen und eine soziale Distanz im Alltag zu den Gastarbeitern angeordnet (vgl. Hamburger 2018: S. 1010f.).
Heutzutage können sich Europäer durch die EU-Osterweiterung und neuen Arbeitsmarktfreizügigkeitsregelungen innerhalb der Europäischen Union und der Schweiz ohne Visum aufhalten und arbeiten. Diese Regelungen führen zu fortlaufender Arbeitsmigration, die insbesondere im Pflege- und Gesundheitswesen zu beobachten ist. Aktuell sind circa 43% der in Deutschland lebenden Migranten EU-Staatsangehörige (vgl. Hamburger 2018: S.1011).
2.2.2 (Spät-)Aussiedler
Unter Spätaussiedlern versteht man deutsche Volkszugehörige aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und anderen osteuropäischen Ländern. Das Zentrum ihrer kulturellen Identität liegt in Deutschland. Sie sind die Nachfahren ehemaliger deutscher Auswanderer aus dem 18. Jahrhundert und Opfer der geopolitischen Neuordnung nach dem 2. Weltkrieg. Seit 1950 sind fast fünf Millionen Spätaussiedler zurück nach Deutschland gekommen. Die stärkste Zuwanderung lag mit knapp zwei Millionen Spätaussiedlern zwischen 1988 und 1994. Zu den dominanten Herkunftsregionen zählten in den 80er Jahren Polen und Rumänien. In den 90er Jahren kamen die meisten Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion (vgl. Heckmann 2015: S.40).
Heutzutage kann man einen schrittweisen Rückgang des Anteils der Spätaussiedler feststellen. Gründe liegen in schlechteren Sprachkompetenzen, schlechteren Qualifikationen und einer zunehmenden sozialen Diskriminierung. Trotz unterschiedlicher Eingliederungsmaßnahmen ist deshalb eine gesellschaftliche Integration oftmals nicht gelungen (vgl. Zwengel 2018: S.22f.).
2.2.3 Asylsuchende und Kriegsflüchtlinge
Unter Flüchtlingen versteht man Menschen, die aufgrund ihrer politischen Orientierung, ihrer Religion, ihrer Rasse oder der sozialen Gruppe in ihrem Herkunftsland verfolgt werden. Somit sind Kriegsflüchtlinge Menschen, die aufgrund von Krieg in ihrem Herkunftsland, Sicherheit in einem anderen Land suchen. Asylsuchende sind Menschen, die sich im Asylverfahren befinden. Die Asylanträge werden individuell bearbeitet und in dem Verfahren müssen die Asylsuchenden erklären, warum und wie sie verfolgt werden. Daraufhin wird beurteilt, ob der Bewerber asylberechtigt ist, den Flüchtlingsstatus bekommt oder beide Möglichkeiten abgelehnt werden (vgl. Schmickler 2015).
Der Asylstatus für Asylsuchende und Kriegsflüchtlinge ist ein individuell einklagbarer Rechtsanspruch. Es wird zwischen der Drittstaatenregelung, dem Flüchtlingsstatus und der humanitären Aufnahme unterschieden.
Die Drittstaatenregelung besagt, dass man eine Asylbewerbung nur im Land der Ersteinreise stellen darf. Diese Regelung gilt auf europäischer Ebene und wurde in der Genfer Flüchtlingskonvention im Jahre 1964 festgehalten. Demnach ist Asyl in Deutschland nur über Luft- oder Seeweg möglich. Dies ist wiederum ohne Visum schwierig (vgl. Heckmann 2015: S.28-30).
Der Flüchtlingsstatus bietet subsidiären Schutz. Dieser Schutz besteht aus einem Verbot der Abschiebung. Der subsidiäre Schutz wird gegeben, wenn die Asylberechtigung noch nicht bestätigt werden kann und im Herkunftsland keine Sicherheit gewährt ist (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2019).
Die humanitäre Aufnahme wurde bereits Ende des Vietnam-Kriegs angewendet und ist ein wesentlicher Teil der Resettlement-Politik. Demnach wird einem Geflüchteten Schutz gewährt, wenn er in absehbarer Zeit nicht in sein Herkunftsland zurückkehren kann. Flüchtlinge werden von ihrem Zufluchtsland in Länder überführt, die ihnen dauerhaften Schutz zugesagt haben (vgl. UNHCR).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Schutzformen für Geflüchtete in Deutschland (eigene Darstellung)
Aus der Vielfalt an Möglichkeiten Schutz zu bekommen wird deutlich, dass kein eindeutiges Einwanderungsgesetz existiert.
2.3 Psychosoziale Folgen von Migration
Die Entscheidung zur Migration ist langer Prozess. Wenn sich die Menschen für die Migration entscheiden, erleben sie eine radikale Veränderung, welche auch metaphorisch als Entwurzlung bezeichnet werden kann. Der israelische Soziologe fasst den Prozess wie folgt zusammen: „The process of immigration is a process of physical transformation from one society to another. Through it the immigration is taken out of a more or less stable social system and transplanted into another.” (Eisenstadt 1952: S.225).
Die kulturelle Veränderung löst bei den Migranten weitreichende psychosoziale Folgen aus. Es wird zwischen der soziologischen Bedeutung des Verlassens eines zugehörigen Bezugssystems und der Einwanderung in ein fremdes System im soziologischen Sinne unterscheiden. Mit der Einwanderung in das neue Einreiseland beginnt unmittelbar die Desozialisierung. Die gültigen kulturellen Werte und Normen der Einwanderer gelten im Zielland oftmals nicht mehr. Dieser Verlust löst Orientierungslosigkeit und existentielle Unsicherheit insbesondere in der Anfangsphase aus. Erst nachdem die Unsicherheit überwunden ist, kann die Lebensplanung beginnen (vgl. Han 2010: S.198f.).
Die Auswanderung hat für Emigranten weitreichende Folgen, die sich folgendermaßen differenzieren lassen:
a. „Verlassen des umfassenden Sinnzusammenhanges sozialer Handlungen durch die Emigration“ (Han 2010: S.207): In der funktionell-strukturellen Systemtheorie nach Niklas Luhmann werden einzelne soziale Systeme in Relation zur unendlichen Welt, also dem Außenbereich des sozialen Systems gesehen. Durch diese Systeme wird die Komplexität der Welt reduziert und es werden Sinnentwürfe gestaltet. Migranten verlassen ihren Sinnzusammenhang und sind so lange verhaltensunsicher, bis sie den neuen Sinnentwurf verstanden haben (vgl. Han 2010: S. 207f.).
b. „Verlassen der zugehörigen Sprachgemeinschaft“ (Han 2010: S.208): Erst durch lange sprachliche Sozialisation gelingt eine erfolgreiche Einbindung in soziale Gruppen. Die Alltags- und Schriftsprache sowie individuelle Artikulations- und Ausdrucksformen müssen sich hierfür entwickeln. Der Erlebnis- und Erfahrungsaustausch mit Hilfe der Sprache führt hierbei zu einem gemeinschaftlichen Zugehörigkeitsgefühl. Soziale Sicherheit entsteht, die mit dem Austritt aus Sprachgemeinschaften weitgehend verloren geht (vgl. Han 2010: S. 2018f.).
c. „Verlassen des identitätsbildenen Interaktionsrahmens durch die Emigration“ (Han 2010: S.210): Der Mensch ist ein soziales Wesen, welches Teil einer Gesellschaft ist. Außerhalb der sozialen Gruppen ist der Mensch nicht überlebensfähig. Die Persönlichkeit und die Identität entstehen durch die Einbindung in verschiedenen sozialen Gruppen. Integration verändert und prägt eigene Verhaltensmuster. Es entsteht eine kommunikative Basis, welche gleichzeitig einen Balanceakt zwischen Eigen- und Fremdbedürfnissen darstellt. Migranten verlieren durch das Verlassen ihrer sozialen Gruppen gleichzeitig ihr soziales Bezugssystem. Eigene Bedürfnisbefriedigung und Möglichkeiten der Selbstverwirklichung leiden. Die zwangsläufige Folge ist die psychosoziale Instabilität von Migranten (vgl. Han 2010: S. 210-213).
d. „Aufgabe der Berufsrolle durch die Emigration“ (Han 2010: S.213): Die Rolle des Berufs hat einen starken Einfluss auf die Emigration. Ein Beruf bindet in die Gesellschaft ein und fördert Interaktion. Durch die Tätigkeit in der Berufsrolle wird die Existenz gesichert und unter anderem der Lebensstandard und der gesellschaftliche Status festgelegt. Ohne eine berufliche Rolle wird man desintegriert und verliert Kontakte. Migranten geben in ihrem Herkunftsland ihre wichtigsten Beziehungen auf. Der eigentliche Sinn von Migration liegt in der Möglichkeit in einem fremden Land die Unsicherheiten zu verlieren. Entgegen der Erwartung wird die Unsicherheit am Anfang vergrößert. Man verliert sein traditionelles Rollenverständnis und muss die neuen Definitionen der Rollen im Einwanderungsland kennenlernen. Bis dies geschehen ist, wird primär in der Familie sozial interagiert (vgl. Han 2010: S. 213-216).
[...]
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung personenspezifischer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für jedes Geschlecht.