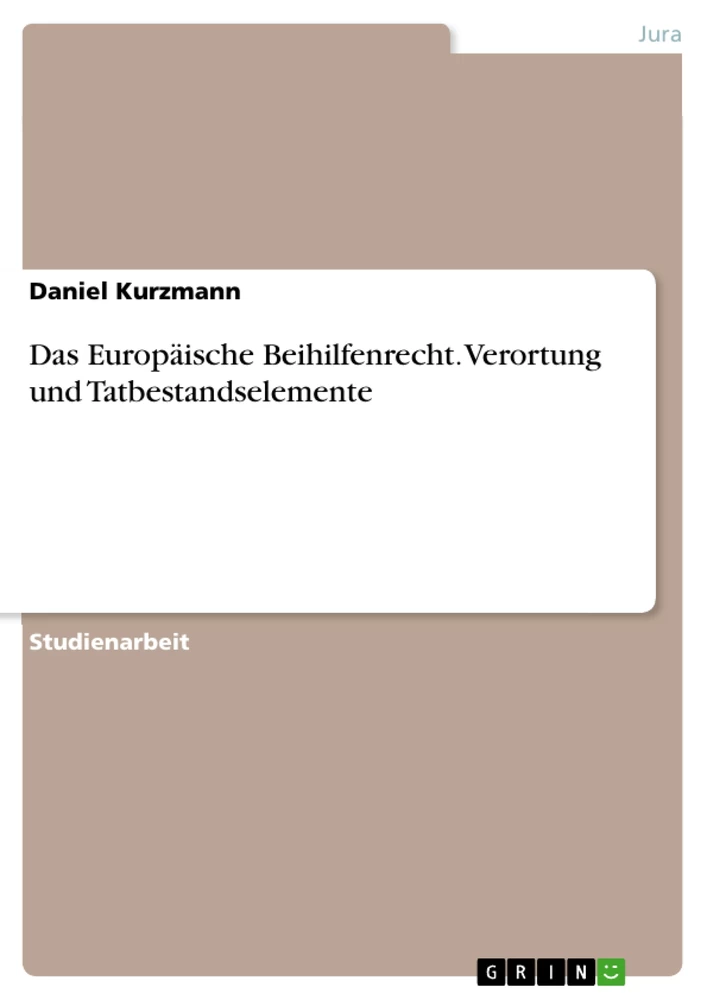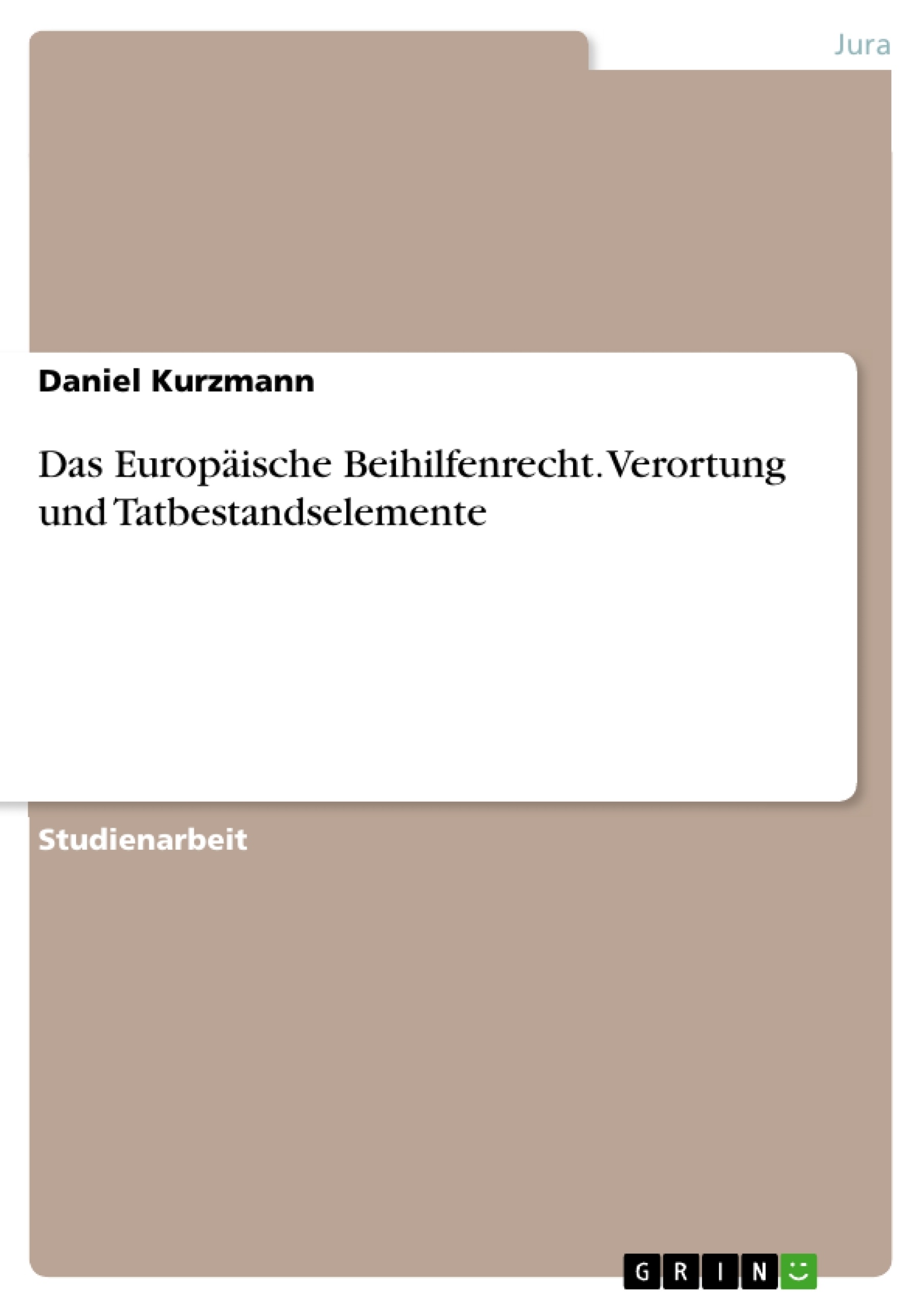Die vorliegende Seminararbeit widmet sich dem Europäischen Beihilfenrecht. Nach dessen anfänglicher systematischer und inhaltlicher Verortung wird der Beihilfebegriff definiert sowie die Tatbestandselemente des die Beihilfe regelnden Art. 107 Abs. 1 AEUV anhand ausgewählter EuGH-Rsp genau analysiert und diskutiert. Insbesondere wird dabei das Tatbestandselement der Staatlichkeit im Diskurs stehen.
Daran anschließend werden die sich in Ar. 107 Abs. 2 und 3 AEUV findenden Ausnahmen vom Beihilfenverbot besprochen. Nach einer Darstellung des in die Exklusivzuständigkeit der EK fallenden Beihilfeverfahrens wird ein Überblick über die Rechtsschutzmöglichkeiten gegen Beschlüsse der EK gegeben. Abschließend wird eine Zusammenfassung angeboten.
Inhalt
1. Einleitung
2. Verortung des Europäischen Beihilfenrechts
3. Beihilfen gem Art 107 Abs 1 AEUV
3.1 Begünstigung
3.2 Staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfe
3.3 Bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige
3.4 Wettbewerbsverfälschung
3.5 Beeinträchtigung zwischenstaatlichen Handels
4. Ausnahmen vom Beihilfenverbot
5. Beihilfeverfahren und Rechtsschutz
6. Schlussbemerkungen
Bibliographie und Quellenverzeichnis