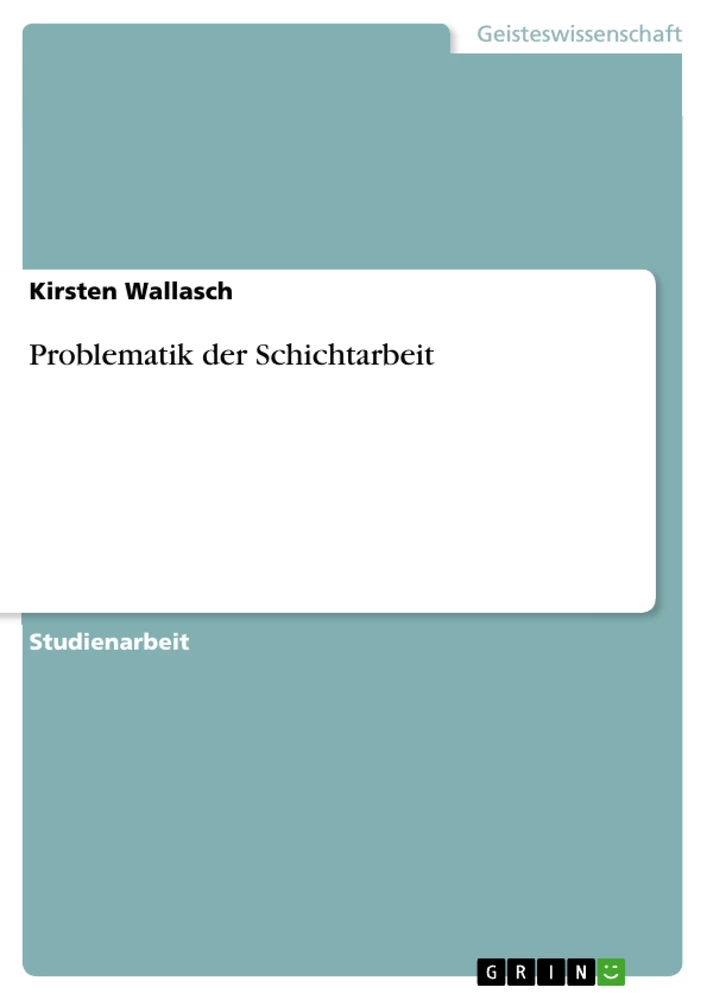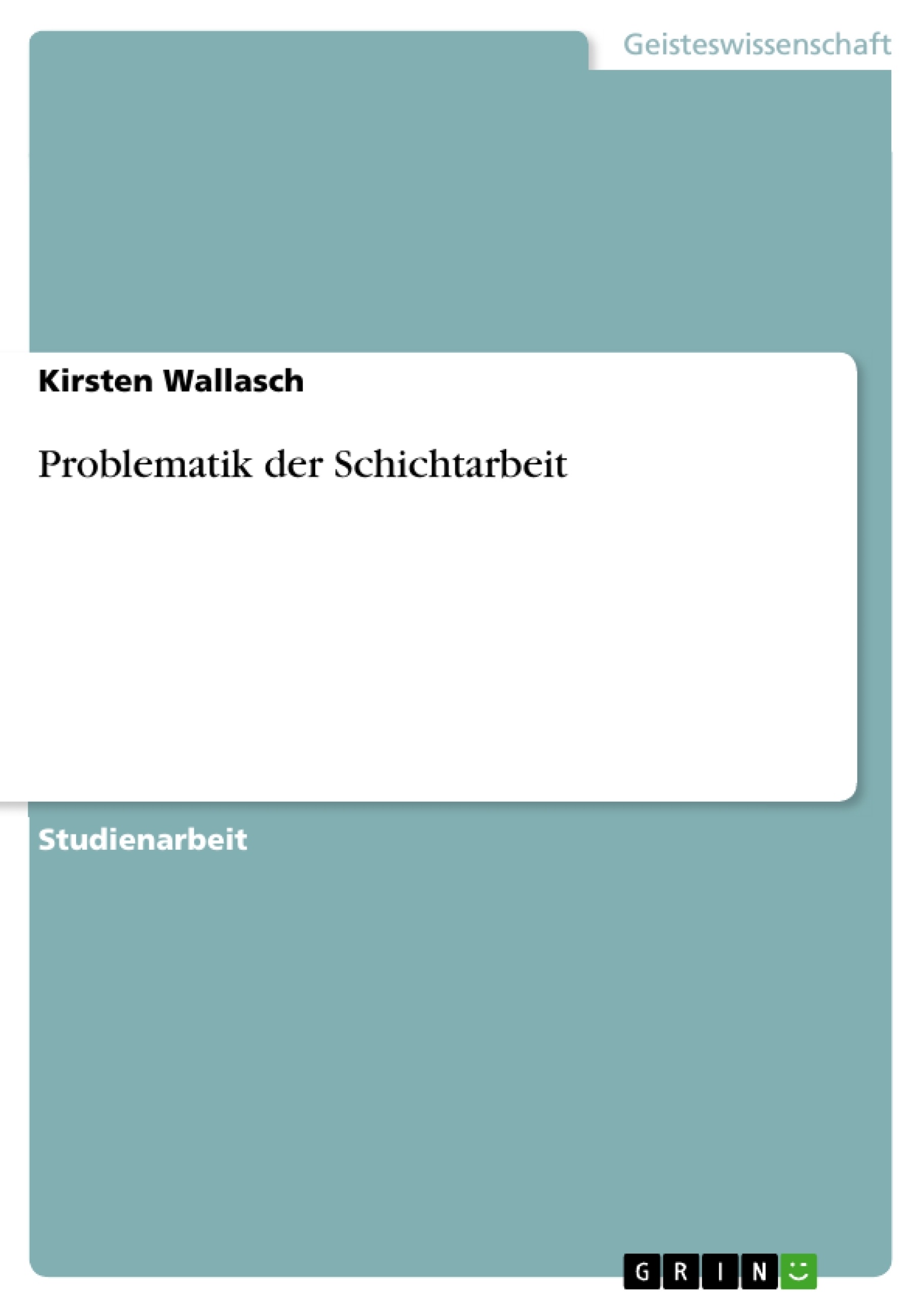Für Schicht- und Nachtarbeit gibt es gute Gründe. Sei es die Steigerung der Produktivität und Erhöhung der Effizienz in der Industrie, in der teure Maschinen Tag und Nacht bedient werden müssen. Im Dienstleistungssektor, wie z.B. im Verkehrswesen, der Gastronomie und der Sicherheitsbranche, wo Leistungen tags und nachts gleichermaßen benötigt werden. Oder im sozialen und pflegerischen Bereich, in denen Menschen auf die Versorgung und Betreuung „rund um die Uhr“ durch das Personal angewiesen sind. Doch wie geht es diesen Menschen, die in Schichten, also zu wechselnden Zeiten und auch nachts ihre Arbeit verrichten? „Ergebnisse zum Forschungsschwerpunkt Nacht- und Schichtarbeit aus dem Programm ‚Humanisierung des Arbeitslebens’ haben zu der Erkenntnis geführt, dass regelmäßige Arbeitszeiten, die von der gängigen Tagesarbeitszeit zwischen 7.00 und 19.00 Uhr abweichen, zu sozialen Benachteiligungen und gesundheitlichen Risiken bzw. Störungen führen können.“ (Hahn 1987, S.3) Was dabei genau mit Nacht- und Schichtarbeit gemeint ist, wo sie ihren Ursprung hat, welche Faktoren sich im einzelnen auf das Befinden des Schichtarbeiters auswirken, welche Risiken die Schichtarbeit für die Gesundheit des Mitarbeiters birgt und wie man ihnen entgegensteuern kann, soll die folgende Abhandlung erläutern.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffsdefinitionen Schichtarbeit
3. Merkmale der Schichtarbeit
4. Geschichte und Ursachen der Schichtarbeit
5. Gesetze und Vorschriften zur Schichtarbeit
6. Auswirkungen der Schichtarbeit auf den Menschen
6.1 Gesundheitliche Belastungen
6.2 Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit und Erhöhung der Unfallrisiken
6.3 Auswirkungen auf das soziale Leben
7. Gegenreaktionen der Arbeitnehmer
8. Handlungsempfehlungen, um Problemen der Schichtarbeit entgegen zu wirken
8. Resümee
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Für Schicht- und Nachtarbeit gibt es gute Gründe. Sei es die Steigerung der Produktivität und Erhöhung der Effizienz in der Industrie, in der teure Maschinen Tag und Nacht bedient werden müssen. Im Dienstleistungssektor, wie z.B. im Verkehrswesen, der Gastronomie und der Sicherheitsbranche, wo Leistungen tags und nachts gleichermaßen benötigt werden. Oder im sozialen und pflegerischen Bereich, in denen Menschen auf die Versorgung und Betreuung „rund um die Uhr“ durch das Personal angewiesen sind.
Doch wie geht es diesen Menschen, die in Schichten, also zu wechselnden Zeiten und auch nachts ihre Arbeit verrichten? „Ergebnisse zum Forschungsschwerpunkt Nacht- und Schichtarbeit aus dem Programm ‚Humanisierung des Arbeitslebens’ haben zu der Erkenntnis geführt, dass regelmäßige Arbeitszeiten, die von der gängigen Tagesarbeitszeit zwischen 7.00 und 19.00 Uhr abweichen, zu sozialen Benachteiligungen und gesundheitlichen Risiken bzw. Störungen führen können.“ (Hahn 1987, S.3) Was dabei genau mit Nacht- und Schichtarbeit gemeint ist, wo sie ihren Ursprung hat, welche Faktoren sich im einzelnen auf das Befinden des Schichtarbeiters auswirken, welche Risiken die Schichtarbeit für die Gesundheit des Mitarbeiters birgt und wie man ihnen entgegensteuern kann, soll die folgende Abhandlung erläutern.
2. Begriffsdefinitionen Schichtarbeit
„Als Schichtarbeit bezeichnet man eine Arbeit, die zu ‚konstant ungewöhnlicher’ Arbeitszeit (permanentes Schichtsystem) oder zu wechselnder Tageszeit (Wechselschichtsystem) an einem konstanten Betriebsmittelpotential vollzogen wird [vgl. Müller-Seitz 1980, 13].“ (Scholz 1993, S. 336) „Unter Schichtarbeit fasst man alle jene Formen der Arbeitszeitorganisation zusammen, bei denen Arbeit entweder zu wechselnder Zeit (z.B. Wechselschicht) oder zu konstanter, aber ungewöhnlicher Zeit (z.B. Dauer- Nachtschicht) ausgeführt werden muss. Schichtarbeit ergibt sich dabei immer aus der Tatsache, dass die gleiche Tätigkeit zu verschiedenen Abschnitten des Tages und der Nacht von verschiedenen Arbeitnehmern am gleichen Arbeitsplatz ausgeführt werden muss. (...) Schichtarbeit muss man damit als eine Arbeitszeitorganisation betrachten, die vor allem in tageszeitlicher Hinsicht wesentlich von der Regelarbeitszeit (Normalschicht) der Durchschnitts- bevölkerung abweicht; als Regelarbeitszeit wird im allgemeinen eine Verteilung der Arbeitszeit in der Zeit zwischen 6.00 und 17.00 Uhr auf der Grundlage der Fünftagewoche und der Vierzigstundenwoche bezeichnet.“ (Rutenfranz/ Knauth 1987, S.8)
3. Merkmale der Schichtarbeit
Wie bereits in den Definitionen zum Ausdruck gekommen ist, weicht die Schichtarbeit von der Regelarbeitszeit ab und ist daher anders organisiert. Es gibt inzwischen viele verschiedene Schichtsysteme, die sich aber alle durch folgende Merkmale beschreiben lassen [vgl. Knauth/Rutenfranz 1987, S.550- 552]:
Die Schichtkontinuität macht Aussagen über den durch das Schichtsystem abgedeckten Bereich. Dabei gilt es im wesentlichen zwei Systeme zu unterscheiden:
Diskontinuierliche Systeme organisieren die Arbeitszeit unter Ausschluss der Sonn- und Feiertage, kontinuierliche Systeme schließen auch Sonn- und Feiertagsarbeit ein. Die Schichtlänge gibt Auskunft über die Dauer der Schicht in Zeiteinheiten. In der Industrie trifft man am häufigsten Modelle mit 8 oder 12 Stunden- Schichten an, im Pflege- bzw. Jugendhilfebereich auch 24 Stunden-Schichten (u. U. mit eingeschobenen Bereitschaftszeiten).
Die Schichtwechselzeitpunkte geben die Anfangs- und Endzeiten der Schichten an und die Schichtfolge erläutert die Reihenfolge, in der Früh-, Spät und Nachtschichtperioden aufeinander folgen. Die Schichtwechselperiodik beschreibt dabei die Anzahl der gleichartigen nacheinander zu absolvierenden Schichten. Der Schichtwechselrhythmus bestimmt das Gleichmaß der aufeinander- folgenden Schichtwechselperioden und der Schichtzyklus beschreibt die Dauer des Schichtplans vom Beginn des Schichtplans, bis zu dem Tag, an dem sich das Schichtsystem auf den Wochentag wiederholt. Außerdem gilt es auf die Verteilung der Freizeit im Schichtsystem zu achten. (Vgl. Scholz 1993, S.336)
4. Geschichte und Ursachen der Schichtarbeit
Dass Menschen zu ungünstigen und wechselnden Zeiten arbeiten, ist keine neue Errungenschaft des Industriezeitalters. Schichtarbeit gab es schon von Anbeginn des organisierten Zusammenlebens von Menschen in Städten und Staaten. Die ursprünglichsten Bereiche der Schichtarbeit sind dabei die beschützenden Dienste, wie Wächter, Nachtwächter, Polizei, Feuerwehr und die helfenden Dienste, wie das Krankenhaus- und Hebammenwesen. (vgl. Rutenfranz/Knauth 1987, S.12)
Im Zuge der Industrialisierung Anfang des 19. Jahrhunderts erweiterte sich der Sektor der Schichtarbeit allerdings auf den produzierenden Arbeitsbereich aus. Die Erfindung der Dampfmaschine führte zu neuen Formen von Arbeitsplätzen und –bedingungen. Plötzlich gab die Maschine den Takt der Arbeit vor, dem sich der arbeitende Mensch anzupassen hatte. Die teuren Maschinen mussten Tag und Nacht laufen, um die effizient zu sein, da das Stillstehen der Maschinen einen enormen Zeit- und damit einhergehenden Gewinnverlust bedeuteten. Durch die Einführung eines Zwei-Schichtsystems wurde daher gewährleistet, dass immer genügend Arbeitskräfte zur Verfügung standen, die die Maschinen bedienten.
Damit sind schon zwei von drei Ursachen der Schichtarbeit genannt worden: Die technologischen Gründe und wirtschaftlichen Zwänge. In der produzierenden Industrie, vorwiegend in den Bereichen der Stahlindustrie und der chemischen Industrie, lassen sich qualitativ hochwertige Produkte nur herstellen, wenn der Produktionsprozess nicht andauernd unterbrochen wird. In der Stahlerzeugung werden Verfahren angewandt, die konstant hohe Temperaturen oder konstant hohe Drücke erfordern, die nur gewährleistet werden können, wenn die Maschinen in einem fort laufen. Dasselbe gilt für chemische Prozesse, die einen längeren Zeitraum benötigen als 8 Stunden, also der Normalarbeitszeit. Wirtschaftliche Zwänge ergeben sich aus ökonomischen Gründen. „Teure Maschinen und Anlagen machen sich nur dann in vernünftiger Zeit bezahlt, wenn sie täglich so lange wie eben möglich in Betrieb gehalten werden können.“ (Rutenfranz/Knauth 1987, S. 13) Hinzu kommt, dass der technische Fortschritt komplexe und dadurch kostspielige Anlagen schnell veralten und damit unrentabel werden lässt. Dadurch erscheint eine rationelle Produktion der Anlagen nur bei intensiver Ausnutzung denkbar.
Als dritte Ursache der Schichtarbeit ist noch die Versorgung der Bevölkerung zu nennen. Mit den Jahren sind die Anspruchserwartungen der Bevölkerung gegenüber den Dienstleistungsbranchen wie dem Verkehrswesen in Form von Bus-, Bahn- und Flugunternehmen, dem Gastronomie- und Hotelwesen, der Post, der Sicherheitsbranche in Form der Polizei oder auch privaten Sicherheitsdiensten, dem Pflege- und Fürsorgesektor in Form von Krankenhäusern, Altenheimen, ambulanten Pflegediensten und Jugendhilfe- oder Behinderteneinrichtungen enorm gewachsen.
Bereits im 19. Jahrhundert wurden allerdings Forderungen der Gewerkschaften laut, die wöchentliche und jährliche Arbeitszeit zu verkürzen, sowie die Nacht- und Wochenendarbeit einzuschränken, um physische und psychische
[...]