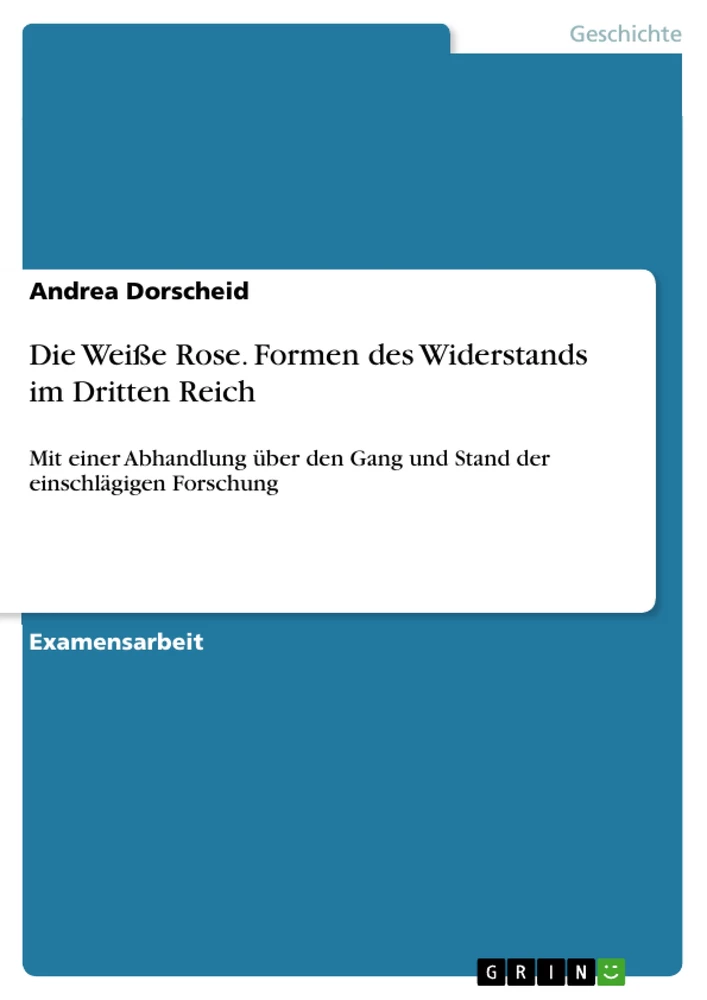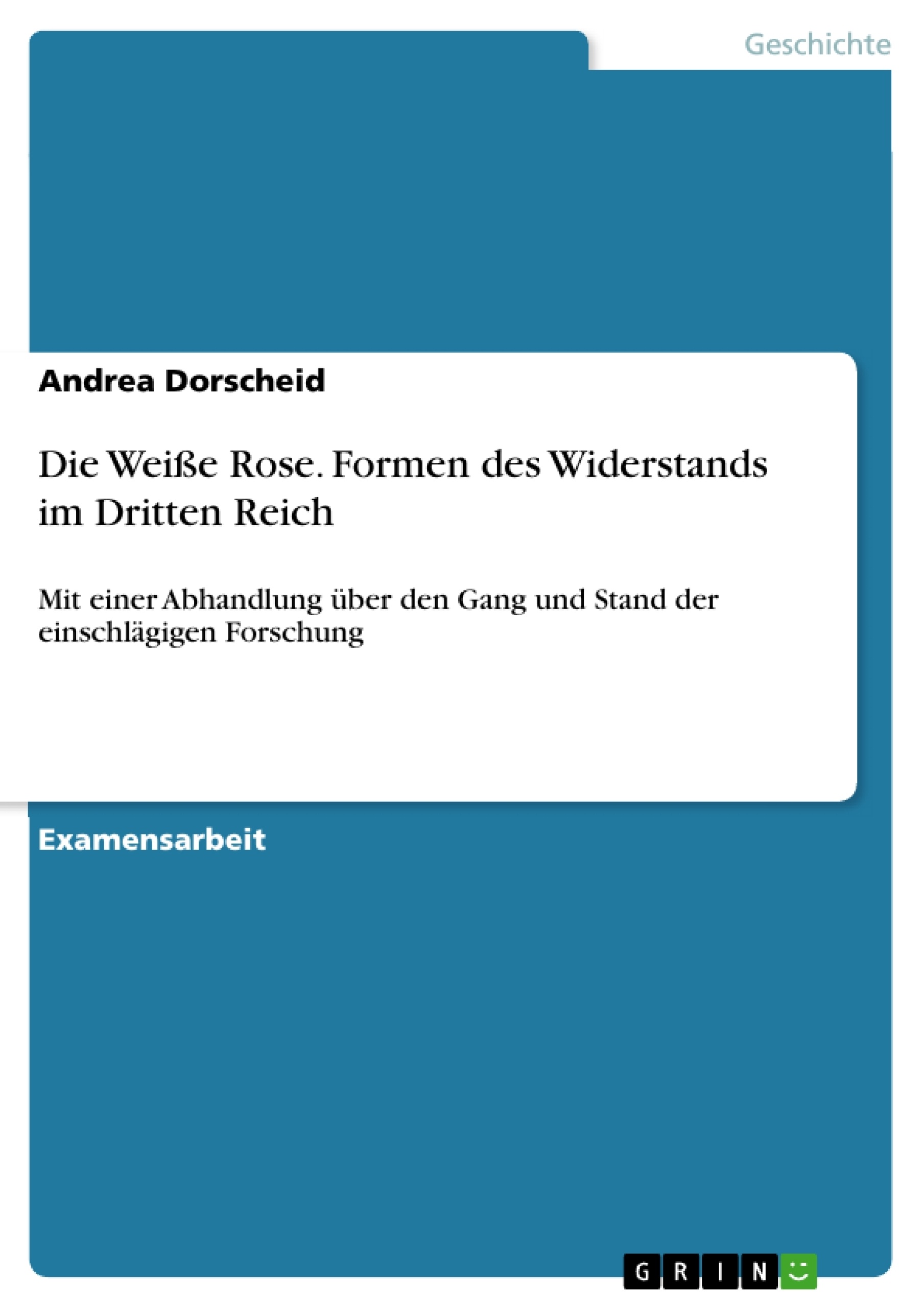Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus ist bis heute im historischen Bewußtsein der deutschen Bevölkerung unzureichend und oft nur durch einzelne Schlagworte verankert. Die unterschiedlichen Intentionen und Motive, welche die Widerstandskämpfer und -gruppen zu ihren Taten bewegten und veranlaßten, aus der Reihe der Mitläufer herauszutreten und den Weg des passiven oder aktiven Widerstandes zu gehen, werden oftmals unter dem weitreichenden und dehnbaren Begriff „Widerstand im dritten Reich“ zusammengefaßt und keiner differenzierten Betrachtung unterzogen. Dieser Umstand ist insoweit problematisch, als daß der Widerstand gegen das nationalsozialistische Terrorregime keine einheitliche Bewegung war.
So unterschieden sich sowohl die Formen des Widerstandes, die Begründungen, welche die Widerstandstätigkeit rechtfertigten, die Intensität des Widerstandes, als auch die Beweggründe, welche ihn motivierten. Letztere reichten nämlich von schlichter Empörung über die Rechtsbrüche des Diktators und der Partei bis zu der festen Überzeugung, Hitler sei der „Antichrist“, dem jeder gläubige Christ widerstehen und entgegenwirken müsse. Juristische und politische, ethische und religiöse Aspekte beeinflußten die unterschiedlichen Formen des Widerstandes und motivierten deren praktische Umsetzung.
Die Materie erfordert also eine genaue Differenzierung dieser verschiedenen Merkmale, um den einzelnen Widerstandskämpfern und -gruppen in angemessener Weise gerecht werden zu können.
[...]
Inhaltsverzeichnis
A. Einleitung
B. Herkunft und Jugend der Persönlichkeiten der Widerstandsbewegung die „Weisse Rose“
I. Hans und Sophie Scholl
II. Alexander Schmorell
III. Christoph Probst
IV. Willi Graf
V. Zusammenfassung
C. Vorgeschichte und Entstehung der „Weissen Rose“
I. Erste Begegnungen und Kontakte der Münchener Studenten
II. Bildung des Freundeskreises
III. Mentoren und Vorbilder der Münchener Studenten
1. Carl Muth
2. Theodor Haecker
3. Professor Kurt Huber
IV. Zusammenfassung
D. „Die Weisse Rose“ - Motivation, Erste Aktionen und Flugblätter der Widerstandsgruppe
I. „Die Weiße Rose“ - Herkunft und Bedeutung des Namens
II. Motivation der Münchener Widerstandskämpfer
III. Die ersten vier Flugblätter im Juni/Juli 1942
1. Der Charakter der Flugblätter
2. Die Zielsetzung der Flugblätter
IV. Zusammenfassung
E. Der Aufenthalt der Studenten in der Sowjetunion im Sommer 1942
F. Die Erweiterung des Widerstandskampfes im Winter 1942/43
I. Kontakte zu anderen Widerstandskämpfern
1. Falk Harnack
2. Die „Weiße Rose“ Hamburg
3. Heinz und Willi Bollinger - Verbündete Widerstandskämpfer aus dem Saarland
II. Das fünfte Flugblatt
III. Die Freiheitsparolen und das sechste Flugblatt
IV. Zusammenfassung
G. Der 18. Februar 1943 - Auslöser der Verhaftungen und Verhöre
H. Die Prozesse
I. Die nationalsozialistische Justiz - Der Volksgerichtshof
II. Der Prozeß gegen Hans Scholl, Sophie Scholl und Christoph Probst
III. Der Prozeß gegen Alexander Schmorell, Willi Graf, Professor Kurt Huber und andere
IV. Weitere Prozesse gegen die Weiße Rose in München
V. Zusammenfassung
I. „Und ihr Geist lebt trotzdem weiter“ - Hans Leipelt und die „Weisse Rose“ Hamburg
J. Zeitgenössische Darstellungen zum Topos „Weisse Rose“ und die entsprechenden Reaktionen hierauf in der Öffentlichkeit
I. Darstellung und Reaktion in der allgemeinen Öffentlichkeit in Deutschland
II. Darstellung und Reaktion im Ausland
K. Gang und Stand der einschlägigen Forschung
L. Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang: Dokumente
-Flugblätter der Weißen Rose (I-III)
-Anklageschrift gegen Hans Scholl, Sophie Scholl, Christoph Probst
-„Im Namen des Volkes“ - Urteilsbegründung in der Strafsache gegen Hans Scholl, Sophie Scholl, Christoph Probst
A. Einleitung
Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus ist bis heute im historischen Bewußtsein der deutschen Bevölkerung unzureichend und oft nur durch einzelne Schlagworte verankert.[1] Die unterschiedlichen Intentionen und Motive, welche die Widerstandskämpfer und -gruppen zu ihren Taten bewegten und veranlaßten, aus der Reihe der Mitläufer herauszutreten und den Weg des passiven oder aktiven Widerstandes zu gehen, werden oftmals unter dem weitreichenden und dehnbaren Begriff „Widerstand im dritten Reich“ zusammengefaßt und keiner differenzierten Betrachtung unterzogen. Dieser Umstand ist insoweit problematisch, als daß der Widerstand gegen das nationalsozialistische Terrorregime keine einheitliche Bewegung war. So unterschieden sich sowohl die Formen des Widerstandes, die Begründungen, welche die Widerstandstätigkeit rechtfertigten, die Intensität des Widerstandes, als auch die Beweggründe, welche ihn motivierten. Letztere reichten nämlich von schlichter Empörung über die Rechtsbrüche des Diktators und der Partei bis zu der festen Überzeugung, Hitler sei der „Antichrist“, dem jeder gläubige Christ widerstehen und entgegenwirken müsse. Juristische und politische, ethische und religiöse Aspekte beeinflußten die unterschiedlichen Formen des Widerstandes und motivierten deren praktische Umsetzung.[2]
Die Materie erfordert also eine genaue Differenzierung dieser verschiedenen Merkmale, um den einzelnen Widerstandskämpfern und -gruppen in angemessener Weise gerecht werden zu können.
Die Absicht dieser Darstellung ist deshalb, am Beispiel der Widerstandsgruppe Weiße Rose diese unterschiedlichen Kriterien, welche die Münchener Widerstandskämpfer beeinflußten und ihre Taten veranlaßten, zu untersuchen und die besondere Form des studentischen Widerstandes aufzuzeigen und näher zu durchleuchten. Gemessen an der Zahl wissenschaftlicher Publikationen über die Verschwörer des 20. Juli 1944 ist nämlich der studentische Widerstand -so Petry- „ein Stiefkind“[3] der zeitgeschichtlichen Forschung geblieben. Einen größeren Widerhall in der Bevölkerung fand lediglich die Widerstandsgruppe Weiße Rose, doch mangelt es trotz einer Vielzahl an Publikationen in Buch- und Aufsatzform auch hier an einer detaillierten wissenschaftlichen Gesamtstudie, welche die Münchener Ereignisse aufarbeitet und dokumentiert.[4]
Die Überlegungen zu den Möglichkeiten und Bedingungen studentischen Widerstands im dritten Reich setzen zunächst eine Definition des studentischen Widerstands voraus. Dieser ist nämlich erstens Widerstand von jungen Leuten und zweitens von Angehörigen einer Universität, bei denen ein gewisser Bildungsstand vorausgesetzt wird.[5] Aufgrund dessen ist es zum einen vonnöten, besonders die Jugend der Münchener Widerstandskämpfer zu durchleuchten, da im Hinblick auf ihren frühen Tod, dort die entscheidenden Ereignisse und Beweggründe für ihre Taten verankert sein müssen. Zum anderen bedarf es einer genauen Untersuchung, ob und inwiefern die Universität der bayerischen Landeshauptstadt zu ihrem Entschluß beitrug, aktiven Widerstand zu leisten. Das erste Kapitel (B) dieser Arbeit widmet sich daher ausführlich der Herkunft und Jugend der Widerstandskämpfer, bevor in Kapitel C auf die eigentliche Entstehung der Widerstandsgruppe eingegangen wird. Inwiefern diese nicht nur die Begegnungen und Kontakte der einzelnen Widerstandskämpfer voraussetzte, sondern auch des geistigen Zuspruchs älterer Gelehrter bedurfte, welche die Funktion von Mentoren und Vorbildern ausübten, wird ebenfalls in diesem Zusammenhang untersucht und thematisiert werden.
Die Motive, welche die Studenten schließlich dazu bewegten, ihre Widerstandsgedanken zu realisieren, aktiven Widerstand zu leisten und die ersten vier Flugblätter zu verfassen, werden ebenso wie der Charakter und die Zielsetzung der Blätter in Kapitel D aufgezeigt werden. Hierbei ist das vorrangige Ziel, die Frage zu klären, ob es sich um einheitliche Beweggründe handelte, oder ob vielmehr eine vielschichtige Motivationslage den Taten der Widerstandsgruppe Weiße Rose zugrunde lag. Weshalb die Abfassung und Verbreitung der Flugblätter im Juli 1942 schließlich unterbrochen wurde, wird durch den Aufenthalt der Studenten in der Sowjetunion, welcher ausführlich in Kapitel F geschildert wird, deutlich. Inwieweit er Einfluß auf die Erweiterung des Widerstandskampfes der Gruppe im Winter 1942/43 nahm, wird im anschließenden Kapitel (G) untersucht werden. Ebenfalls werden in diesem Zusammenhang die Kontakte zu anderen Widerstandskämpfern aufgezeigt werden, deren Unterstützung es zu verdanken war, daß sich die zunächst auf München beschränkte Basis des Widerstandes auf andere Städte Deutschlands ausdehnen konnte und so der Kreis der Widerstandskämpfer erweitert wurde. Inwiefern sich diese neuen Tendenzen auf die Inhalte des fünften und sechsten Flugblattes der Widerstandsgruppe niederschlugen und die im Februar 1943 stattfindenden Malaktionen motivierten, wird ebenfalls in Kapitel F untersucht werden.
Sowohl die Umstände, die schließlich zu der gefährlichen Aktion der Geschwister Scholl am 18. Februar 1943 führten, als auch die Auswirkungen, welche diese nach sich zog, werden in Kapitel G thematisiert werden. Die Analyse wird sich nicht nur auf die Tat als solche beschränken, sondern vielmehr ihre Funktion als Auslöser einer Welle von Verhaftungen und Verhören, welche schließlich die Widerstandstätigkeit der Münchener Gruppe beendeten, verdeutlichen.
Die Prozesse gegen die Weiße Rose besiegelten das Schicksal der Studenten. Zum besseren Verständnis der Urteile, welche unter menschenunwürdigen Umständen vom Volksgerichtshof gefällt wurden, beschränkt diese Arbeit sich in Kapitel H nicht nur auf die Wiedergabe der Prozeßverläufe und der Urteile, sondern wird zuvor auf die nationalsozialistische Justiz im allgemeinen und auf die Funktion des Volksgerichtshofes im besonderen eingehen.
Im weiteren Verlauf der Darstellung wird dann die Frage geklärt werden, ob durch die Vollstreckung der Urteile das Wirken der Widerstandsgruppe beendet wurde, oder ob vielmehr auch nach dem Tod der fünf Widerstandskämpfer ihre Ideen weitere Verwirklichung fanden und Gleichgesinnte die Widerstandstätigkeit der Weißen Rose fortsetzten.
Darüber hinaus ist es Absicht dieser Arbeit, mit Hilfe zeitgenössischer Darstellungen zum Topos Weiße Rose die allgemeinen Reaktionen der in- und ausländischen Öffentlichkeit auf die Taten und auf die Verurteilungen der Mitglieder widerzuspiegeln und einer kritischen Analyse zu unterziehen.
Abschließend wird in Kapitel K ein Überblick über den Gang und Stand der einschlägigen Forschung gegeben werden. Die Widerstandsgruppe Weiße Rose ist in den vergangenen Jahren in zahlreichen Gesamtdarstellungen zum deutschen Widerstand, Lexika, Schulbüchern etc. genannt und beschrieben worden. Alle einschlägigen Hinweise aufzuführen, würde den Rahmen dieser Darstellung sprengen, so daß kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird. Die vorliegende Arbeit verfolgt vielmehr das Ziel, die wichtigsten Etappen der Rezeptionsgeschichte in ihrer Zeitgebundenheit durchsichtig zu machen und die zwischen 1943 und 1998 erschienene einschlägige Literatur zu diesem Themenkomplex im Sinne einer kritischen Zeitgeschichts-, Biographie- und Sozialisationsforschung darzustellen und aufzuarbeiten.
B. Herkunft und Jugend der Persönlichkeiten der Widerstandsbewegung die „Weisse Rose“
Die fünf Persönlichkeiten der Widerstandsbewegung Weiße Rose hatten zum Zeitpunkt ihrer Hinrichtung, d.h. am 22. Februar, 13. Juli und 12. Oktober 1943, das Alter von 25 Jahren ausnahmslos noch nicht überschritten. Alexander Schmorell, der Älteste, war 25 Jahre alt, Sophie Scholl, die einzige Frau des engeren Kreises der Widerstandsgruppe, war mit ihren 21 Jahren das jüngste Mitglied. Hans Scholl und Willi Graf waren im Alter von 24 Jahren auf das Schafott geführt worden, Christoph Probst hatte im November 1942 seinen 23. Geburtstag gefeiert.
Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, zunächst Kindheit und Jugend der einzelnen Personen näher zu untersuchen, die Familienverhältnisse zu durchleuchten und nach den ersten und, wenn man das Alter des Todes berücksichtigt, auch den entscheidenden Eindrücken zu forschen, welche die Mitglieder beeinflußten, prägten und in ihren Handlungen motivierten.[6]
Es gilt nicht nur die Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, welche die Charaktere verbanden, angefangen bei den bürgerlichen Elternhäusern, über die literarischen, musischen und künstlerischen Neigungen, die die Mitglieder auszeichneten, bis zu dem gemeinsamen Wunsch der freien und persönlichen Entfaltung des Individuums. Darüber hinaus kommt es darauf an, die Unterschiede zu verdeutlichen, welche natürlich zwischen diesen fünf Persönlichkeiten bestanden haben.
I. Hans und Sophie Scholl
Hans Scholl wurde am 22. September 1918 als zweites Kind und ältester Sohn der Familie in Ingersheim an der Jagst geboren.[7] Sophie Scholl, am 9. Mai 1921 in Forchtenberg im Kochertal zur Welt gekommen, war das vierte Kind und die jüngste Tochter der Familie Scholl.[8] Gemeinsam verlebten Hans und Sophie ihre Kindheit und Jugend in einer „liberal-protestantischen Atmosphäre eines schwäbischen Bürgerhaushaltes“[9] mit den Eltern Robert und Magdalene Scholl, sowie mit ihren drei Geschwistern, Inge, Elisabeth und Werner.[10] Der Vater bekleidete, zunächst in Ingersheim, später auch in Forchtenberg, das Amt des Bürgermeisters, bis er 1930 als Wirtschaftsprüfer in Ulm tätig wurde und 1932 die Übernahme eines Treuhandbüros für Wirtschafts- und Steuerberatung einen Umzug in die Domstadt unumgänglich machte.
Die Kindheit der Geschwister wird als unbeschwert und sehr glücklich beschrieben. Inge Scholl weiß zu berichten: „Das beschauliche Städtchen im Kochertal, in dem wir unsere Kindertage verbrachten, schien von der großen Welt verlassen. Die einzige Verbindung war eine gelbe Postkutsche, die die Bewohner in langer, rumpelnder Fahrt zur Bahnstation brachte […]. Uns erschien die Welt dieses Städtchens nicht klein, sondern weit und groß und herrlich. Wir hatten auch bald begriffen, daß sie am Horizont, wo die Sonne auf- und unterging, noch lange nicht zu Ende war.“[11] Ähnlich äußerte sich auch H. Steffahn: „Das Kocherstädtchen wurde die erste richtige Heimat der Scholl-Kinder; hier gingen sie eins nach dem anderen in die Schule, streiften durch die Weinberge und Mischwälder.“[12]
Die Mutter war, wie Ricarda Huch es formuliert, „heiter, voll unerschöpflicher Liebe, sie verbreitete Wärme und Wohlsein, der Vater war ernst und zurückhaltend. Gab die Mutter das Gefühl der Geborgenheit, so war der Vater Stütze und Gerüst“.[13]
Die Scholl-Kinder genossen eine offene und liberale Erziehung in einem naturverbundenen Umfeld. Der religiöse Einfluß ging hauptsächlich von der Mutter aus. Der Vater gehörte -so jedenfalls R. Huch- zu „den Protestanten, für die das Religiöse im Sittlichen aufgegangen ist und die die aus dem Christentum erwachsene, im Abendland gültige Sittlichkeit aus der Philosophie oder unmittelbar aus der Vernunft ableiten“.[14] Er wirkte durch seine Einstellung der Religion jedoch nicht entgegen; die Kinder durften sich vielmehr in allen Bereichen geistig und körperlich frei entfalten.[15]
Dieser Umstand führte 1933, als Folge der Tatsache, daß zuerst Hans Scholl und später auch seine Geschwister in die Hitlerjugend eintraten, zu massiven Konflikten innerhalb der Familie.[16] Der liberale, kosmopolitisch eingestellte und durch seine Arbeit im Treuhandbüro mit den Problemen der Weltwirtschaftskrise vertraute Robert Scholl erkannte offenkundig, weshalb so viele in ihrer Not auf den Führer der NSDAP hofften, der das wirtschaftliche Massenelend zu überwinden versprach. Er selbst sah in Hitler jedoch nicht die Rettung, sondern lehnte das NS-Regime in entschiedenster Weise ab.[17] Robert Scholl war „unwillig“[18], und -wie Inge Scholl berichtet- entsetzt über die Begeisterung, die die neue Regierung in seinen Kindern zu erzeugen vermochte, bezeichnete er die nationalsozialistische Machthabung von Anfang an als „Wölfe und Bärentreiber“, die das „deutsche Volk“ schrecklich „mißbrauchen“[19]. Trotz aller Warnungen verfielen die Geschwister Scholl zunächst „den irrationalen Lockungen“[20] der NSDAP. Sowohl jugendliche Naivität als auch politische Unerfahrenheit verhinderten, daß sie, wie viele andere auch, die hohlen Versprechungen und die propagandistischen Tricks der Nationalsozialisten zu Beginn der Machtergreifung durchschauten. Des weiteren unterschied sich die Hitlerjugend, die sich 1933 noch im Aufbau befand, beträchtlich von ihren späteren Erscheinungsformen. Charakterisierend waren hauptsächlich Elemente, die Jugendbewegungen auszeichneten, wie das Fahrten- und Lagerleben, und so natürlich eine große Masse von Jugendlichen ansprach und in ihrer Freizeit magnetisch anzog.[21] Selbstverantwortung, Gemeinschaft und Abgrenzung vom Elternhaus waren tragende Gedanken; Fahrt und Lager, Tracht und Brauchtum mit klangvollen Liedern waren -so H. Steffahn- „ihr schmückendes Beiwerk“[22] und boten zahlreiche Anknüpfungspunkte für die heranwachsende Generation auf dem Weg zur Selbständigkeit. Inge Scholl erinnert sich an die Faszination, die sowohl von der damaligen Hitlerjugend als auch vom Führer selbst ausging: „Hitler, so hörten wir überall, Hitler wolle diesem Vaterland zu Größe, Glück und Wohlstand verhelfen; er wolle sorgen, daß jeder Arbeit und Brot habe; nicht ruhen und rasten wolle er, bis jeder einzelne Deutsche ein unabhängiger, freier und glücklicher Mensch in seinem Vaterland sei. Wir fanden das gut, und was immer wir dazu beitragen konnten, wollten wir tun. Aber noch etwas anderes kam dazu, was uns mit geheimnisvoller Macht anzog und mitriß. Es waren die kompakten Kolonnen der Jugend mit ihren wehenden Fahnen, den vorwärtsgerichteten Augen und dem Trommelschlag und Gesang.“[23]
Die Geschwister Scholl beteiligten sich fasziniert an Heimabenden und ausgedehnten Wanderungen, durchdrungen von einem Gefühl engster Zusammengehörigkeit und Verbundenheit. Überzeugt, einer großen Idee zu dienen, waren sie stolz, ein kleiner Teil der großen Organisation zu werden, die scheinbar alle Mitglieder in gleicher Weise umfaßte und würdigte. So weiß Inge Scholl zu berichten: „Wir fühlten uns beteiligt an einem Prozeß, an einer Bewegung, die aus der Masse Volk schuf. Wir wurden ernst genommen, in einer merkwürdigen Weise ernst genommen, und das gab uns einen besonderen Auftrieb“.[24]
Die Begeisterung Hans Scholls als auch die der anderen Scholl-Kinder dauerte an, bis immer deutlicher wurde, daß gerade „die Chance der freien Entfaltung des Individuums“[25], welche sie sich vom nationalsozialistischen Gedankengut versprochen hatten, ausgeschlossen und pure Utopie war. Immer häufiger wurden sie in der Hitlerjugend, Hans Scholl war bereits zum Fähnleinführer aufgestiegen[26] und Sophie gehörte dem Jungvolk an[27], mit widersprüchlichen und unerklärlichen Verhaltensweisen der Nationalsozialisten konfrontiert. Hans, der einen „Liederschatz“[28] gesammelt hatte, wurde beispielsweise verboten, Volkslieder aus anderen Ländern und Völkern anzustimmen, oder weiterhin „undeutsche“ Literatur von seinem Lieblingsdichter Stefan Zweig zu studieren.[29] Nachrichten von Verhaftungen bekannter Lehrer, die ihre Meinung „zu laut“ kundgetan hatten,[30] und Ausschlüsse ausländischer Freunde aus der Hitlerjugend[31] boten ebenfalls Nährböden für die erste aufkeimende Kritik.
Zu dieser Zeit, im September 1935, wurde Hans Scholl, der im Gegensatz zu Sophie schon äußerlich völlig dem nationalsozialistischen Idealtyp entsprach[32], mit der ganz besonderen „Ehre“ ausgezeichnet, die Fahne seines Standortes zum Parteitag nach Nürnberg zu tragen. Trotz aller Bedenken, die ihn und seine Geschwister immer öfter quälend erfüllt hatten, nahm er voller Stolz und Freude den Auftrag an.[33] Entsetzt von der Wirklichkeit des Nationalsozialismus, von der parteigesteuerten, hitlerzentrierten Fremdbestimmung, kehrte er völlig verändert vom „Parteitag der Freiheit“ zurück.[34] Inge Scholl erinnert sich: „Als er zurückkam, trauten wir unseren Augen kaum, in seinem Gesicht lag eine große Enttäuschung“[35].
Die HJ-Zeit Hans Scholls gipfelte in einem Eklat. Er hatte, noch die Funktion des Fähnleinführers bekleidend, mit seinen „Pimpfen“[36] einen eigenen Wimpel mit einem Fabeltier genäht. Anläßlich eines Appells forderte ein höherer Vorgesetzter den Fahnenträger auf, die Fahne abzugeben und durch eine vorgeschriebene zu ersetzen, da dieses „kleine Stück Individualismus“ natürlich gegen die Erziehung der Gleichheit und Einspurigkeit der Nationalsozialisten verstieß. Da der Junge die Herausgabe verweigerte, schlug der Vorgesetzte nach mehreren Aufforderungen einen härteren Ton an und verfiel schließlich in „wüste“ Androhungen und Beschimpfungen.[37] Als er sah, daß die „Fahne ein wenig bebte“[38], trat Hans Scholl „still aus der Reihe“[39] und gab dem Führer eine Ohrfeige. Die Degradierung erfolgte sofort.[40]
Hans Scholl wie auch sein Bruder Werner, fanden Ersatz in der verbotenen Gruppe der Bündischen Jugend, gegründet am 1. November 1929 und daher kurz „d.j. 1.11.“ genannt, und führten dort, unter dem Deckmantel des Jungvolkes, ein individuelles Eigenleben.[41]
Sophie Scholl, ebenfalls seit 1934 Mitglied der HJ, verweilte, zuletzt als Gruppenleiterin im Bund Deutscher Mädel, während ihrer Schulzeit sporadisch im Jungvolk, bis sie auf ähnliche Weise wie ihr Bruder Hans des Amtes enthoben wurde.[42]
Die Jungen der Scholl-Familie studierten bei ihren bündischen Zusammenkünften verbotene Literatur, diskutierten über verehrte Dichter und Künstler, pflegten auf ihren ausgedehnten Wanderungen und Fahrten multikulturelles Liedgut und eine eigene, bestimmte Sprechweise wie auch unauffällige Kleidung waren ihnen zu eigen.[43] Hans Scholl beschäftigte sich fortan immer häufiger und faszinierter mit geistreicher Literatur. Verliebt in Rilke, Hölderlin und George, lernte er auch die deutschen Klassiker kennen und erschloß die Welt der antiken Philosophie und der frühen christlichen Denker.[44]
Diese Zeit wurde für Hans, Werner und Inge Scholl durch eine mehrwöchige Haft wegen „bündischer Umtriebe“ beendet.[45] Die Geschwister Werner, Inge und Sophie wurden im November 1937 bei einer „Nacht- und Nebelaktion“ von der Gestapo abgeholt. Sophie durfte noch am gleichen Abend nach Hause zurückkehren, Werner und Inge hingegen wurden einige Wochen inhaftiert.
Zu dieser Zeit war Hans Scholl bereits Soldat der Kavallerie in Cannstadt. Er hatte sich dort, nach bestandenem Abitur und abgeleistetem Arbeitsdienst, freiwillig gemeldet.[46] Er wurde demnach nicht wie ein „normaler“ Zivilist in Haft genommen, sondern tauschte seine Revierstube erst im Dezember gegen die Gefängniszelle. Seinem militärischen Vorgesetzen, einem Rittmeister, war es zu verdanken, daß sich seine Haft nur auf fünf Wochen reduzierte.[47]
Während jenes Gefängnisaufenthaltes reifte in Hans die Entscheidung heran, das Studium der Medizin aufzunehmen. Tiefe Einblicke in das menschliche Elend, welche das Gefängnis ihm eröffnete, ließen den Wunsch immer größer werden, dem mörderischen Naziregime entgegenzutreten und -zuwirken. Er wollte dies zu jener Zeit durch das Ergreifen eines Berufes verwirklichen, welcher durch sein „Pflegen und Heilen“[48] „im Gegensatz zum Kriegshandwerk stand“[49].
Im April 1939 begann Hans Scholl mit dem Medizinstudium in München, blieb allerdings weiterhin dem Militär unterstellt. Nach Kriegsausbruch wurde er zunächst für das Studium zurückgestellt, im April 1940 jedoch schließlich als Sanitäter zu einer Studentenkompanie nach Frankreich abkommandiert.[50] Dort suchte und fand Hans den Kontakt zur französischen Bevölkerung,[51] übte sich in der französischen Sprache und wurde vor allem durch das Verhalten des deutschen Heeres in seiner oppositionellen Haltung bestärkt.
Als Hans Scholl im Herbst 1940 nach München zurückkehrte, war er -so Petry- „dem Stadium unbewußter Abwehr gegen die Zumutung eines dem Individualismus feindlichen Systems längst entwachsen“[52]. Am 21. Dezember 1941 notierte er in seinem Tagebuch: „Wie sehr verlangt diese Zeit nach Entscheidungen innerer Art, und wieviel besser wäre es, von Zeit zu Zeit sich gegenüberzustehen und dem Fragenden Antwort zu sein, als in falscher Humanität nur die Einsamkeit und nur sich selbst zu sehen.“[53] Inge Scholl erklärt: „Hans wußte gut, daß er nur einer von Millionen in Deutschland war, die ähnlich wie er empfanden, doch ganz Deutschland schien von geheimen Ohren belauscht“[54], so daß niemand wagte ein freies Wort zu äußern.
Ein offenes Ohr fanden Hans und seine Geschwister immer wieder im Elternhaus. Die Familie wurde im Laufe der Zeit „zu einer kleinen festen Insel in dem unverständlichen und immer fremder werdenden Getriebe“[55].
Während Hans sich ab 1940 wieder dem Studium der Medizin widmete, absolvierte Sophie in Ulm ihr Abitur und trat anschließend in das Fröbelseminar für Kindergärtnerinnen ein in der Hoffnung, so dem Arbeitsdienst entgehen zu können. Dies erwies sich jedoch gleich in zweifacher Weise als Irrtum: Nach dem bestandenen Kindergärtnerinnenexamen mußte sie zunächst im Frühjahr 1941 ein halbes Jahr Reichsarbeitsdienst in Krauchenwies bei Sigmaringen ableisten, anschließend ein halbes Jahr Kriegshilfsdienst als Hortnerin in Blumenberg absolvieren, als Voraussetzung für ein späteres Studium.[56] Inge Scholl weiß zu berichten, daß Sophie die Arbeit nicht gefürchtet hatte, „aber das andere, den Zwang, den Massenbetrieb im Lager, die Schablone“[57], waren ihr zutiefst zuwider. Ebenso zwang sie ihre Überzeugung in eine tiefe Abwehrhaltung, und sie sah es als „unverzeihliche Charakterlosigkeit“ an, auch nur eine Hand für diesen Staat, „dessen Fundamente doch nur Lüge, Haß und Unfreiheit waren“, zu rühren.[58] Besonders kennzeichnend für Sophie Scholl war ihr bereits sehr früh entwickeltes und gereiftes Interesse an Politik. Aus ihren Briefen geht deutlich hervor, daß sie sich schon vor Beginn des Studiums politisch orientierte und vor den politischen Aktivitäten des Dritten Reiches nicht die Augen verschloß.[59] So wird beispielsweise in einem Brief vom April 1940 deutlich ihre Haltung erkennbar: „… Ich mag gar nicht daran denken, aber es gibt bald nichts anderes mehr als Politik, und solange sie so verworren und böse ist, ist es feige, sich von ihr abzuwenden. Ich glaube, ich wäre sehr viel froher, wenn ich nicht immer unter dem Druck stünde, ich könnte mit viel besserem Gewissen anderem nachgehen. So aber kommt alles andere erst in zweiter Linie.“[60] So erwies sie sich in ihrem politischen Denken auch als außerordentlich konsequent. Denn obwohl ihr Freund Fritz Hartnagel sich auf deutscher Seite an der Front befand, hoffte Sophie bereits 1939 auf einen französischen Sieg, weil Deutschland ihrer Meinung nach nur auf diese Weise bezwungen und damit dem Greuel ein Ende bereitet werden konnte.[61] Sie stellte sich den Problemen, den Grausamkeiten und Perversitäten der NS-Diktatur in eindeutiger Position und wollte sich nicht durch Zerstreuungen der Wirklichkeit entziehen. Während des Arbeitsdienstes suchte ihr Geist zwar „besonders bei den Gedanken des Augustinus“[62] halt, doch in einem Brief vom Januar 1940 schilderte sie selbst, daß sie davon abgekommen sei viel zu lesen, da dies oft, ähnlich wie Wein die Wirklichkeit verzerre und später alles genau wie vorher und selten besser sei.[63]
Im Mai 1942 konnte sich Sophie, nach einem Jahr voller Einbußen, Enttäuschungen und Konflikten, endlich an der Universität in München in den Fächern Philosophie und Biologie einschreiben, bereits sehnsüchtig erwartet von ihrem Bruder Hans.[64]
Resümierend ist festzuhalten: Hans und Sophie Scholl hatten während der NS-Diktatur den Nationalsozialisten zunächst Vertrauen und deren Versprechungen Glauben geschenkt. Sie schlüpften dann jedoch in eine, durch immer größer werdende Differenzen, unerklärliche und nicht tolerierbare Ereignisse aufkeimende, unbewußte Abwehrhaltung, die sich schließlich zu einer bewußten oppositionellen Reaktion entwickelte. Hierbei wurden sie durch den Vater Robert Scholl, der sich bereits seit Beginn der Gewaltherrschaft als Regime- Gegner ausgezeichnet hatte, gestützt und gestärkt.
II. Alexander Schmorell
Alexander Schmorell, am 16. September 1917 in Orenburg am südlichen Ural geboren, war Sohn einer Russin und eines deutschen Arztes ostpreussischer Herkunft.[65] Bereits ein Jahr nach seiner Geburt verlor Alexander Schmorell seine Mutter, die in Rußland das Opfer einer Typhusepidemie wurde.[66] Dr. Schmorell siedelte 1921, nach dem Verlust seiner Frau, gemeinsam mit seinem Sohn Alexander und der russischen Kinderfrau mit einem Sanitätszug für deutsche Rückwanderer in sein Heimatland, und ließ sich in seiner Studienstadt München als praktizierender Arzt nieder.[67] Im Jahre 1926 ging er ein zweites Mal die Ehe ein mit einer deutschen Frau, mit der er zwei Kinder hatte. Das Familienleben im Hause Schmorell wurde als sehr innig beschrieben, und auch Alexanders Gefühle zu den beiden Stiefgeschwistern -so Ricarda Huch- waren von „sehr herzlicher Natur“[68]. Dennoch hatte die neue Gemahlin den Platz der Mutter in Alexanders Leben nie ganz einnehmen können.[69] Den eigentlichen Mutterersatz fand Alexander Schmorell in der gutherzigen „Nanja“, der russischen Kinderfrau. Für sie war „Schurik“, wie er in der Familie liebevoll russisch genannt wurde, der Bezug zur geliebten Heimat; sie lehrte ihn perfekt Russisch, erzählte ihm von der verstorbenen Mutter und beeinflußte ihn im russisch-orthodoxen Glauben, in welchem er in Gedenken an die russische Heimat und die Mutter erzogen wurde.[70] Alexander konnte sich jedoch weder an seine Heimat noch an seine Mutter erinnern, „um so mehr beschäftigte sich seine Phantasie mit beiden“[71], und sie wurden in seinem Geiste mit „hohen Vorzügen“[72] versehen. Angelika Probst, die Schwester Christoph Probsts, ebenso wie ihr Bruder bereits seit frühester Jugend mit Alexander Schmorell vertraut und eng befreundet, weiß zu berichten: „Alexander wurde bis zur Schwermut von einer beständigen Sehnsucht nach Rußland verzehrt, seinem Heimatland, das wiederzusehen er sich täglich erträumte, und nach seiner jungen lieblichen Mutter, die er niemals gesehen hatte…“.[73]
Jedoch wäre es falsch, Alexander nun als einen schwermütigen, einsamen Menschen zu charakterisieren; treffender wird vielmehr sein umherschweifender, suchender Charakter durch den Begriff „Vagabundennatur“[74] beschrieben. Er liebte ziellose Wanderungen, suchte Bekanntschaften mit Landstreichern, Artisten und Zigeunern und ließ sich vom Zufall hierhin und dorthin treiben und genoß die Freiheit in vollen Zügen, denn jegliche Konventionen wie auch jeder Zwang waren ihm verhaßt.[75]
Nicht nur seine russischen Gemütsbande, sondern auch dieser stark ausgeprägte Wunsch nach Freiheit erzeugten in Alexander von Anfang an große Abscheu gegen den Nationalsozialismus mit seinem „nationalistischen Wahn und militanten Rassismus“[76]. Nachdem er ebenso wie Hans Scholl am Leben der Bündischen Jugend teilgenommen hatte, verließ er die deutschnationale Scharnhorstjugend sofort, als diese 1933 in die Hitlerjugend zwangsintegriert wurde, entsetzt von dem dort herrschenden Zwang und Drill.[77] Alexander Schmorell war zu keiner Zeit, wie zunächst die Geschwister Scholl, dem menschenverachtenden nationalsozialistischen Staat verfallen, vielmehr hatte ihn sein nach Unabhängigkeit und Freiheit strebender Charakter, der Deutschland nie als seine eigentliche Heimat empfand, vor den Versprechungen und Lockungen der Nationalsozialisten bewahrt. Seine Erfahrungen mit dem NS-Regime mündeten zunächst jedoch nicht in einem aktiven Widerstand. Vielmehr suchte er immer öfter, wie später auch Sophie und Hans Scholl, Halt und Zuflucht in geistreicher Lektüre, die er allein oder auch gemeinsam mit den Freunden Christoph und Angelika Probst studierte, in der Musik -Alexander war musikalisch sehr begabt und spielte ohne große Übung ausgezeichnet Klavier-, oder er nutze seine Liebe zur Bildhauerei als Rückzugsraum vor einem immer bedrückender werdenden Alltag.[78] Seine Begabungen beschränkten sich jedoch nicht nur auf den künstlerischen, musischen Bereich, sondern erstreckten sich auch auf sportliche Aktivitäten, wie Reiten, Fechten und Schwimmen.[79] Die Tatsache, daß Alexander ein ausgezeichneter und begabter Reiter war, veranlaßte ihn dazu, den verhaßten Militärdienst, den er nach dem bestandenen Abitur 1936 gleich ableisten wollte, bei der reitenden Artillerie zu verbringen, doch mußte er -wie Sophie Scholl- zunächst zum Arbeitsdienst.
Im November 1937 wurde er zur Wehrmacht einberufen und mit seiner Kavallerie-Einheit 1938 in Österreich und später bei der Besetzung der Tschechoslowakei eingesetzt.[80] Der militärische Drill, die Unterdrückung jeglicher individueller Neigungen sowie der Verlust der eigenen Freiheit und Unabhängigkeit während der Militärzeit bereiteten Alexander nicht nur große psychische, sondern auch physische Probleme. Angelika Probst weiß sich zu erinnern: „Am Anfang seiner Soldaten- und Kasernenzeit machte er eine geistig-seelische Krise durch, die fast zu einem schweren körperlichen Zusammenbruch geführt hätte.“[81] Nachdem er den vorgeschriebenen Eid auf Hitler leisten sollte, bat Alexander -vergeblich- um Entlassung aus der Wehrmacht.[82] Während dieser Phase wurden Alexander Schmorell die Mißstände und Diskrepanzen des NS-Regimes immer bewußter und er geriet häufiger, beispielsweise durch das Tragen von Zivilkleidung, in schwierige Situationen, welche nur durch die militärischen Beziehungen des Vaters entschärft werden konnten.[83]
1939 begann Alexander in Hamburg -mehr aus Pflicht statt aus Neigung- sein Medizinstudium, wohingegen seine eigentlichen Vorlieben und Interessen ganz der Bildhauerei gehörten. Im Frühjahr 1940 war er ebenso wie Hans Scholl gezwungen, als Sanitätsunteroffizier den Frankreichfeldzug mitzumachen, und kehrte im Herbst an die Universität zurück, wobei er nach München wechselte und dort der 2. Studentenkompanie angehörte.[84]
Abschließend ist festzuhalten: Alexander Schmorell hatte frühzeitig ein widerständiges Bewußtsein entwickelt, welches aber zunächst noch nicht in gezielten Taten seinen Ausdruck fand. Es schlummerte vielmehr unter dem Deckmantel der Musik, der Literatur und des Sportes, auf das nötige Ventil wartend, um die aktiven Potentiale zu entfachen. Alexander zeichnete sich, im Gegensatz zu den Geschwistern Scholl, schon seit der nationalsozialistischen Machtergreifung als geistiger Regime-Gegner aus, teils bedingt durch seine russische Herkunft und Erziehung, teils auch zurückzuführen auf seine nach Freiheit strebende Natur, welcher jede Art von Unterwerfung, Einengung der Persönlichkeit und Vereinheitlichung der Individuen verhaßt war. Er hatte von Anfang an den Lockungen und falschen Versprechungen der Nationalsozialisten widerstanden, stetig versucht ihnen zu entfliehen, beispielsweise durch den sofortigen Austritt aus der Scharnhorstjugend, nachdem diese der HJ untergeordnet worden war, und sie nur unter Qualen mit Hilfe seiner Kunst überlebt.
III. Christoph Probst
Christoph Probst, der Sohn eines Privatgelehrten, wurde am 6. November 1919 in Murnau/Staffelsee geboren.[85] Er verlebte seine Kindheit und Jugend gemeinsam mit seiner älteren Schwester Angelika in zwei verschiedenen Elternhäusern, da sich die Eltern kurz nach Christophs Geburt scheiden ließen und beide erneut heirateten. Durch diese familiären Umstände bedingt, entwickelte sich seit frühester Kindheit zwischen Angelika und „Christel“, so wurde er von Familienmitgliedern und Freunden genannt, eine Beziehung, die sich durch besondere Innigkeit und Intensität auszeichnete.[86]
Der Vater Hermann Probst, der aus einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie stammte, bekleidete beruflich kein festes Amt, sondern ging statt dessen seinen Hauptneigungen, namentlich der modernen Malerei und der vergleichenden Religionsgeschichte, nach.[87] Sein Forscher- und Entdeckerdrang prägten Christoph und entfachten in ihm besondere Neigungen naturwissenschaftlicher Art, die sich während der Schulzeit intensivierten. Jene verbrachten die Geschwister Probst zum größten Teil außerhalb der Elternhäuser. In der Unterstufe des Gymnasiums kamen sie ins Internat. Christoph besuchte zunächst das Internat in Marquartstein, wechselte dann nach Nürnberg und ging anschließend in München aufs Gymnasium.[88] Hier lernte er 1935 Alexander Schmorell kennen, mit dem ihn seit diesem Zeitpunkt eine tiefe Freundschaft verband. Im Landerziehungsheim Schondorf am Ammersee machte Christoph 1937 -siebzehnjährig- das Abitur.[89]
Die Erziehung zum selbstverantwortlichen und humanitär gebildeten Menschen, welche von den Internaten und Landerziehungsheimen als Erziehungsziele definiert und erstrebt wurden,[90] trug dazu bei, Christoph gegen den Nationalsozialismus zu immunisieren. Hinzu kam der familiäre Umstand, daß der Vater sich in zweiter Ehe mit einer Jüdin vermählte.[91] Die heranwachsenden Geschwister erfuhren so die NS-Diktatur bereits von Beginn der Machtergreifung an als „konkrete Bedrohung“, während sie die Geschwister Scholl -so H. Steffahn- „noch werbend umschmeichelte“[92].
Christoph durchlief nach dem Abitur, wie Alexander Schmorell, zunächst den verhaßten Arbeitsdienst, dann den Militärdienst bei der Luftwaffe.[93] Mit der „individualistischen Prägung des Internats versehen“[94], verabscheute Christoph den dort herrschenden Zwang und Drill zutiefst, ihm fiel es im Gegensatz zu Schmorell jedoch leichter, die dort herrschende Unfreiheit zu ertragen. Angelika Probst schreibt dazu: „Ich glaube, er (Alexander Schmorell) war manchmal noch verzweifelter als Christel -obgleich dieser tiefer und andauernder litt- denn er hatte es viel schwerer als mein Bruder, aus dem Reich des Geistigen Kraft zu schöpfen.“[95] Diese Welt des Geistes erschloß sich Christoph verstärkt seit der Schondorfer Zeit, auch bedingt durch den Selbstmord seines geliebten Vaters im Jahre 1936[96] ; er beschäftigte sich fortan intensiver mit Literatur, Kunst, Religion und Philosophie. Der Vater -so H. Steffahn- „in so vielen Religionen zu Hause, hatte sich für keine entscheiden können“[97], der Sohn hingegen gewann aus ihnen allen die „Summe des Ethischen“[98]. Christoph beurteilte -so jedenfalls R. Huch- „die Ereignisse des öffentlichen Lebens nach einem religiösen Maßstabe…, d.h. er urteilte in sehr viel höherem Maße als sein Freund Schmorell entsprechend moralischen Normen, die er verinnerlicht hatte“[99]. Seine Lehrer charakterisierten ihn schon während der Zeit des Abiturs als „ungewöhnlich reifen, geistig lebendigen und kritisch urteilenden Schüler“[100].
Im Anschluß an den Wehrdienst, 1939, studierte Christoph in München, Straßburg und Innsbruck Medizin. Ein Studium, welches er -nicht wie Alexander Schmorell mehr durch familiäre Zwänge motiviert- aufgrund eigener Interessen und Neigungen wählte. Dementsprechend betrieb er seine Studien wesentlich ernster und verantwortungsbewußter als der Freund. Während seiner Famulatur lernte Christoph Herta Dohrn kennen, die Tochter des Privatgelehrten Harald Dohrn, der sich als Regime-Gegner auszeichnete und 1945 von den Nationalsozialisten ermordet wurde. Er heiratete Herta Dohrn noch während der Studienzeit und bereits im Alter von 22 Jahren war er Vater zweier Söhne.[101] Eine Tatsache, die sicherlich auf die gespaltene Häuslichkeit seiner eigenen Kindheit und Jugend zurückzuführen war.
Resümee: Christoph Probst war sowohl durch die humanitäre Erziehung der Internate als auch durch den familiären Umstand, daß sein Vater in zweiter Ehe eine Jüdin geheiratet hatte, von Anfang an gegen den Nationalsozialismus gefeit und empfand das nationalsozialistische Regime bereits seit der Machtergreifung 1933 als konkrete Bedrohung. Er suchte in der Welt des Geistes, der Literatur, Kunst und Musik Zuflucht, bemüht, dem nationalsozialistischen Alltag zu entfliehen und die Qualen zu überstehen.
IV. Willi Graf
Willi Graf wurde am 2. Januar 1918 in Kuchenheim im Rheinland geboren. Dort verbrachte er gemeinsam mit seinen beiden Schwestern die ersten vier Jahre seiner Kindheit, in der Obhut eines von katholischen Traditionen geprägten Elternhauses.[102] Berufliche Veränderungen des Vaters -er verwaltete in Kuchenheim eine Molkerei- erforderten 1922 den Umzug der Familie Graf nach Saarbrücken. Dort wurde der Vater Geschäftsführer einer Weingroßhandel AG.[103] In einem Lebenslauf, den Willi Graf auf Verlangen der Gestapo im Gefängnis schrieb, erinnert er sich an seine Jugend: „Von Sorge und Not um das körperliche Wohl bekam ich nichts zu spüren, denn unsere Familie lebte in einigermaßen guten, wenn auch sparsamen Verhältnissen. Die Erziehung war ganz vom Geiste des religiösen Lebens und der Achtung gegenüber den Eltern und Vorgesetzten getragen … Früh wurde ich mit den Gebräuchen und dem Leben der Kirche vertraut gemacht, und die Jahreszeiten waren erfüllt von dem Geist religiöser Vorstellungen.“[104] So war es nicht weiter verwunderlich, daß Willi schon sehr früh Zugang zu katholischen Jugendverbänden fand. Bereits als Elfjähriger -er besuchte seit einigen Monaten das humanistische Gymnasium- trat Willi Graf dem katholischen Schülerbund „Neudeutschland“ bei, in dem die Tradition der Wandervogel-Bewegung weiterlebte.[105] Er sah so die Möglichkeit, sein Interesse für religiöse und literarische Fragen im Kreise gleichgesinnter Kameraden zu vertiefen. Willi Graf berichtete: „Es bildete sich aus kindlichen Vorstellungen der häuslichen Erziehung und des ersten Religionsunterrichts die große Welt des Glaubens, in deren Lehren ich mich sicher und geborgen fühlte.“[106]
Die entscheidenden theologischen als auch literarischen Impulse erhielt Willi Graf im Kreis des „Grauen Ordens“, einer Jugendbewegung, welcher er sich 1934 anschloß. Hier trafen sich Jugendliche, Studenten und Arbeiter -vorwiegend der katholischen Konfession zugehörig- zu gemeinsamen Lesungen und Gesprächen; Liederabende wurden veranstaltet und gemeinsame Fahrten organisiert. Damit verband sich für Willi Graf alles -so seine Schwester Anneliese Knoop-Graf-, wonach er sich sehnte: Gemeinsame Unternehmungen und Gespräche mit den Freunden, Streifzüge durch die Natur, neue Erlebnisse und Abenteuer.[107] Die Mitglieder des Grauen Ordens waren bestrebt, eine eigene Lebensform zu finden, die sich eindeutig von allen „gutbürgerlichen“ und konventionellen Normen der Gesellschaft distanzieren sollte. Sie bemühten sich um einen neuen Zugang zur Kunst, um ein neues Literaturverständnis und strebten eine Reformation der katholischen Kirche an. Ein abgehobener, elitärer Stil war ihnen zu eigen, der in der betont jugendbewegten Kleidung, Sprache und Schreibweise seinen Ausdruck fand. In ihren Absichten standen sie der „Liturgischen Bewegung“ nahe, eine von jungen Leuten um den Theologen Romano Guardini getragene Strömung, die -so jedenfalls M. Schneider und W. Süß- „viele Reformen des II. Vatikanischen Konzils vorwegnahm“[108] und besonders das „Gemeinschaftserlebnis im Gottesdienst“[109] hervorhob. Ihr Ziel war eine „Kirche in der Welt“[110], die offen und aufgeschlossen für die Probleme der Gesellschaft, Literatur und Kunst sein sollte.
Gegen die Einflüsse der Nationalsozialisten war Willi Graf -als Mitglied des Grauen Ordens von humanen und christlichen Grundsätzen und dem Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit geprägt- von Anfang an immunisiert. Die Erkenntnis, „daß Christsein und Menschsein eine Einheit bilden“[111], erforderte den „politisch denkenden und handelnden Christen“[112], welcher sich klar von den menschenunwürdigen Taten der Nationalsozialisten distanzierte und sie zutiefst verabscheute. Willi Graf tat dies, indem er sich konsequent dem Regime verweigerte. Beispielsweise trat er nie der Hitlerjugend bei und die Freunde, die ihr angehörten, strich er einfach aus seinem Adreßbuch mit dem Vermerk: „ Ist in der HJ“. [113]
1938 ereilte Willi Graf ein ähnliches Schicksal wie Hans Scholl. Er wurde wegen seiner Teilnahme an illegalen Fahrten und den bündischen Zusammenkünften gemeinsam mit 17 anderen Mitgliedern des Grauen Ordens für drei Wochen inhaftiert. Das Verfahren vor dem Sondergericht Mannheim wegen „bündischer Umtriebe“ wurde dann jedoch -wie zuvor bei Hans Scholl- aufgrund der Amnestie nach dem Anschluß Österreichs eingestellt.[114]
Zu diesem Zeitpunkt war Willi Graf bereits Medizinstudent in Bonn. Nachdem er zuvor das Abitur erfolgreich absolviert hatte, konnte er bereits im Wintersemester 1937 mit seinem Studium beginnen, welches er nicht wie Alexander Schmorell aus familiären Gründen, oder wie Hans Scholl und Christoph Probst aus Neigung gewählt hatte, sondern -so H. Steffahn- aus „Zweckerwägungen“[115]. Seine Schwester Anneliese Knoop-Graf weiß bezüglich seiner Motivation zu berichten: „… er entschloß sich dazu, weil in diesem Fach die politische Einengung durch die Parteiorgane vergleichsweise gering war.“[116] Seine eigentlichen Neigungen galten vielmehr den Geisteswissenschaften, der Philosophie, der Literatur, der Geschichte und vor allem der Theologie.
Willi Graf konnte sein Studium ohne Unterbrechungen seitens des NS-Regimes bis zum Physikum durchführen, 1940 wurde er jedoch zur Wehrmacht einberufen und mußte mehr als zwei Jahre als Sanitäter der Truppe dienen. In Jugoslawien, Polen und Rußland erfuhr er die Not der Zivilbevölkerung, erlebte die Greueltaten der Nationalsozialisten und hörte von den Mordaktionen an Juden. In einem Brief formulierte er seine grausamen Erfahrungen: „Der Krieg, gerade hier im Osten, führt mich an Dinge, die so schrecklich sind, daß ich sie nie für möglich gehalten hätte. Alles ist mir fremd. Und all das muß man allein verarbeiten, denn kaum jemand ist in meiner Nähe, mit dem man darüber reden könnte“[117]. Die Verbindung zu seinen Feunden war für Willi -so A. Knoop-Graf- von „lebenswichtiger Bedeutung“[118]. Mit ihnen konnte er über die unmenschlichen Taten der Nationalsozialisten diskutieren, wurde in seiner Abwehrhaltung bestärkt und empfing in der Gemeinschaft immer wieder neue Impulse, die ihm Mut und Zuversicht gaben. Das Elternhaus hatte -im Gegensatz zur Familie Scholl- die Haltung Willi Grafs nur in geringem Maße beeinflußt, weiß seine Schwester A. Knoop-Graf zu berichten; auch wenn dort das Fundament gelegt wurde, die wichtigeren Anstöße kamen aus dem kulturellen Milieu seiner Freunde.[119]
Im Frühjahr 1942 konnte er schließlich, nach zwei Jahren großer Qual und Einsamkeit, sein Studium als Mitglied der zweiten Studentenkompanie in München wieder aufnehmen. Verändert von den Kriegserlebnissen, suchte er verstärkt nach Antworten, die sich jedoch, wie er selbst schreibt, „nicht einfach geben lassen“[120], sondern eine Antwort vielmehr die Art sei, „wie man nun weiterzuleben versucht“[121].
Fazit: Willi Graf hatte, ebenso wie die späteren Freunde Alexander Schmorell und Christoph Probst, von Anfang an den nationalsozialistischen Lockungen und Versprechungen widerstanden. Er war zu keiner Zeit der Hitlerjugend oder anderen nationalsozialistischen Organisationen beigetreten, sondern hatte sich vielmehr eigene Alternativen gesucht und bewußt dem Nationalsozialismus widersagt. Seine Motivation war -im Gegensatz zu Schmorell und Probst- hauptsächlich auf seinen christlichen Glauben zurückzuführen. Bereits durch die katholisch geprägte Erziehung im Elternhaus wurde Willi Graf gegen den Nationalsozialismus immunisiert; die eigentlichen und wichtigsten Anstöße erhielt er jedoch im Kreise seiner Freunde in den katholischen Jugendverbänden. Die Erkenntnis, daß Christentum und Nationalsozialismus zwei wesensfremde, sich gegenseitig ausschließende Dinge waren, erforderte von dem jungen Christen Willi Graf eine eindeutige Haltung, welche sich klar von dem menschenunwürdigen Regime der Nationalsozialisten distanzierte und abgrenzte.
V. Zusammenfassung
Die Basis für die späteren Widerstandshandlungen der Weißen Rose wurde bereits während der Kindheit und Jugend der Mitglieder aufgrund individueller Erfahrungen und Erlebnisse geschaffen.
Während Hans und Sophie Scholl langsam -zunächst schenkten sie, von jugendlichem Patriotismus erfüllt, den Nationalsozialisten Glauben- ihre Abwehrhaltung aufbauten, empfand Christoph Probst bereits seit der Machtübernahme 1933, besonders durch die Vermählung seines Vaters mit einer Jüdin, aber auch durch die humanistische Erziehung der Internate, die nationalsozialistische Herrschaft als direkte Bedrohung. Auch Alexander Schmorell hatte seit Beginn der Diktatur -bedingt sowohl durch seine russische Herkunft, als auch durch seinen stark ausgeprägten Freiheitsdrang- eine konkrete Abwehrposition inne. Willi Graf hatte ebenfalls -immunisiert durch seinen christlichen Glauben- von Anfang an dem Nationalsozialismus bewußt widersagt.
Die Abwehr und die Abscheu gegen die menschenunwürdigen Taten der Nationalsozialisten hatte jedoch keineswegs direkt in den Widerstand geführt. Sophie und Hans Scholl, Alexander Schmorell, Willi Graf und auch Christoph Probst versuchten zunächst -jeder auf seine eigene Art- den Alltag zu überstehen, indem sie sich Nischen schufen, in welchen sie überleben konnten. Während Willi Graf besonderen Halt in katholischen Jugendverbänden fand, schöpfte Christoph Probst hauptsächlich aus der Welt des Geistes, der Literatur, Philosophie und Kunst seine Kraft. Auch Alexander Schmorell und Hans Scholl suchten in geistreicher Lektüre Zuflucht. Alexander Schmorell nutzte jedoch vor allem seine Liebe zur Bildhauerei als Rückzugsraum und widmete sich seinen künstlerischen und musischen Begabungen. Zuspruch und Unterstützung fanden sie auch in den christlich-bürgerlichen Elternhäusern, welche frei waren von nationalsozialistischem Gedankengut. Besonders Hans und Sophie Scholl fanden Kraft und Mut in der Familie und wurden vom Vater Robert Scholl, der von Anfang an den Nationalsozialismus zutiefst ablehnte, unterstützt und gestärkt.
C. Vorgeschichte und Entstehung der „Weissen Rose“
Als Hans Scholl und Alexander Schmorell 1940 nach der Teilnahme am Frankreichfeldzug ihr Medizinstudium in München wieder aufnehmen konnten, und auch Christoph Probst dort bereits seit 1939 seinem Wunschstudium nachging, sollte es doch eigentlich keiner größeren Anstrengungen mehr bedürfen, Kontakte zu Kommilitonen gleicher antinationalsozialistsicher Gesinnung zu knüpfen und gemeinsamen Interessen zu frönen.
Ein fataler Irrtum, wie der nationalsozialistische Alltag an den deutschen Universitäten zeigte. Viele Studenten standen zu jener Zeit den Nationalsozialisten zustimmend, ein weiterer Teil gleichgültig gegenüber. Die meisten Hochschullehrer registrierten zwar die Politisierung des Hochschulalltages mit Skepsis, befürworteten aber viele Zielsetzungen des nationalsozialistischen Gedankengutes. Wenige wagten öffentliche Kritik zu äußern und formulierten ihre abweichenden Ansichten nur in vorsichtigen Andeutungen im engeren Freundeskreis und in der Familie. Des weiteren wußten die Nationalsozialisten jegliche Form von eigenständigen studentischen Kulturen zu zerschlagen, so daß Äußerungen studentischen Solidaritätsgefühls oder Versuche kollektiven Aufbegehrens bereits im Keim erstickt wurden.[122]
Nun stellt sich natürlich die Frage, wie die Münchener Studenten in diesem geistigen Klima des Dritten Reiches ihre Bekanntschaften schließen konnten, ohne durch die öffentliche Bekundung ihrer Gesinnung Konsequenzen tragen zu müssen. Mit welchen anderen Kommilitonen konnten sie sich befreunden? Welche Professoren und Dozenten konnten geistiges Gut vermitteln, das frei von nationalsozialistischen Einflüssen war? Wann und wie machten die Studenten die Bekanntschaft dieser Mentoren, und welchen Einfluß übten sie auf die Studenten und ihre späteren Aktionen aus? War es in diesem braunen Sumpf des Dritten Reiches überhaupt möglich, verwandte Seelen in der Masse der Mitläufer zu finden geschweige denn zu erkennen?[123]
Diese Problematiken werden nun im folgenden Kapitel näher erörtert. Es gilt nicht nur die ersten Kontakte, die aufkeimenden Freundschaftsbande und die Verbindung zu anderen Kommilitonen aufzuzeigen, sondern auch die geistigen Impulse der Mentoren und Vorbilder näher zu durchleuchten, welche die Mitglieder der Weißen Rose motivierten und in ihren Taten bestärkten.
I. Erste Begegnungen und Kontakte der Münchener Studenten
Hans Scholl und Alexander Schmorell lernten sich 1939 kennen, während sie der gleichen Studentenkompanie angehörten. Es entwickelte sich schnell eine freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden Studenten, welche zu Anfang jedoch rein sachlich auf das gemeinsame Studium fixiert war. Im Wintersemester 1940/41 bereiteten sie sich gemeinsam auf das Physikum vor und Alexander Schmorell lud Hans in sein Elternhaus ein, um dort die Vorbereitungen für die Prüfung zu absolvieren.[124] Ein Arrangement, welches zunächst von Alexanders Vater, Dr. Erich Schmorell, mit Mißtrauen registriert wurde. Er empfing Hans mit großer Zurückhaltung, da zu damaliger Zeit -so R. Hanser- „jeder Fremde zunächst einmal verdächtig“[125] war, bis es ihm gelang, das Gegenteil zu beweisen. Alexander konnte allerdings aufgrund seiner eigenen Einschätzung des Freundes und der Versicherung, daß sie sich nur gemeinsamen Studien der Medizin widmeten, den Vater beruhigen. Erst „nach mehreren Monaten des gegenseitigen Abtastens“[126], nachdem sie bereits beide die Prüfung abgelegt hatten, wurde Hans Scholl wirklich im Kreise der Schmorells als Freund aufgenommen und integriert. Im Frühjahr 1941 lud Alexander Hans zu geheimen Leseabenden ein, welche im Hause Schmorell stattfanden. Hierbei ging es weniger direkt um politische Probleme, als vielmehr um die Schaffung eines Refugiums antinationalsozialitischer Kultur. Ähnlich wie in den Jugendverbänden wurde hauptsächlich verbotene, weltoffene Literatur studiert. Alexander Schmorells Halbbruder und dessen Frau erinnern sich, daß diese gemeinsamen Abende „mit Fragen nach der eigenen Bestimmung, mit einer geistigen Durchdringung und Vertiefung der eigenen Weltanschauung ausgefüllt“[127] waren.
Hier begegnete Hans Scholl zum ersten Mal Christoph Probst, der gemeinsam mit Alexander und einigen anderen Freunden die Lesungen und Diskussionen zur „seelischen Erholung“[128] abhielt. Hans empfand bereits nach kurzer Zeit große Sympathie für den neuen Freund, da zwischen ihm und Christel -so jedenfalls I. Scholl- „eine innere Verwandtschaft bestand“[129]. Sie begeisterten sich beide nicht nur für die gleichen Autoren und Philosophen und frönten schöngeistiger Literatur, sondern waren auch durch die Liebe zur Schöpfung in engster Weise miteinander verbunden. Gemeinsam begaben sie sich auf die Suche nach „dem Einen“[130], so Inge Scholl, welches „hinter all den Dingen, hinter den Menschen und ihrer Geschichte steht“[131]. Ihre besonders innige Freundschaft gründete jedoch nicht nur auf den geistigen, weltanschaulichen Übereinstimmungen, sondern auch auf der gemeinsamen Leidenschaft für das Bergsteigen und Skifahren.[132]
Wiederum durch Alexander Schmorell lernte Hans Scholl während eines Konzertbesuches im Mai 1941 eine weitere Person kennen, welche ihm später in tiefer Freundschaft verbunden war, Traute Lafrenz. Alexander hatte Traute Lafrenz’ Bekanntschaft bereits während seines Studiums in Hamburg gemacht. Sie studierte dort ebenfalls Medizin und gehörte in der Hansestadt einem ähnlichen Lesekreis an wie Scholl, Schmorell und Probst in München. Nachdem sie ihre Studien in München fortsetzte, entwickelte sich zwischen Hans und Traute schnell eine innige Freundschaft. Sie besaß Stil und war -so R. Hanser- „von einer Art kosmopolitischem Flair umgeben“[133]. Ausgelassenheit und Lebhaftigkeit zeichneten ihren Charakter aus und ein ausgesprochen wacher Geist war ihr zu eigen. So war es nicht weiter verwunderlich, daß Hans Scholl von großer Zuneigung erfüllt war. Traute Lafrenz selbst berichtete über die Beziehung zu Hans Scholl: „Gab schon die gleiche politische Einstellung eine gute Basis…, so kamen gleiches literarisches Interesse, Freude an Wanderungen sowie gemeinsame Konzerte bald hinzu und festigten das Band.“[134]
Auffällig ist die Tatsache, daß sowohl Alexander Schmorell als auch Hans Scholl keinen der Freunde und Verbündeten in den Räumen und Hörsälen der Universität gewannen. Die meisten Kontakte schlossen sie entweder im Bachchor, während der Fechtstunden oder in der Studentenkompanie, denn dies waren im Gegensatz zur Universität Orte, an denen -so M. Schneider/W. Süß- „ungefährdete Kommunikation“[135] betrieben werden konnte. Die Mitglieder der Studentenkompanie waren wehrtaugliche Männer, die durch den Studiengang der Medizin ihre einzige Möglichkeit wahrnahmen, Studium und Wehrpflicht miteinander verbinden zu können. Diese Mitgliedschaft bot den Studenten zweifachen Vorteil: Auf der einen Seite konnten sie sich als Angehörige der Wehrmacht den Zugriffen der Partei weitestgehend entziehen, da sich die Macht der Gestapo zwar bis in die Hörsäle erstreckte, die Kasernen jedoch größtenteils außerhalb ihres Einflußbereiches standen. Auf der anderen Seite erlaubten die geringen militärischen Pflichten den Studenten während des Semesters ein fast geregeltes, ziviles Studentenleben zu führen.[136] Demnach war es in diesem „recht lockeren“[137] Umfeld, wie ein Kommilitone die Kompanie charakterisierte, nicht so problematisch ein offenes Wort zu wechseln, welches in den Ohren dieser Studenten besonderes Gehör fand, da sich hier viele unzufriedene junge Menschen sammelten, die -so C. Petry- „durch vaterländische Parolen schwer zu beeindrucken waren“[138].
In Anbetracht dieser Umstände erstaunt es nicht, daß Scholl und Schmorell in der Studentenkompanie ihre ersten Kontakte knüpften, Alexander Schmorell sich dort mit Jürgen Wittenstein anfreundete und sie dort die Bekanntschaft Ottmar Hammersteins und Hubert Furtwänglers machten. Studenten, die später eine mehr oder weniger lose Freundschaft mit Alexander Schmorell und Hans Scholl verband.[139] Ebenso trat Willi Graf in der Münchener Kaserne mit den späteren Freunden und Verbündeten Hans Scholl und Alexander Schmorell zum ersten Mal in Kontakt, als er im Mai 1942 zum Studium nach München abkommandiert wurde.[140]
II. Bildung des Freundeskreises
Im Laufe des Jahres 1942 entstand langsam ein fester Kreis unter den Münchener Studenten.[141] Den Kern der Gruppe bildeten Hans Scholl und Alexander Schmorell, wie auch Sophie Scholl und Willi Graf, die später hinzu kamen. Auch Christoph Probst, der regelmäßig aus Innsbruck nach München anreiste, gehörte -so R. Hanser- „zur Familie“[142] der Verbündeten. Zum engeren Kreis zählten auch Traute Lafrenz und Gisela Schering, Sophie Scholls Freundin aus dem Arbeitsdienst, die in München Kunst studierte und so wie Traute eine enge Beziehung zu Hans Scholl pflegte.[143]
Der Freundeskreis war jedoch nicht auf bestimmte Personen reduziert, sondern stets offen für gleichgesinnte Geister. Ausschlaggebend für die Integration war keineswegs eine betont politische Haltung, sondern vielmehr die moralische Ablehnung der NS-Diktatur, sowie das Interesse an geistigen, kulturellen und religiösen Werten, welche von den Nationalsozialisten mißachtet und bekämpft wurden.[144] Besonders Hans Scholl, berichtet Traute Lafrenz, „knüpfte immer wieder Beziehungen an zu Menschen, von denen er annehmen konnte, daß sie geistig und politisch unserer Richtung entsprechen mußten. So bekam man das Gefühl, als existierte ein breit gespanntes vielmaschiges Netz Gleichdenkender…“[145]. So gehörte Inge Scholl, während sie die Geschwister in München besuchte, ebenso selbstverständlich der Gruppe an, wie Willi Grafs Schwester Anneliese, als sie im Herbst 1942 zu ihrem Bruder zog. Einige Gleichgesinnte aus der Studentenkompanie suchten ebenfalls den Kontakt zu diesem Freundeskreis. Darunter befanden sich Jürgen Wittenstein, Hubert Furtwängler und Ottmar Hammerstein (vgl. C I.), die die Freunde oft bei Veranstaltungen, insbesondere bei Lese- und Diskussionsabenden trafen. In die späteren Aktionen waren sie allerdings, ebenso wie Inge Scholl und Anneliese Graf, nicht genau eingeweiht.[146]
III. Mentoren und Vorbilder der Münchener Studenten
Während sich das Jahr 1941 dem Ende neigte, erhielt das Denken des Kreises eine neue Richtung: Hans Scholl, der stets bemüht war, Kontakte zu geistesverwandten älteren Menschen herzustellen, lernte den Herausgeber Carl Muth, den katholischen Kulturphilosophen Theodor Haecker und den Münchener Professor Kurt Huber kennen. Persönlichkeiten, welche nicht nur durch ihre staatsfeindliche Gesinnung den Kreis der Studenten in bereichernder Weise ergänzten, sondern auch -zum Teil auf sehr unterschiedliche Weise- durch ihre Erfahrungen, Überzeugungen und ihr Wissen neue Impulse lieferten.
1. Carl Muth
Im Herbst 1941 lernte Hans Scholl durch seinen Jugendfreund Otl Aicher[147] den katholischen Publizisten Carl Muth kennen . Carl Muth war der Herausgeber der geachteten katholischen Monatsschrift Hochland, welche er 1903 -so jedenfalls A. Dumbach und J. Newborn- „als Stimme des katholischen Fortschritts“[148] gegründet hatte. Nach fast vierzigjährigem Erscheinen wurde die Zeitschrift im Juli 1941 von den Nationalsozialisten verboten, obwohl Muth seit der Machtübernahme 1933 nicht ein einziges Mal in seinen Veröffentlichungen den Namen Hitler erwähnt hatte.[149] Dies bedeutete jedoch wahrlich nicht, daß er die nationalsozialistische Diktatur keiner Kritik unterzog, was durch das -wenn auch spät verhängte- Verbot belegt wurde. Er hatte vielmehr -wie andere oppositionelle Publizisten auch- indirekte Methoden entwickelt, um seine Ablehnung kundzutun, beispielsweise durch versteckte Satiren, Metaphern und historische Analogien, deren aktuelle Bezüge für den denkenden Leser nicht zu übersehen waren.[150]
Für Hans Scholl wurde die Begegnung mit dem fast fünfzig Jahre älteren Gelehrten zum Schlüsselerlebnis. Er hatte eigentlich im Hause Carl Muths nur etwas abzugeben, kam aber mit dem älteren Gelehrten ins Gespräch, der ihn zu weiteren Besuchen einlud. Nach den ersten „tastenden Gesprächen“[151] war der Kontakt schnell hergestellt. Zuneigung und gegenseitiger Respekt prägten das herzliche Verhältnis, welches sich -trotz des großen Altersunterschiedes und den unterschiedlichen Lebensformen- rasch entwickelte.[152] Dies lag zum einen daran, daß Carl Muth große Sympathien für den jungen Mann hegte, der durch seine sowohl herzlichen als auch impulsiven Wesenszüge die Gunst des Älteren gewann. Zum anderen war Carl Muth stets -motiviert durch sein pädagogisches Interesse- bestrebt, auf junge Menschen einzuwirken und -so H. Steffahn- „als Bildner an ihrer Weltsicht (zu) modellieren“[153]. Ein Freund Carl Muths weiß hierüber zu berichten: „Sicher ist, daß (Muth) sein ganzes Leben hindurch das Anliegen der jeweils jüngeren Generation nicht nur zu verstehen, sondern liebend mitzuerleben vermochte.“[154] Hierbei war die konfessionelle Bindung der Schützlinge zweitrangig. Carl Muth war nämlich keineswegs ein dogmatischer Katholik und es lag ihm fern, „schmalsichtige Mission“[155] zu betreiben. Er schwebte vielmehr in einem Zustand -so Inge Scholl- „zwischen Exkommunikation und Heiligkeit“.[156]
Um den neuen Freund nun öfter in seinem Haus empfangen zu können, beauftragte Carl Muth Hans Scholl mit der Katalogisierung seiner Bibliothek, und so verkehrten beide fast täglich miteinander. Auf diese Weise konnte sich Hans Scholl nicht nur an den Klassikern multikultureller Literatur[157] -Plato, Claudel, Bernanos, Marx und Dostojewski- erfreuen, sondern fand auch in langen Gesprächen mit dem Gelehrten einen Verbündeten in seinem Protest gegen die Gewaltherrschaft in Deutschland. Sie debattierten über mannigfaltige Themen, welche hauptsächlich philosophischer und religionsphilosophischer Art waren. Hans Scholls oppositionelle Haltung nährte die Hoffnung Muths, daß das deutsche Volk sich „durch die bevorstehenden bitteren Leiden“[158] läutere, „auf sein eigenes Wesen“[159] zurückbesinne und „sein europäisches und christliches Gewissen“[160] wiedererlange. Der wache und interessierte Geist des Studenten war für Carl Muth „eine Quelle der Erfrischung und des Trostes“[161] und nur allzu gerne war er bereit, seinem Schützling das geistige und seelische Rüstzeug mit auf den beschwerlichen Weg des Widerstandes zu geben. Doch nicht nur Hans war von dem Zauber des alten Mannes beeindruckt und in seinen Bann gezogen, auch seine Schwestern Sophie und Inge suchten den Kontakt zu Muth und besuchten ihn regelmäßig, nachdem Hans sie miteinander bekannt gemacht hatte.[162]
Unter dem Einfluß des Gelehrten widmete sich Hans zu jener Zeit immer häufiger religionsphilosophischen Fragen, vernachlässigte das Studium der Medizin und seine partielle Abneigung gegen die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten verstärkte sich.[163] In einem Brief schilderte er deutlich seinen inneren Spannungszustand: „Ich befinde mich in einer Krise, der bedeutendsten meines Lebens… Ich befinde mich in einem Seelenzustand, wo mir von außen überhaupt nicht geholfen werden kann, weil ich im tiefsten Inneren schon überwunden habe, erkannt habe und glücklich bin… Es ist das Glück des Siegers, der das Ende des Kampfes voraussieht….“[164].
[...]
[1] Vgl. hierzu H. MEHRINGER, Widerstand und Emigration, 1997, S. 9.
[2] Vgl. hierzu H. MAIER, Das Recht auf Widerstand, in: P. Steinbach / J. Tuchel (Hrsg.), Widerstand gegen den Nationalsozialismus, 1994, S. 33.
[3] Vgl. C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 9.
[4] Vgl. hierzu C. MOLL, Die Weiße Rose, in: P. Steinbach / J. Tuchel (Hrsg.), Widerstand gegen den Nationalsozialismus, 1994, S. 444; sowie M. KISSENER, Literatur zur Weißen Rose 1971-1992, in: R. Lill (Hrsg.), Hochverrat? Die »Weiße Rose« und ihr Umfeld, 1993, S. 159.
[5] Vgl. hierzu C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 10.
[6] Vgl. dazu C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 15 f.
[7] Vgl. dazu H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 13; vgl. dazu auch C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 25; R. HUCH, Die Aktion der Münchener Studenten, in: Neue Auslese, 3, 1948, Heft 12, S. 4; WEISSE ROSE STIFTUNG (Hrsg.), Die Weiße Rose, Ausstellungskatalog, 1995, S. 35; P. ALTMANN (Hrsg.), Antifaschistischer Widerstand, 1975, S. 202; sowie G. SCHOTT, Gedenkausstellung, 1983, S. 4 .
[8] Vgl. C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 25; vgl. dazu auch WEISSE ROSE STIFTUNG (Hrsg.), Die Weiße Rose, Ausstellungskatalog, 1995, S. 38; R. HUCH, Die Aktion der Studenten, in: Neue Auslese, 3, 1948, Heft 12, S. 4 .
[9] Vgl. M. SCHNEIDER / W. SÜSS, Keine Volksgenossen, 1993, S. 10; vgl. dazu auch BUNDESZENTRALE F.P.B. (Hrsg.), „Die Weiße Rose“, in: Der deutsche Widerstand. Informationen zur politischen Bildung, 1987, Heft 160, S. 20.
[10] Vgl. dazu H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 13 f.; vgl. hierzu auch C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 25.
[11] Vgl. I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 12 f.; vgl. dazu auch K. DROBISCH (Hrsg.), Wir schweigen nicht, 1968, S. 7 .
[12] Vgl. H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 14.
[13] Vgl. R. HUCH, Die Aktion der Studenten, in: Neue Auslese, 3, 1948, Heft 12, S. 4; vgl. dazu auch C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 25 .
[14] Vgl. R. HUCH, Die Aktion der Studenten, in: Neue Auslese, 3, 1948, Heft 12, S. 4 f.; vgl. hierzu auch K. DROBISCH (Hrsg.), Wir schweigen nicht, 1968, S. 7; C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 25.
[15] Vgl. hierzu R. HUCH, Die Aktion der Studenten, in: Neue Auslese, 3, 1948, Heft 12, S. 5.
[16] Vgl. dazu M. SCHNEIDER / W. SÜSS, Keine Volksgenossen, 1993, S. 10; vgl. dazu auch I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 14; H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 15.
[17] Vgl. dazu H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 15.
[18] Vgl. I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 14.
[19] Vgl. I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 14; vgl. dazu auch K. DROBISCH (Hrsg.), Wir schweigen nicht, 1968, S. 8.
[20] Vgl. C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 26.
[21] Vgl. M. SCHNEIDER / W. SÜSS, Keine Volksgenossen, 1993, S. 10; vgl. hierzu auch H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 15 f.
[22] Vgl. H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 15.
[23] Vgl. I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 14.
[24] Vgl. I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 14; vgl. dazu auch H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 17.
[25] Vgl. C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 27; vgl. dazu auch I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 14 f.
[26] Vgl. dazu K. DROBISCH (Hrsg.), Wir schweigen nicht, 1968, S. 8 ; vgl. hierzu auch K.-H. JAHNKE, Weiße Rose contra Hakenkreuz, 1969, S. 18 ; I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 17; H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 20; M. SCHNEIDER / W. SÜSS, Keine Volksgenossen, 1993, S. 20 ; WEISSE ROSE STIFTUNG (Hrsg.), Die Weiße Rose, Ausstellungskatalog, 1995, S. 35.
[27] Vgl. dazu C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 28.
[28] Vgl. I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 15; vgl. dazu auch K. DROBISCH (Hrsg.), Wir schweigen nicht, 1968, S. 8 f .; H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 20; T. PRITTIE, Die „Weiße Rose“, in: Deutsche gegen Hitler, 1964, S. 184.
[29] Vgl. dazu K.-H. JAHNKE, Weiße Rose contra Hakenkreuz, 1969, S. 20 ; vgl. auch K. DROBISCH (Hrsg.), Wir schweigen nicht, 1968, S. 9; T. PRITTIE, Die „Weiße Rose“, in: Deutsche gegen Hitler, 1964, S. 184.
[30] Vgl. dazu T. PRITTIE, Die „Weiße Rose“, in: Deutsche gegen Hitler, 1964, S. 184; K. DROBISCH (Hrsg.), Wir schweigen nicht, 1968, S. 9.
[31] Vgl. dazu H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 18 f.
[32] Vgl. BUNDESZENTRALE F.P.B. (Hrsg.), „Die Weiße Rose“, in: Der deutsche Widerstand. Informationen zur politischen Bildung, 1987, Heft 160, S. 20; vgl. dazu auch C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 27.
[33] Vgl. dazu I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 15 f .; sowie H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 20 ; C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 27 ; K.-H. JAHNKE, Weiße Rose contra Hakenkreuz, 1969, S. 18.
[34] Vgl. dazu C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 27; vgl. hierzu auch I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 16; H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 20 f.; K. DROBISCH (Hrsg.), Wir schweigen nicht, 1968, S. 9.
[35] Vgl. I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S.16.
[36] Pimpfe waren Angehörige des nationalsozialistischen Jungvolkes, der Vorstufe der Hitlerjugend.
[37] Vgl. dazu C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 27; H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 21; I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 16 f.; K. DROBISCH (Hrsg.), Wir schweigen nicht, 1968, S. 9.
[38] Vgl. I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 16 f.
[39] Vgl. I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 16 f.
[40] Vgl. hierzu K. DROBISCH (Hrsg.), Wir schweigen nicht, 1968, S. 9; vgl. dazu auch I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 17.
[41] Vgl. dazu H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 21; K. DROBISCH (Hrsg.), Wir schweigen nicht, 1968, S. 10; C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 27; sowie I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 19.
[42] Vgl. dazu C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 28; vgl. hierzu auch H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 32.
[43] Vgl. dazu K. DROBISCH (Hrsg.), Wir schweigen nicht, 1968, S. 10; H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 21 f.; I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 19 f.
[44] Vgl. K. DROBISCH (Hrsg.), Wir schweigen nicht, 1968, S. 10; vgl. dazu auch I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 21.
[45] Vgl. dazu K.-H. JAHNKE, Weiße Rose contra Hakenkreuz, 1969, S. 19; H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 22; K. DROBISCH (Hrsg.), Wir schweigen nicht, 1968, S. 11; BUNDESZENTRALE F.P.B. (Hrsg.), „Die Weiße Rose“, in: Der deutsche Widerstand. Informationen zur politischen Bildung, 1987, Heft 160, S. 20.
[46] Vgl. dazu H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 23; C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 27; BUNDESZENTRALE F.P.B. (Hrsg.), „Die Weiße Rose“, in: Der deutsche Widerstand. Informationen zur politischen Bildung, 1987, Heft 160, S. 20.
[47] Vgl. dazu C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 28; H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 24.
[48] Vgl. R. HUCH, Die Aktion der Studenten, in: Neue Auslese, 3, 1948, Heft 12, S. 7.
[49] Vgl. R. HUCH, Die Aktion der Studenten, in: Neue Auslese, 3, 1948, Heft 12, S. 7.
[50] Vgl. dazu C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 28; K. DROBISCH (Hrsg.), Wir schweigen nicht, 1968, S. 12 ; I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 23; R. HUCH, Die Aktion der Studenten, in: Neue Auslese, 3, 1948, Heft 12, S. 7.
[51] Vgl. dazu C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 28; R. HUCH, Die Aktion der Studenten, in: Neue Auslese, 3, 1948, Heft 12, S. 7.
[52] Vgl. C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 28.
[53] Vgl. W. REHM, Dokumentation, in: Notizen, 7, Nr. 46 vom Februar 1963, S. 8 ; vgl. dazu auch K. DROBISCH (Hrsg.), Wir schweigen nicht, 1968, S. 12; C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 28.
[54] Vgl. I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 24.
[55] Vgl. I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 19; vgl. dazu auch H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 24.
[56] Vgl. dazu WEISSE ROSE STIFTUNG (Hrsg.), Die Weiße Rose, Ausstellungskatalog, 1995, S. 38; C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 31; R. HUCH, Die Aktion der Studenten, in: Neue Auslese, 3, 1948, Heft 12, S. 8 f.
[57] Vgl. I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 30.
[58] Vgl. dazu I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 30.
[59] Vgl. C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 29.
[60] Vgl. C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 30; vgl. dazu auch BUNDESZENTRALE F.P.B. (Hrsg.), „Die Weiße Rose“, in: Der deutsche Widerstand. Informationen zur politischen Bildung, 1987, Heft 160, S. 20.
[61] Vgl. dazu C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 30.
[62] Vgl. I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 30; vgl. hierzu auch G. ZIMMERMANN, Sie widerstanden, 1995, S. 12.
[63] Vgl. dazu C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 29 f.
[64] Vgl. dazu R. HUCH, Die Aktion der Studenten, in: Neue Auslese, 3, 1948, Heft 12, S. 9; vgl. hierzu auch C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 31; P. ALTMANN (Hrsg.), Antifaschistischer Widerstand, 1975, S. 203.
[65] Vgl. dazu R. HUCH, Alexander Schmorell, in: Akademische Rundschau, 3, 1948/49, Heft 3, S. 193; vgl. hierzu auch C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 16; WEISSE ROSE STIFTUNG (Hrsg.), Die Weiße Rose, Ausstellungskatalog, 1995, S. 32; K. DROBISCH (Hrsg.), Wir schweigen nicht, 1968, S. 13; P. ALTMANN (Hrsg.), Antifaschistischer Widerstand, 1975, S. 203.
[66] Vgl. dazu H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 40; ebenso C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 16; R. HUCH, Alexander Schmorell, in: Akademische Rundschau, 3, 1948/49, Heft 3, S. 193.
[67] Vgl. dazu C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 16; R. HUCH, Alexander Schmorell, in: Akademische Rundschau, 3, 1948/49, Heft 3, S. 193; M. SCHNEIDER / W. SÜSS, Keine Volksgenossen, 1993, S. 12; WEISSE ROSE STIFTUNG (Hrsg.), Die Weiße Rose, Ausstellungskatalog, 1995, S. 32.
[68] Vgl. dazu R. HUCH, Alexander Schmorell, in: Akademische Rundschau, 3, 1948/49, Heft 3, S. 195.
[69] Vgl. dazu C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 16; R. HUCH, Alexander Schmorell, in: Akademische Rundschau, 3, 1948/49, Heft 3, S. 195.
[70] Vgl. dazu H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 40; M. SCHNEIDER / W. SÜSS, Keine Volksgenossen, 1993, S. 12; C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 16; R. HUCH, Alexander Schmorell, in: Akademische Rundschau, 3, 1948/49, Heft 3, S. 195.
[71] Vgl. R. HUCH, Alexander Schmorell, in: Akademische Rundschau, 3, 1948/49, Heft 3, S. 193.
[72] Vgl. R. HUCH, Alexander Schmorell, in: Akademische Rundschau, 3, 1948/49, Heft 3, S . 194.
[73] Vgl. C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 16 ; vgl. dazu auch H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 40.
[74] Vgl. H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 41; vgl. auch C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 17.
[75] Vgl dazu R. HUCH, Alexander Schmorell, in: Akademische Rundschau, 3, 1948/49, Heft 3, S. 194 ; vgl. dazu H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 40 ; C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 17.
[76] Vgl. dazu H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 40.
[77] Vgl. dazu M. SCHNEIDER / W. SÜSS, Keine Volksgenossen, 1993, S. 12; vgl. dazu auch C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 17; R. HUCH, Alexander Schmorell, in: Akademische Rundschau, 3, 1948/49, Heft 3, S. 195; H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 40.
[78] Vgl. dazu C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 17; M. SCHNEIDER / W. SÜSS, Keine Volksgenossen, 1993, S. 12.
[79] Vgl. dazu R. HUCH, Alexander Schmorell, in: Akademische Rundschau, 3, 1948/49, Heft 3, S. 194; vgl. dazu auch C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 17.
[80] Vgl. dazu WEISSE ROSE STIFTUNG (Hrsg.), Die Weiße Rose, Ausstellungskatalog, 1995, S. 32; vgl. dazu auch C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 18.
[81] Vgl. C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 18; vgl. dazu auch H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 40.
[82] Vgl. dazu C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 18; vgl. dazu auch WEISSE ROSE STIFTUNG (Hrsg.), Die Weiße Rose, Ausstellungskatalog, 1995, S. 32; P. ALTMANN (Hrsg.), Antifaschistischer Widerstand, 1975, S. 203.
[83] Vgl. dazu C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 18.
[84] Vgl. dazu H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 42; vgl. dazu auch P. ALTMANN (Hrsg.), Antifaschistischer Widerstand, 1975, S. 203 .
[85] Vgl. dazu G. SCHOTT, Gedenkausstellung, 1983, S. 5; C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 19; vgl. hierzu auch H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 43; WEISSE ROSE STIFTUNG (Hrsg.), Die Weiße Rose, Ausstellungskatalog, 1995, S. 29.
[86] Vgl. dazu H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 44; vgl. hierzu auch WEISSE ROSE STIFTUNG (Hrsg.), Die Weiße Rose, Ausstellungskatalog, 1995, S. 29; C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 19.
[87] Vgl. hierzu C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 19; vgl. dazu auch WEISSE ROSE STIFTUNG (Hrsg.), Die Weiße Rose, Ausstellungskatalog, 1995, S. 29.
[88] Vgl. dazu H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 44; M. SCHNEIDER / W. SÜSS, Keine Volksgenossen, 1993, S. 12; C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 19 f.; G. SCHOTT, Gedenkausstellung, 1983, S. 5.
[89] Vgl. dazu WEISSE ROSE STIFTUNG (Hrsg.), Die Weiße Rose, Ausstellungskatalog, 1995, S. 29; vgl. hierzu auch C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 20.
[90] Vgl. hierzu H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 44; C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 20.
[91] Vgl. dazu C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 19; vgl. hierzu auch H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 44; WEISSE ROSE STIFTUNG (Hrsg.), Die Weiße Rose, Ausstellungskatalog, 1995, S. 29; M. SCHNEIDER / W. SÜSS, Keine Volksgenossen, 1993, S. 13.
[92] Vgl. H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 44 .
[93] Vgl. dazu G. SCHOTT, Gedenkausstellung, 1983, S. 5; C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 20; vgl. hierzu auch WEISSE ROSE STIFTUNG (Hrsg.), Die Weiße Rose, Ausstellungskatalog, 1995, S. 29.
[94] Vgl. H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 44.
[95] Vgl. C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 20.
[96] Vgl. dazu M. SCHNEIDER / W. SÜSS, Keine Volksgenossen, 1993, S. 13.
[97] Vgl. H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 46.
[98] Vgl. H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 46 .
[99] Vgl. C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 21.
[100] Vgl. WEISSE ROSE STIFTUNG (Hrsg.), Die Weiße Rose, Ausstellungskatalog, 1995, S. 27.
[101] Vgl. dazu M. SCHNEIDER / W. SÜSS, Keine Volksgenossen, 1993, S. 13; vgl. hierzu auch H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 44; C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 21.
[102] Vgl. hierzu A. KNOOP-GRAF / I. JENS (Hrsg.), Willi Graf, 1994, S. 7; K. DROBISCH (Hrsg.), Wir schweigen nicht, 1968, S. 16; vgl. dazu auch WEISSE ROSE STIFTUNG (Hrsg.), Die Weiße Rose, Ausstellungskatalog, 1995, S. 20.
[103] Vgl. dazu C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 21; WEISSE ROSE STIFTUNG (Hrsg.), Die Weiße Rose, Ausstellungskatalog, 1995, S. 20.
[104] Vgl. K. VIELHABER (Hrsg.), Gewalt und Gewissen, 1964, S. 37.
[105] Vgl. dazu A. KNOOP-GRAF, Willi Graf und die Ausweitung des Widerstandes, in: R. Lill (Hrsg.), Hochverrat? Die »Weiße Rose« und ihr Umfeld, 1993, S. 52; H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 46; K. DROBISCH (Hrsg.), Wir schweigen nicht, 1968, S. 16.
[106] Vgl. K. VIELHABER (Hrsg.), Gewalt und Gewissen, 1964, S. 38.
[107] Vgl. dazu A. KNOOP-GRAF, Willi Graf und die Ausweitung des Widerstandes, in: R. Lill (Hrsg.), Hochverrat? Die »Weiße Rose« und ihr Umfeld, 1993, S. 52.
[108] Vgl. M. SCHNEIDER / W. SÜSS, Keine Volksgenossen, 1993, S. 11.
[109] Vgl. M. SCHNEIDER / W. SÜSS, Keine Volksgenossen, 1993, S. 11 .
[110] Vgl. A. KNOOP-GRAF, Willi Graf und die Ausweitung des Widerstandes, in: R. Lill (Hrsg.), Hochverrat? Die »Weiße Rose« und ihr Umfeld, 1993, S. 54.
[111] Vgl. WEISSE ROSE STIFTUNG (Hrsg.), Die Weiße Rose, Ausstellungskatalog, 1995, S. 20.
[112] Vgl. WEISSE ROSE STIFTUNG (Hrsg.), Die Weiße Rose, Ausstellungskatalog, 1995, S. 20.
[113] Vgl. K. VIELHABER (Hrsg.), Gewalt und Gewissen, 1964, S. 18; vgl. auch H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 46.
[114] Vgl. dazu WEISSE ROSE STIFTUNG (Hrsg.), Die Weiße Rose, Ausstellungskatalog, 1995, S. 20; vgl. hierzu auch H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 46.
[115] Vgl. H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 47.
[116] Vgl. A. KNOOP-GRAF, Willi Graf und die Ausweitung des Widerstandes, in: R. Lill (Hrsg.), Hochverrat? Die »Weiße Rose« und ihr Umfeld, 1993, S. 56.
[117] Vgl. K. VIELHABER (Hrsg.), Gewalt und Gewissen, 1964, S. 26.
[118] Vgl. A. KNOOP-GRAF, Willi Graf und die Ausweitung des Widerstandes, in: R. Lill (Hrsg.), Hochverrat? Die »Weiße Rose« und ihr Umfeld, 1993, S. 56.
[119] Vgl. hierzu A. KNOOP-GRAF, Willi Graf und die Ausweitung des Widerstandes, in: R. Lill (Hrsg.), Hochverrat? Die »Weiße Rose« und ihr Umfeld, 1993, S. 59.
[120] Vgl. K. VIELHABER (Hrsg.), Gewalt und Gewissen, 1964, S. 66; sowie C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 25.
[121] Vgl. K. VIELHABER (Hrsg.), Gewalt und Gewissen, 1964, S. 66; vgl. auch C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 25.
[122] Vgl. dazu M. SCHNEIDER / W. SÜSS, Keine Volksgenossen, 1993, S. 15 f .
[123] Vgl. dazu C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 32.
[124] Vgl. dazu M. SCHNEIDER / W. SÜSS, Keine Volksgenossen, 1993, S. 16; vgl. hierzu auch R. HANSER, Deutschland zuliebe, 1980, S. 128; C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 33.
[125] Vgl. R. HANSER, Deutschland zuliebe, 1980, S. 128.
[126] Vgl. M. SCHNEIDER / W. SÜSS, Keine Volksgenossen, 1993, S. 16.
[127] Vgl. C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 33 f.
[128] Vgl. C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 33; ebenso R. HANSER, Deutschland zuliebe, 1980, S. 129.
[129] Vgl. I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 27.
[130] Vgl. I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 27 .
[131] Vgl. I. SCHOLL, Die Weiße Rose, 1993, S. 27.
[132] Vgl. dazu R. HANSER, Deutschland zuliebe, 1980, S. 130; vgl. hierzu auch H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 45.
[133] Vgl. R. HANSER, Deutschland zuliebe, 1980, S. 134.
[134] Vgl. I.f.Z., H. AUERBACH Sammlung, Bd. 3, hier: maschinenschriftlicher Bericht von Traute Lafrenz vom 21. Februar 1947, S. 47.
[135] Vgl. M. SCHNEIDER / W. SÜSS, Keine Volksgenossen, 1993, S. 16.
[136] Vgl. hierzu M. SCHNEIDER / W. SÜSS, Keine Volksgenossen, 1993, S. 16; sowie C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 34.
[137] Vgl. C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 34.
[138] Vgl. C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 34.
[139] Vgl. dazu K. DROBISCH (Hrsg.), Wir schweigen nicht, 1968, S. 17; R. HANSER, Deutschland zuliebe, 1980, S. 160; vgl. hierzu auch C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 35.
[140] Vgl. dazu C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 36.
[141] Vgl. dazu I.f.Z., H. AUERBACH Sammlung, Bd. 3, hier: maschinenschriftlicher Bericht von Traute Lafrenz vom 21. Februar 1947, S. 47; ebenso C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 36.
[142] Vgl. R. HANSER, Deutschland zuliebe, 1980, S. 159.
[143] Vgl. dazu C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 36; sowie R. HANSER, Deutschland zuliebe, 1980, S. 159.
[144] Vgl. hierzu BUNDESZENTRALE F.P.B. (Hrsg.), „Die Weiße Rose“, in: Der deutsche Widerstand. Informationen zur politischen Bildung, 1987, Heft 160, S. 21; vgl. dazu auch C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 36.
[145] Vgl. I.f.Z., H. AUERBACH Sammlung, Bd. 3, hier: maschinenschriftlicher Bericht von Traute Lafrenz vom 21. Februar 1947, S. 47 .
[146] Vgl. hierzu C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 36; sowie R. HANSER, Deutschland zuliebe, 1980, S. 160 .
[147] Otl Aicher wurde von Werner Scholl als Freund in die Familie eingeführt. Er wurde 1937 gemeinsam mit den Geschwistern wegen bündischer Umtriebe verhaftet. Sie fanden in ihm einen Verbündeten gegen das NS-Regime. Während des Studiums in München setzte sich die enge Freundschaft mit Otl Aicher bis zur Hinrichtung der Geschwister Scholl durch stetigen Briefwechsel fort.
[148] Vgl. A. DUMBACH / J. NEWBORN, Die Geschichte der Weißen Rose, 1994, S. 110.
[149] Vgl. hierzu R. HANSER, Deutschland zuliebe, 1980, S. 135; ebenso H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 51; A. DUMBACH / J. NEWBORN, Die Geschichte der Weißen Rose, 1994, S. 110.
[150] Vgl. dazu M. SCHNEIDER / W. SÜSS, Keine Volksgenossen, 1993, S. 17; H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 51; vgl. hierzu auch C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 37.
[151] Vgl. R. HANSER, Deutschland zuliebe, 1980, S. 136.
[152] Vgl. dazu A. DUMBACH / J. NEWBORN, Die Geschichte der Weißen Rose, 1994, S. 110 f .; ebenso R. HANSER, Deutschland zuliebe, 1980, S. 136; C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 36 f .
[153] Vgl. H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 51.
[154] Vgl. F. J. SCHÖNINGH, Carl Muth. Ein europäisches Vermächtnis, in: Hochland, 39, 1946/47, Heft 1, S. 17 f.; sowie C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 37.
[155] Vgl. H. STEFFAHN, Weiße Rose, 1992, S. 51; vgl. hierzu auch R. HUCH, Die Aktion der Studenten, in: Neue Auslese, 3, 1948, Heft 12, S. 7.
[156] Vgl. A. DUMBACH / J. NEWBORN, Die Geschichte der Weißen Rose, 1994, S. 111 ; ebenso C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 38.
[157] Vgl. hierzu R. HANSER, Deutschland zuliebe, 1980, S. 137; vgl. auch A. DUMBACH / J. NEWBORN, Die Geschichte der Weißen Rose, 1994, S. 111; H. SIEFKEN (Hrsg.), Die Weiße Rose und ihre Flugblätter, 1994, S. 142.
[158] Vgl. C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 38 .
[159] Vgl. C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 38.
[160] Vgl. F. J. SCHÖNINGH, Carl Muth. Ein europäisches Vermächtnis, in: Hochland, 39, 1946/47, Heft 1, S. 17 f.; vgl. hierzu auch C. PETRY, Studenten aufs Schafott, 1968, S. 38.
[161] Vgl. R. HANSER, Deutschland zuliebe, 1980, S. 137.
[162] Vgl. hierzu A. DUMBACH / J. NEWBORN, Die Geschichte der Weißen Rose, 1994, S. 111; vgl. dazu auch R. HUCH, Die Aktion der Studenten, in: Neue Auslese, 3, 1948, Heft 12, S. 7 f.
[163] Vgl. hierzu K. DROBISCH (Hrsg.), Wir schweigen nicht, 1968, S. 18; ebenso M. SCHNEIDER / W. SÜSS, Keine Volksgenossen, 1993, S. 17 .
[164] Vgl. H. SIEFKEN (Hrsg.), Die Weiße Rose und ihre Flugblätter, 1994, S. 143; vgl. auch M. SCHNEIDER / W. SÜSS, Keine Volksgenossen, 1993, S. 17.