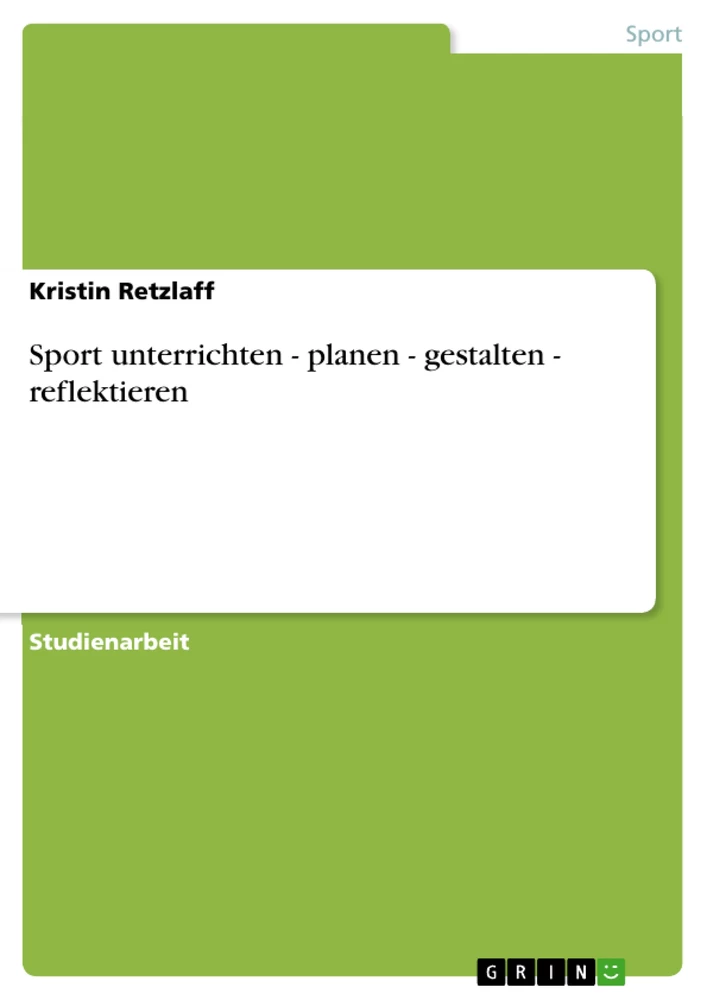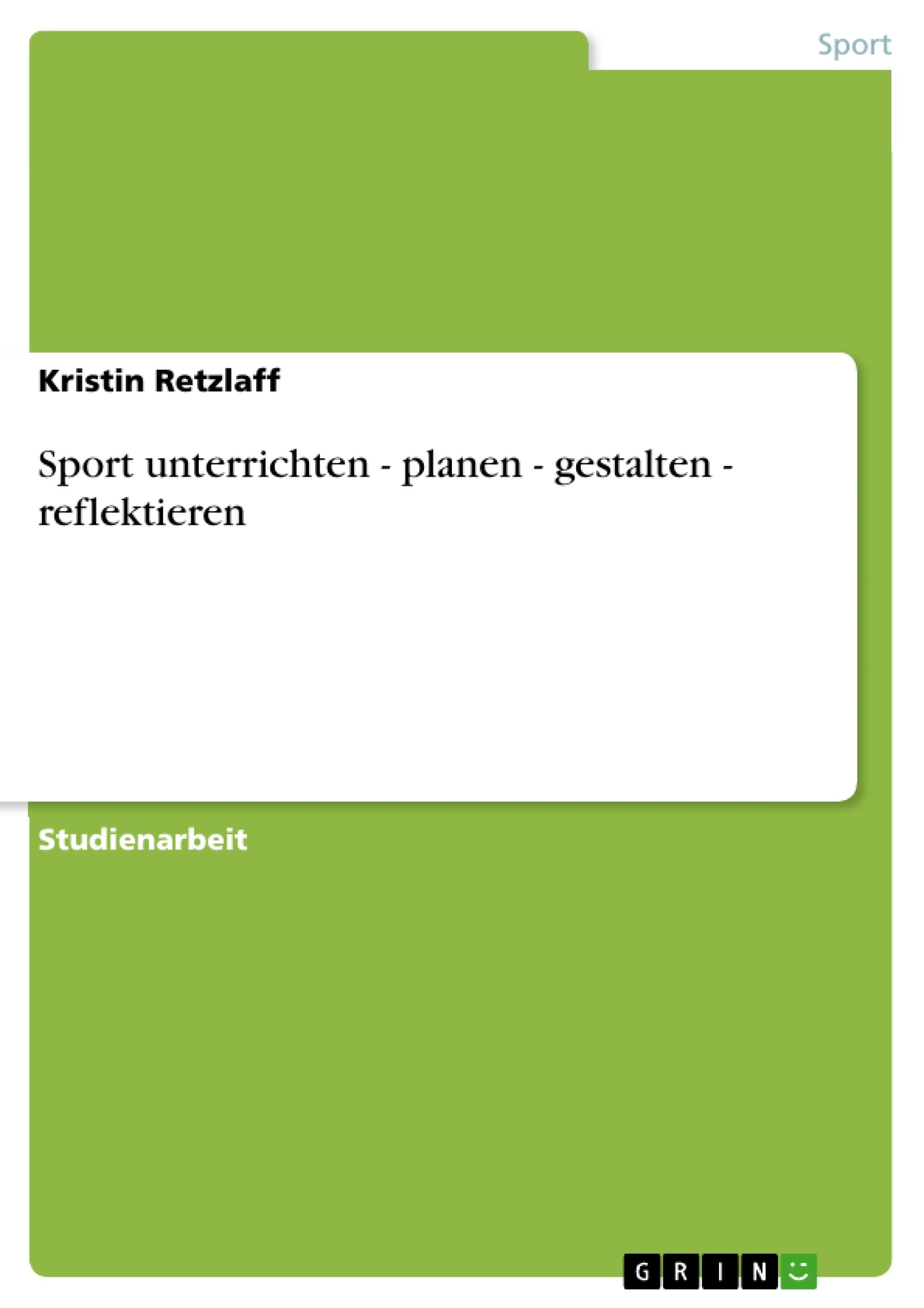1 Allgemeine Informationen ... 3
2 Bedingungsanalyse ... 3
2.1 Anthropogene Voraussetzungen ... 3
2.2 Soziokulturelle Voraussetzungen ... 4
3 Lernziele ... 4
3.1 Affektive Lernziele ... 4
3.2 Kognitive Lernziele ... 5
3.3 Soziale Lernziele ... 5
3.4 Motorische Lernziele ... 5
Literaturverzeichnis ... 5
Abbildungsverzeichnis ... 6
Abbildung 1: Jahresplan ... 7
Abbildung 2: Abschnittsplan ... 8
Abbildung 3: Unterrichtsstunde ... 9
Anhangsverzeichnis ... 11
Anhang 1 ... 12
Anhang 2 ... 13
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeine Informationen
2 Bedingungsanalyse
2.1 Anthropogene Voraussetzungen
2.2 Soziokulturelle Voraussetzungen
3 Lernziele
3.1 Affektive Lernziele
3.2 Kognitive Lernziele
3.3 Soziale Lernziele
3.4 Motorische Lernziele
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Jahresplan
Abbildung 2: Abschnittsplan
Abbildung 3: Unterrichtsstunde
Anhangsverzeichnis
Anhang 1
Anhang 2
1 Allgemeine Informationen
Das Hegel-Gymnasium ist eine Sprachenschule. Sie befindet sich in der Nähe des Hasselbachplatzes in der Hegelstraße und steht auf einem großzügigen Gelände mit zwei Gebäudekomplexen, dem Bismarck-Gebäude und dem Victoria-Gebäude. Beide sind durch Neuanbauten miteinander verbunden. Die Schule verfügt über drei Turnhallen, wovon zwei genutzt werden, die dritte Halle ist wegen Reparaturarbeiten gesperrt. Der Pausenhof ist sehr großzügig angelegt, in der Mitte befindet sich ein Basketballfeld. Zur aktiven Pausengestaltung werden Basketbälle ausgegeben. Die Schule umfasst ca. 800 Schüler. Alle Klassenstufen sind in Sprachklassen eingeteilt. Die Klasse 8/2 soll als Beispielklasse dienen, es ist eine Latein-Klasse und umfasst 20 Schüler.
2 Bedingungsanalyse
2.1 Anthropogene Voraussetzungen
Die Klasse hat einen normalen Leistungsstand. Das allgemeine Arbeitsverhalten ist durch eine gute Auffassungsgabe und durch ein hohes Maß an Selbständigkeit bei der Lösung von Aufgaben gekennzeichnet. Der Unterschied hinsichtlich der Absolvierung der Aufgabenstellung ist gering und das Arbeitstempo ist einheitlich. Die Arbeitsatmosphäre ist positiv, es scheint nur eine Einzelgängerin zu geben. Die Klasse wirkt homogen. Die Interessensgebiete zwischen Jungen und Mädchen unterscheiden sich wie folgt: die Jungen setzen sich mehr mit den Themen Sport, Ökonomie und Physik auseinander, die Mädchen scheinen dem Sport gegenüber eine ablehnende Haltung einzunehmen, dafür sind sie begeistert von Biologie und Geschichte. Die Klasse arbeitet diszipliniert, ruhig und partnerschaftlich. Sie sind Einzelarbeit, Gruppenarbeit sowie Frontalunterricht gewohnt. Die Mädchen erscheinen neben den Jungen reifer und kommunikativer. Das Alter der Klasse ist durchschnittlich 14 Jahre, ein Junge ist 15 Jahre und einmal sitzen geblieben.
2.2 Soziokulturelle Voraussetzungen
Die Klasse ist in 8 Jungen und 12 Mädchen unterteilt (heterogen). Es fand ein Auswahlverfahren statt. In der Klasse gibt es keine Ausländer. Die Schüler kommen aus unterschiedlichen Stadtteilen und vereinzelt ist die soziale Herkunft leicht erkennbar. Die Eltern nehmen mehrheitlich sogenannte Lehrersprechtage in Anspruch, um sich über Inhalte aus verschiedenen Unterrichtsstunden und Verhalten sowie Lerninteressen ihrer Sprösslinge zu erkundigen. Auch außerhalb fester Pflichtprogramme engagieren sie sich und tragen ihren Teil zu einer lebendigen Schule bei. Die Sitzordnung ist fast in jeder Stunde unterschiedlich, die Schüler finden sich aber dennoch zurecht und wissen, wie sie sich hinzusetzen haben. Im Sportunterricht sind die Jungen sehr eifrig, einige Mädchen lassen sich oft gehen und sind eher passiv. Es findet eine Trennung zwischen Jungen und Mädchen im Sportunterricht statt. Er wird gemeinsam in den Klassen 8/2 und 8/5 gehalten. Der Sportunterricht findet 2x pro Woche statt, dienstags 3. Stunde (9.35 – 10.20 Uhr) und freitags 5. Stunde (11.35 – 12.20 Uhr). Es sind keine Randstunden. Zwei Sporthallen werden genutzt. Der Sportunterricht der Jungen soll hier ausschlaggebend sein und wird als Grundlage für die Erarbeitung des Jahresplans, des Abschnittsplans sowie der Ausarbeitung einer 45-min-Unterrichtsstunde genommen.
3 Lernziele
3.1 Affektive Lernziele:
- Freude und Spaß am Spiel
- gegenseitiges Helfen
- Unterstützung innerhalb der Mannschaft
- realistische Ziele setzen, Ehrgeiz zeigen
- regelmäßige Teilnahme
3.2 Kognitive Lernziele:
- Regeln des Regelwerkes beherrschen
- Schiedsrichterzeichen beherrschen und anwenden
- geistiges Mitdenken während des Sportunterrichts
- Aufmerksamkeit auf Taktik und Technik
- Wissen von mehreren Taktik- und Technikmöglichkeiten
- Antizipation
3.3 Soziale Lernziele:
- Normen und Werte untereinander beachten (Fair play)
- Kommunikation mit den Mitspielern/Gegenspielern
- Mitentscheiden zum Erreichen des Ziels
3.4 Motorische Lernziele:
- Bewegungsschulung
- Koordination
- Kondition
- Kognition
- Gymnastik/Dehnung
- Technik/Taktik
- Fitness
- Spielerziehung
Literatur
Grössing, St.: Einführung in die Sportdidaktik. Limpert. Wiesbaden 1997
Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt (Hrsg.): Rahmenrichtlinien Sekundarschule Sport. Verlag Gebr. Garloff. Magdeburg
Sportpädagogik 1/99: Unterricht vorbereiten. Friedrich Verlag. Seelze 1999
[...]