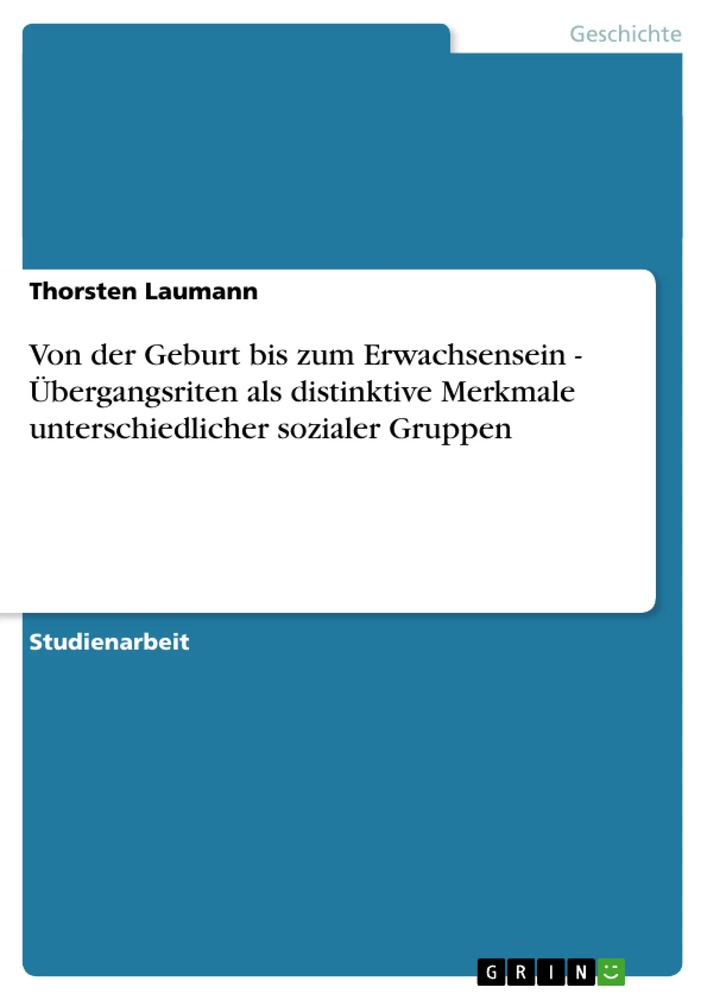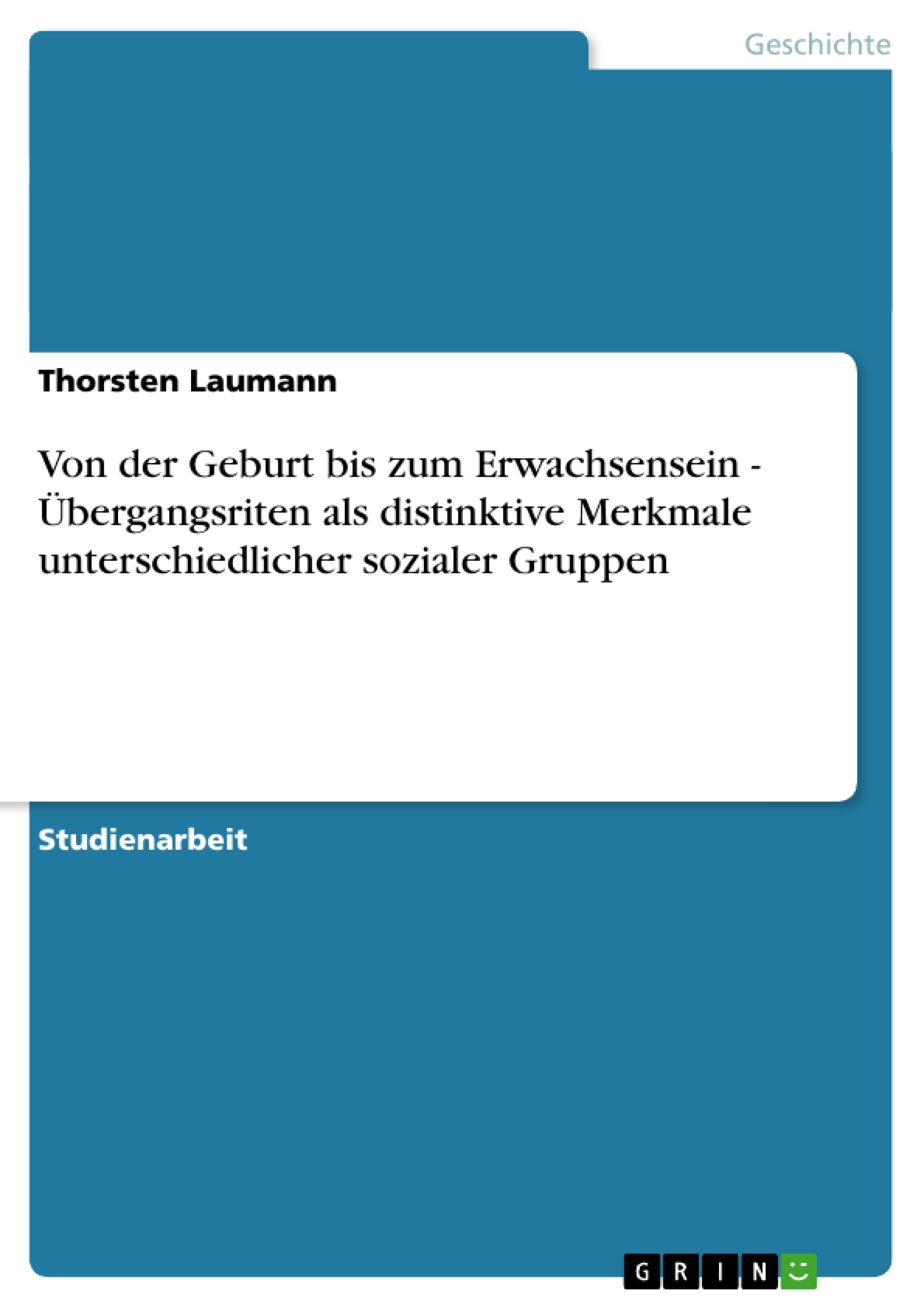Es war ein langer Weg, den die Menschen des Römischen Reiches durchleben mussten, bis sie als erwachsene Personen angesehen wurden. Das Kinder und Jugendalter wurde in mehrere Abschnitte untergliedert, in denen die Kinder jeweils an sozialem Ansehen gewannen. So begann das Leben mit der Geburt, wechselte in einen weiteren Abschnitt mit dem Zahnwechsel und auch mit dem einsetzen der ,,pubertas", der Pubertät. Weitere Stationen von der Geburt zum Erwachsensein waren das Anlegen der ,,toga virilis" und die oftmals anschließende Lehrzeit, das ,,tirocinium fori". Als absoluter Abschluss der Kinder- und Jugendphase galt im Römischen Reich und auch in der Kaiserzeit die Hochzeit.
Jeder dieser Lebensabschnitte wurde in der Antike mit einem Ritual zelebriert, das deutlich machte, dass das Kind beziehungsweise der Jugendliche in einen neuen sozialen Status eingetreten ist. Ob diese Übergangsriten aber bei Jungen und Mädchen, in allen Schichten und in allen regionalen Gebieten des Römischen Reiches dieselben waren, untersucht diese Arbeit. Während der Analyse wird dargestellt, wie die Rituale durchgeführt wurden und welche rechtlichen und sozialen Konsequenzen sie für die Kinder und Jugendlichen hatten. Ein Schwerpunkt legt diese Arbeit besonders auf den Übergang vom Jugend- zum Erwachsenenalter. Da gerade die Zeit des Kindesalter in der antiken Literatur oft als der schlimmste und meist verachtete Lebensabschnitt beschrieben wird1, galt der Übergang zum Status des Erwachsenen als ein sehr wichtiger Lebensabschnitt, der in vielen Quellen der Antike auch dargestellt wird. Somit werden dem Anlegen der ,,toga virilis" und dem Brauch der Hochzeit die größte Aufmerksamkeit geschenkt.
Zum Abschluss zieht diese Arbeit einen Vergleich zwischen der Anwendung der antiken Übergangsriten und denen der heutigen Zeit. Dabei soll analysiert werden, ob der Zeitpunkt des Zahnwechsels oder die Durchführung der Hochzeit heute dieselben Konsequenzen haben wie in der Antike, oder ob sie sich verändert haben.
Gestützt wird diese Untersuchung auf die antiken Quellen von mehreren bekannten Autoren. Da die Autoren der Antike hauptsächlich aus der Oberschicht der damaligen Gesellschaft stammen, sind heute vorrangig Informationen über die Erziehung in der Oberschicht erhalten. Dennoch werden auch Einsichten in das Erziehungswesen der Sklaven gegeben werden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Einteilung der Lebensalterphasen
3. Die Geburt
4. Der Zahnwechsel
5. Die Zeit des Tirocinium fori
6. Die Hochzeit
7. Die Anwendung der Sitten bei den Sklaven
8. Ein Vergleich mit den heutigen Bräuchen
9. Schlussbemerkung
10. Literaturverzeichnis
11. Quellen
1. Einleitung
Es war ein langer Weg, den die Menschen des Römischen Reiches durchleben mussten, bis sie als erwachsene Personen angesehen wurden. Das Kinder und Jugendalter wurde in mehrere Abschnitte untergliedert, in denen die Kinder jeweils an sozialem Ansehen gewannen. So begann das Leben mit der Geburt, wechselte in einen weiteren Abschnitt mit dem Zahnwechsel und auch mit dem einsetzen der „pubertas“, der Pubertät. Weitere Stationen von der Geburt zum Erwachsensein waren das Anlegen der „toga virilis“ und die oftmals anschließende Lehrzeit, das „tirocinium fori“. Als absoluter Abschluss der Kinder- und Jugendphase galt im Römischen Reich und auch in der Kaiserzeit die Hochzeit.
Jeder dieser Lebensabschnitte wurde in der Antike mit einem Ritual zelebriert, das deutlich machte, dass das Kind beziehungsweise der Jugendliche in einen neuen sozialen Status eingetreten ist. Ob diese Übergangsriten aber bei Jungen und Mädchen, in allen Schichten und in allen regionalen Gebieten des Römischen Reiches dieselben waren, untersucht diese Arbeit. Während der Analyse wird dargestellt, wie die Rituale durchgeführt wurden und welche rechtlichen und sozialen Konsequenzen sie für die Kinder und Jugendlichen hatten. Ein Schwerpunkt legt diese Arbeit besonders auf den Übergang vom Jugend- zum Erwachsenenalter. Da gerade die Zeit des Kindesalter in der antiken Literatur oft als der schlimmste und meist verachtete Lebensabschnitt beschrieben wird[1], galt der Übergang zum Status des Erwachsenen als ein sehr wichtiger Lebensabschnitt, der in vielen Quellen der Antike auch dargestellt wird. Somit werden dem Anlegen der „toga virilis“ und dem Brauch der Hochzeit die größte Aufmerksamkeit geschenkt.
Zum Abschluss zieht diese Arbeit einen Vergleich zwischen der Anwendung der antiken Übergangsriten und denen der heutigen Zeit. Dabei soll analysiert werden, ob der Zeitpunkt des Zahnwechsels oder die Durchführung der Hochzeit heute dieselben Konsequenzen haben wie in der Antike, oder ob sie sich verändert haben.
Gestützt wird diese Untersuchung auf die antiken Quellen von mehreren bekannten Autoren. Da die Autoren der Antike hauptsächlich aus der Oberschicht der damaligen Gesellschaft stammen, sind heute vorrangig Informationen über die Erziehung in der Oberschicht erhalten. Dennoch werden auch Einsichten in das Erziehungswesen der Sklaven gegeben werden.
2. Die Einteilung der Lebensalterphasen
In der Antike gab es keine festgelegte Einteilung der Lebensalterphasen. Zwar überschnitten sich die unzählig vielen Theorien über die Einteilung des Lebens oft in einigen Punkten, doch es gab keine allgemeingültige Vorstellung über die Abgrenzung der einzelnen Lebensabschnitte. Aus der Quelle „De aetatibus hominis“ von Isidorus geht eine Aufteilung hervor, die in der Antike jedoch einen großen Zuspruch erfuhr: „Gradus aetatis sex sunt: Infantia, pueritia, adulescentia, iuventus, gravitas atque senectus.“[2]
Die erste Stufe des Lebens, die „infantia“, ist nach Isidorus die Zeit von der Geburt bis zum siebten Lebensjahr. Sie zeichne sich dadurch aus, dass das Kind in dieser Phase noch nicht sprechen könne und zudem sehr unselbständig lebe. Der zweite Lebensabschnitt, in der Antike mit „pueritia“ bezeichnet, reiche bis zum 14. Lebensjahr. In dieser Zeit sei das Kind vom Gesetz her noch nicht zeugungsberechtigt. Das Alter des jungen Erwachsenen, „adulescentia“, dauere bis zum 28. Lebensjahr. Der stärkste von allen Abschnitten war nach Isidorus die Jugendzeit, die in der Antike oftmals bis zum 50. Lebensjahr dauerte. Bis zum 70. Jahr galt der Mensch im Römischen Reich als „gravitas“ und nicht mehr als jung, aber auch noch nicht als alt. Erst mit dem 70. Jahr an wurde der antike Mensch zum „senectus“ oder auch „senex“, also zum weisen Greis, ernannt.
Auffallend bei vielen Theorien über die Einteilung der Lebensalterphasen ist die Möglichkeit, sie rechnerisch zu interpretieren. So lassen sich einige Aufteilungen in ein Siebenerschema, andere wiederum in ein Fünferschema aufteilen. Das heißt, dass viele Einteilungen alle sieben beziehungsweise alle fünf Jahre einen neuen Einschnitt erleben, der den Menschen in einen neuen Lebensabschnitt führt.[3] Dennoch gibt es wie gesagt keinen allgemeingültigen Ansatz.
3. Die Geburt
Sehr zwiespältig wurde der Eintritt eines neues Menschen in das Leben gesehen. Einige antike Autoren berichten von großer Freude und Dankbarkeit über die Geburt eines Kindes, wiederum andere beschreiben die Geburt als ein sehr negatives Ereignis. Plinius der Ältere schreibt über die Niederkunft eines Kindes: „... nur den Menschen setzt sie [die Natur] am Tage seiner Geburt nackt und auf der bloßen Erde sogleich dem Wimmern und Weinen aus ... und mit Pein beginnt sein [das Kind] Leben.“[4] Dadurch wird die Einstellung vieler antiker Autoren deutlich, die die Geburt als eine erniedrigende Situation für den Menschen ansehen.
Anlässlich einer Geburt führten die Römer -wie es auch die Griechen taten- traditionelle Rituale durch. Nach dem Austritt den Neugeborenen aus dem Mutterleib wurde das Kind zuerst auf den Boden gelegt, um es so mit der Mutter Erde in Verbindung zu bringen. Danach prüfte die Hebamme die lebensnotwendigen Funktionen des Neugeborenen und durchtrennte die Nabelschnur. Zu diesem Zweck wurde es von der Erde aufgehoben, „levare und tolere infantem“, aufgerichtet und symbolisch auf die Füße gestellt, „statuere infantem“. Dem Vater wurde das Kind erst in den Arm gelegt, nachdem es medizinisch völlig versorgt und in Ordnung war. Während der Geburt wendeten die Römer oft spirituellartige Praktiken an, mit denen ein positiver Einfluss ausgeübt werden sollte. Dabei spielten Zaubersprüche, Amulette und auch der Glaube an bestimmte pflanzliche und tierische Mittel eine Rolle.
Nach der Geburt des Kindes bewachten für eine Nacht lang drei junge Männer das Haus der Wöchnerin und des neugeborenen Kindes. Das sollte die Mutter vor dem Angriff feindlich gesinnter Wesen schützen. Sie schlugen zuerst die Türschwelle mit einem Beil, dann mit einer Mörserkeule, „pilum“, und fegten sie letztendlich mit einem Besen rein. Aus diesen drei Säuberungsriten ergaben sich drei Schutzgötter für die Kinder, nämlich Intercidona, Pilumnus und Deverra.[5]
Die Namensgebung trug im antiken Rom die Bezeichnung „Nominalia“ und fand am „dies iustricus“ statt. Bei Mädchen war dies der achte, bei den Jungen der neunte Tag nach der Geburt. Abhängig gemacht wurde der Tag der Namensgebung von dem Abfallen des Restes der Nabelschnur. Warum gerade dieser Zeitpunkt für die „Nominalia“ festgesetzt wurde, lässt sich aus den überlieferten Quellen zum Thema Geburt nicht ersehen. An den „dies iustricus“ erhielten die Kinder aber nicht nur ihre Namen, sondern auch die religiöse Weihe durch ein Opfer im Haus oder eine Darstellung im Tempel, womit eine Feier und ein festliches Mahl der Familie verbunden waren.[6]
[...]
[1] Stahlmann, Ines: Lebensalter, Antike, in: Dinzelbacher, Peter: Europäische Mentalitätsgeschichte, Hauptthemen in Einzeldarstellungen, Stuttgart 1993. S. 209-210. Künftig zitiert als: Stahlmann: Lebensalter.
[2] Isid. orig. XI c.
[3] Höhn, Georg: Die Einteilungen der Lebens- und Weltalter bei Griechen und Römern, Würzburg 1912. S. 4.
[4] Plin. nat. VII, 2.
[5] Englhofer, Claudia: Geburtsriten und –bräuche, in: Der Neue Pauly, Band 4, Stuttgart, Weimar 1998. Spalten 839-841. Künftig zitiert als: Englhofer: Geburtsriten.
[6] Marquardt, Joachim: Das Privatleben der Römer, in: Marquardt Joachim und Mommsen, Theodor: Handbuch der Römischen Alterthümer, Leipzig 1886. S. 83-84. Künftig zitiert als: Marquardt: Privatleben.