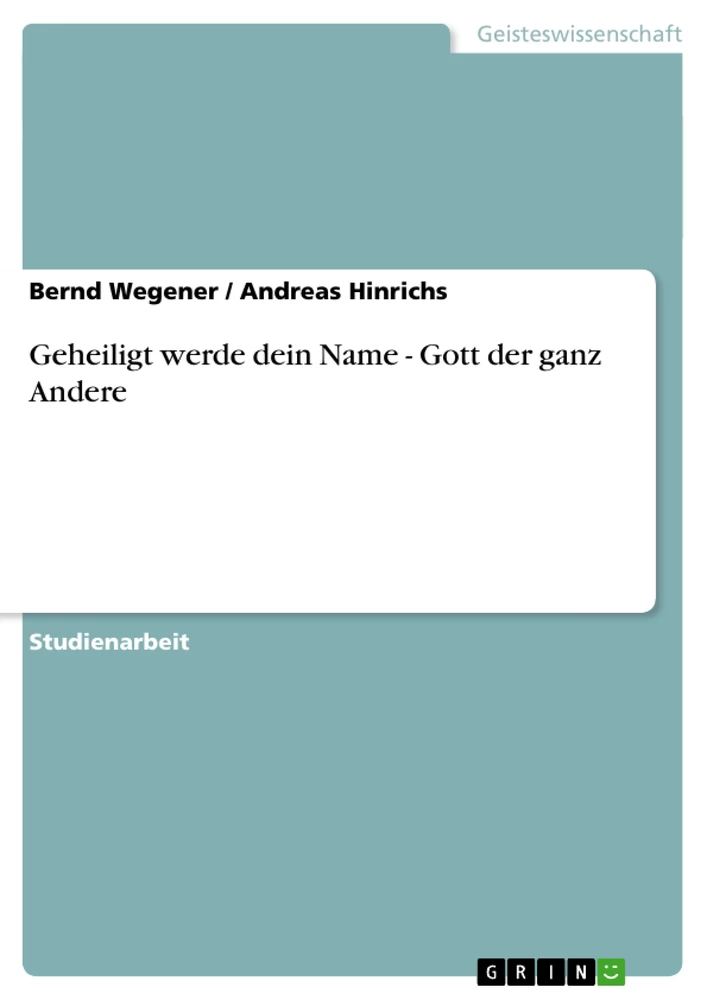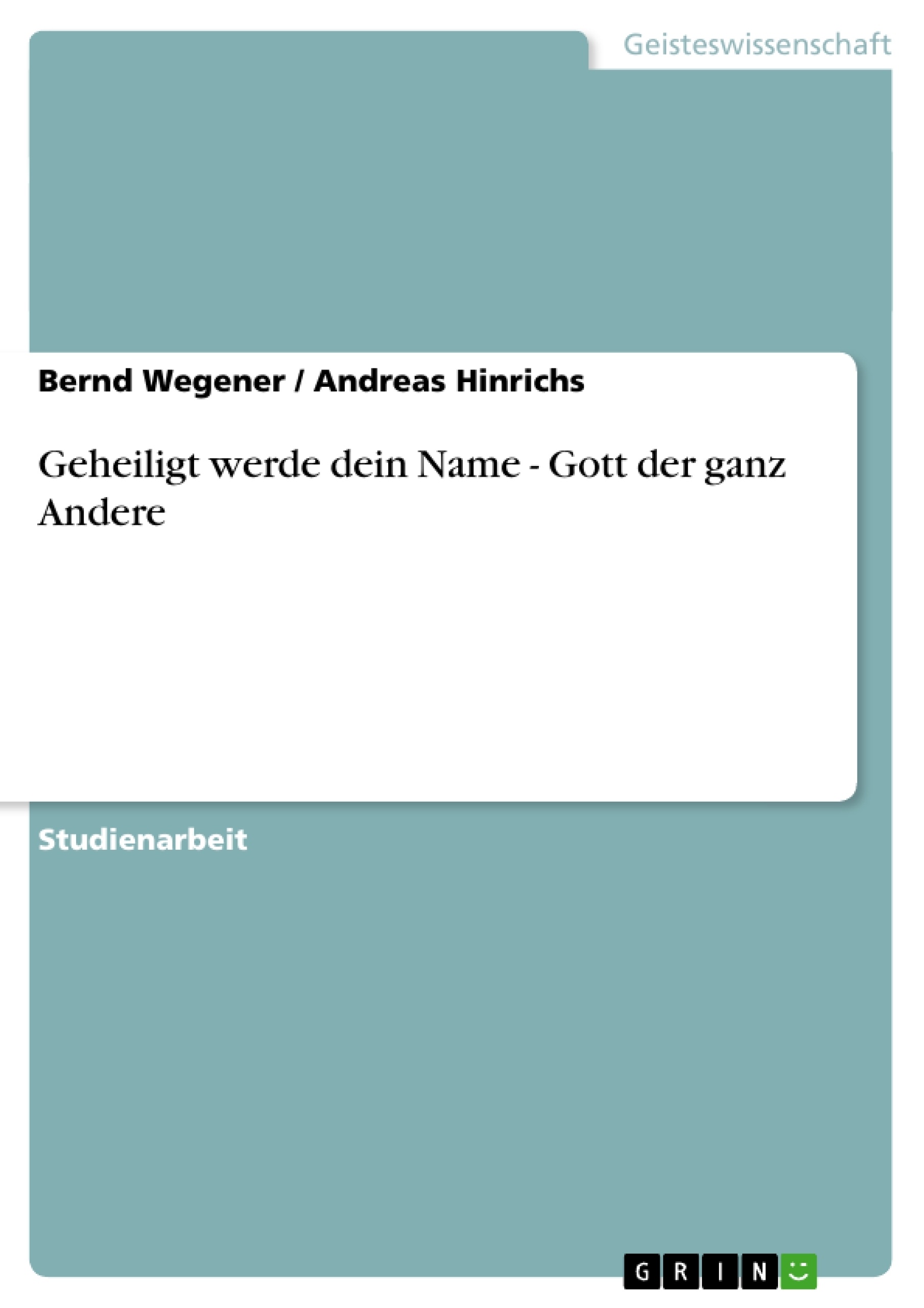„Gott der ganz Andere“ – diese Aussage bringt einen zeitlosen und somit stets aktuellen Konflikt mit sich. Jeder Mensch kennt Situationen aus dem Alltag, in denen wir uns von Gott verlassen fühlen oder nicht verstehen können, warum er bestimmte Dinge zulässt. In diesen Situationen hinterfragen wir Gott und hadern mit ihm. Auch in vielen Stellen des Alten und des Neuen Testamentes zeigt sich Gott als ein strafender Gott oder als ein Gott, der die Menschen leiden lässt. Selbst Jesus musste die Erfahrung mit Gott dem Anderen machen. Dies wird am Deutlichsten anhand der Passionsgeschichte. Hier lässt Gott selbst seinen eigenen Sohn Qualen erleiden und sterben. Eine Tatsache, die klar im Kontrast zum Bild vom gütigen und schützenden Gott steht.
Natürlich können wir, das sind mein Kommilitone und ich, in unserem Referat nicht die Gründe für Gottes Handeln aufführen, vielleicht aber trotzdem ein wenig Mut und Hoffnung vermitteln. Schließlich werden alle Menschen durch den qualvollen Tod Jesu am Kreuz erlöst und erfahren letztendlich doch einen barmherzigen Gott.
Die Aussage „Geheiligt werde dein Name“ ist bekanntermaßen der zweite Vers aus dem Vaterunser. Hierzu erläutern wir systematisch die Definitionen zu den Begriffen „Gott“ und „Heilig“ beziehungsweise „Heiligkeit“. Das Wort „Heilig“ ist schließlich häufig der erste Begriff, mit dem man Gott verbindet. Diese Ausführungen sollen jedoch keinen Schwerpunkt unserer Ausarbeitung bilden, sondern lediglich eine Einleitung in das Referatsthema sein und zunächst einmal einen Kontrast zu den folgenden Punkten darstellen.
So liegt der Hauptakzent unseres Vortrages auf der Aussage „Gott der ganz Andere“, also auf der Spannung zwischen Gott als dem gütigen Vater, der für uns da ist, wenn wir ihn brauchen und dem Gott, der uns leiden lässt. Um aufzuzeigen, dass Gott tatsächlich ein ganz Anderer sein kann, behandeln wir die Passionsgeschichte aus dem Markusevangelium, wo der Höhepunkt die verzweifelte und somit für uns Mensch so verständliche Klage des irdischen Jesus an Gott ist: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Diese Bibelstelle werden wir ausführlich unter exegetischen Gesichtspunkten untersuchen und analysieren.
Den Abschluss bildet unsere zusammenfassende Position zu dieser Thematik, die den Kern noch einmal anschaulich und präzise auf den Punkt bringen soll. Hier soll noch einmal klar werden, was die Hauptaussagen dieser breiten Thematik sind.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. „Gott der Heilige“ - systematische Erklärungen
2.1 Der Begriff „Gott“
2.2 Der Begriff „Heiligkeit“
3. Exegese zu Mk 15,34
3.1 Formanalyse
3.2 Einzelerklärungen zu den Versen
3.3 Synoptischer Vergleich und der Tod Jesu bei Johannes
3.3.1 Der Tod Jesu bei Matthäus.
3.3.2 Der Tod Jesu bei Lukas
3.3.3 Der Tod Jesu bei Johannes
3.4 Merksätze
4. Schlussgedanken
5. Quellenangaben
1. Einleitende Gedanken
(Andreas Hinrichs)
Wir haben uns für dieses einerseits schwierige und komplexe Referatsthema „Geheiligt werde dein Name – Gott der ganz Andere“ entschieden, weil es zugleich auch sehr interessant ist und uns die Möglichkeit gibt, Gott einmal aus einer anderen Perspektive zu untersuchen und zu beschreiben.
Gott wird oftmals aus einer zu einseitigen Perspektive gesehen. So versuchen wir, dass für den Menschen oftmals unverständliche Verhalten Gottes, das im Gegensatz zum häufig gebrauchten Bild vom barmherzigen Vater steht, aufzuzeigen.
„Gott der ganz Andere“ – diese Aussage bringt einen zeitlosen und somit stets aktuellen Konflikt mit sich. Jeder Mensch kennt Situationen aus dem Alltag, in denen wir uns von Gott verlassen fühlen oder nicht verstehen können, warum er bestimmte Dinge zulässt. In diesen Situationen hinterfragen wir Gott und hadern mit ihm. Auch in vielen Stellen des Alten und des Neuen Testamentes zeigt sich Gott als ein strafender Gott oder als ein Gott, der die Menschen leiden lässt. Selbst Jesus musste die Erfahrung mit Gott dem Anderen machen. Dies wird am Deutlichsten anhand der Passionsgeschichte. Hier lässt Gott selbst seinen eigenen Sohn Qualen erleiden und sterben. Eine Tatsache, die klar im Kontrast zum Bild vom gütigen und schützenden Gott steht.
Natürlich können wir in unserem Referat nicht die Gründe für Gottes Handeln aufführen, vielleicht aber trotzdem ein wenig Mut und Hoffnung vermitteln. Schließlich werden alle Menschen durch den qualvollen Tod Jesu am Kreuz erlöst und erfahren letztendlich doch einen barmherzigen Gott.
Die Aussage „Geheiligt werde dein Name“ ist bekanntermaßen der zweite Vers aus dem Vaterunser. Hierzu erläutern wir systematisch die Definitionen zu den Begriffen „Gott“ und „Heilig“ beziehungsweise „Heiligkeit“. Das Wort „Heilig“ ist schließlich häufig der erste Begriff, mit dem man Gott verbindet. Diese Ausführungen sollen jedoch keinen Schwerpunkt unserer Ausarbeitung bilden, sondern lediglich eine Einleitung in das Referatsthema sein und zunächst einmal einen Kontrast zu den folgenden Punkten darstellen.
So liegt der Hauptakzent unseres Vortrages auf der Aussage „Gott der ganz Andere“, also auf der Spannung zwischen Gott als dem gütigen Vater, der für uns da ist, wenn wir ihn brauchen und dem Gott, der uns leiden lässt. Um aufzuzeigen, dass Gott tatsächlich ein ganz Anderer sein kann, behandeln wir die Passionsgeschichte aus dem Markusevangelium, wo der Höhepunkt die verzweifelte und somit für uns Mensch so verständliche Klage des irdischen Jesus an Gott ist: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Diese Bibelstelle werden wir ausführlich unter exegetischen Gesichtspunkten untersuchen und analysieren.
Den Abschluss bildet unsere zusammenfassende Position zu dieser Thematik, die den Kern noch einmal anschaulich und präzise auf den Punkt bringen soll. Hier soll noch einmal klar werden, was die Hauptaussagen dieser breiten Thematik sind.
2. „Gott der Heilige“ – systematische Erklärungen
(Bernd Wegener & Andreas Hinrichs)
2.1 Der Begriff „Gott“
(Bernd Wegener)
Zu Beginn ist zu sagen, dass sich der Begriff „Gott“ nicht konkret definieren lässt. Der Begriff „Gott“ passt in kein Schema und besitzt keine eindeutige Beschreibung. Religionsgeschichtlich ist der Gottesbegriff immer an die jeweiligen individuellen sozialpsychologischen Gegebenheiten und gleichzeitig an die sozialen und wirtschaftlichen Faktoren der geschichtlichen Umwelt des religiösen Erkennenden gebunden, die unter einer analogen Verwendung unter diversen kultur-historischen Bedingungen stehen. Religionsgeschichtlich gesehen haben alle Religionen trotz ihrer häufig anzutreffenden großen Unterschiedlichkeiten „nahezu universal verbreitete ähnliche Vorstellungen und Verehrungen eines weltjenseitigen und übermenschlichen Höchsten Wesens. Seine Stellung zu anderen jenseitigen, diesseitigen oder mythischen Wesen und Gestalten spiegelt das Prinzip der Beziehung des Einen zu Vielen und gestattet eine Sonderung der Religionen auf Grund ihrer Gottesvorstellung“.[1]
Biblisch gesehen ist Gott im Alten und Neuen Testament derselbe. Das Alte Testament legt Zeugnis darüber ab, dass Gott sich geoffenbart hat. Dies geschah insbesondere bei den Patriarchaten und bei dem Volk Israel. Gott wird im Alten Testament als Jahwe – der „Ich bin der ich bin da“ bezeichnet.[2]
Im Neuen Testament wird der Gottesbegriff mit vielen Synonymen dargestellt. Hierzu zählen „der Berufene“, „der Himmel“, „die Erhabenheit“, „Gott“, „Vater“, „Herr“ oder „Heiland“. Zudem wird häufig eine Verbindung zum Gott des alten Bundes aus dem Alten Testament hergestellt, indem man vom „Gott Israels“, „Gott der Väter“ oder „Gott Abrahams“ spricht.
Häufig werden Gott zudem Adjektive, wie lebendig, friedvoll, wahr und treu zugesprochen.
Weitere Eigenschaften werden Gott im Neuen Testament zugeschrieben, indem gesagt wird, dass Gott die „Liebe“, „die Menschenfreundlichkeit“, „die Barmherzigkeit“ und „die Güte“ darstellt.[3]
Im theologischen und dogmengeschichtlichen Bereich ist Gott ein Wort der Anrede, bei dem man Hilfe und Halt sucht. Es bezeichnet ein „doxologisches Wort im Munde derer, denen seine Herrlichkeit aufgegangen ist “.[4]
Die Systematische Theologie beschreibt das Wort „Gott“ als eine metaphysische Redensweise, die den letzten Grund aller Wirklichkeit bezeichnet. Gott ist derart vollkommen, dass seine Vollkommenheit jegliche irdische Vollkommenheit übersteigt.[5]
2.2 Der Begriff „Heiligkeit“
(Andreas Hinrichs)
Ebenso wie der Begriff „Gott“, lässt sich auch „Heiligkeit“ oder „Heilig“ nicht konkret definieren. Allgemein wird mit „Heilig“ im Sprachgebrauch ein religiöser Begriff bezeichnet, der mit der Bedeutung bedacht wird, zu einer göttlichen Sphäre zu gehören oder einer Gottheit geweiht zu sein. Ursprünglich stammt „Heilig“ von dem Begriff „Heil“ ab, der eine besondere Gabe bezeichnet.
In der Welt der Religionen bedeutet das Heilige zunächst etwas Unverfügbares, das dem direkten Zugriff des menschlichen Handelns entzogen ist. Der Mensch erfährt dessen Wirkung in seinem Sein und seinem Handeln völlig abhängig und nimmt es als eine sich übersinnlich bewegende Kraft wahr.
Häufig wird für „Heilig“ auch das gleichbedeutende Fremdwort „sakral“ verwendet, das im Gegensatz zum Begriff „profan“ steht, mit dem weltliche Dinge bezeichnet werden. Sowohl in der neueren religionswissenschaftlichen, als auch in der philosophischen Forschung gilt das Heilige als Deutungs- und als Bewertungsbegriff, mit dem religiöse und profane Gegebenheiten voneinander unterschieden werden können. Es gibt kaum eine Möglichkeit, den Begriff genauer zu bestimmen oder ihn adäquater wiederzugeben. „Es kann sich in Form übersinnlich jenseitiger Vernünftigkeit als immaterielles Sein zu verstehen und zu denken geben. Örtlichkeiten (Plätze, Altäre), Personen, Völker und ihre Handlungen oder erhebende Ereignisse (Feste, Eidesformeln, Riten und vieles mehr), Existenzformen aller Art können fortwährend oder vorübergehend als Eigentum beziehungsweise machtvolle Einflusssphäre und Durchbruchsort eines bewegenden Göttlichen (Numen) in dieser Welt konstituiert und erfahren werden“[6]
Das Heilige hat sich mit seiner überwältigenden und unberechenbaren Wirkung schon in frühester Menschheit in wohltätigen, aber auch oftmals in abschreckenden Einrichtungen manifestiert. Aufgrund der Erhabenheit und der Gefährlichkeit, begegnet man Dingen oder Personen, die als heilig angesehen werden, mit einem ehrfürchtigen Verhalten.
Die neuere religionswissenschaftliche und philosophische Forschung sieht das Heilige als Deutungs- und Bewertungsbegriff, mit dem religiöse Gegebenheiten auch prinzipiell unterschieden werden können. So können historisch bedingte religiöse Modi des Heiligen aus ihrer Unbestimmtheit gelöst und in den letztgültigen Bezug eingefügt werden.[7]
Die Bildung des theologischen Begriffs der Heiligkeit geht auf die die historische Erfahrung der Personenwirklichkeit Jesu zurück. Hier ist das Heilige ein Synonym für die Göttlichkeit Gottes, für seine unantastbare Macht und seine Schöpfung. Allerdings ermöglicht Gott den Menschen einen Anteil an seinem eigenen heiligen dreifaltigen Lebensvollzug. Ziel der Heiligung der Menschen ist die „unmittelbare Schau Gottes von Angesicht zu Angesicht“.[8] Der Mensch kann jedoch nicht durch Einbezug in den diesseitigen sakralen Bereich naturhaft heilig werden. Dennoch gehört er auch nicht bloß einem profanen Bereich an, da er durch sein Personensein in Gottebenbildlichkeit, auf den heiligen Gott bezogen ist. So können auch die Menschen in ihrer würde als Person „heilig“ genannt werden. Durch das Prinzip der geschenkten Heiligkeit und der sich somit mitteilenden Gerechtigkeit Gottes, werden die Menschen in sich selbst Gerecht und heilig.[9] Die Grundhaltung des Menschen, die der Heiligkeit entspringt, ist die Ehrfurcht. Hier wird das Heilige als das „uneinholbar Frühere und Andere, zugleich den Menschen in seinem Eigensten und Innersten Betreffende“[10] wahrgenommen. Aus christlicher Sicht ist die Begegnung mit dem Heiligen eine Begegnung mit dem dreifaltigen Gott. Auch das II. Vatikanische Konzil betont die Berufung aller Christen zur Heiligkeit. Dies ist zugleich Gabe und Aufgabe. Jedoch darf niemals vergessen werden, dass Gott alleine Urheber und Vollender der Heiligkeit ist. Auch ist die Verwirklichung der christlichen Heiligkeit stets in der von Christus geheiligten Kirche zu finden, in der sie sich entfalten kann. So ist abschließend festzuhalten, dass durch diese gegenseitige Heiligung eine humane Lebensweise aller Menschen untereinander gefördert wird.[11]
[...]
[1] Siehe Paus, Ansgar, Gott, Religionsgeschichtlich, in: Kasper, Walter (Hrsg.), LThK, 852-853.
[2] Vgl. Schreiner, Josef, Gott, Biblisch, in: Kasper, Walter (Hrsg.), LThK, 856.
[3] Vgl. Schlosser, Jaques, Gott, Biblisch, in: Kasper, Walter (Hrsg.), LThK, 859-860
[4] Siehe Werbick, Jürgen, Gott, Theologie- und dogmengeschichtlich, in: Kasper, Walter (Hrsg.), LThK, 863.
[5] Werbick, Jürgen, Gott, Systematisch-theologisch, in: Kasper, Walter (Hrsg.), LThK, 866.
[6] Siehe Paus, Ansgar, Heilig, das Heilige, Religionsgeschichtlich, in: Kasper, Walter (Hrsg.), LThK, 1267.
[7] Vgl. Paus, Ansgar, Heilig, das Heilige, Religionsgeschichtlich, in: Kasper, Walter (Hrsg.), LThK, 1267-1268.
[8] Siehe Müller, Gerhard, Heilig, das Heilige, Systematisch-theologisch, in: Kasper, Walter (Hrsg.),
LThK, 1273.
[9] Siehe Müller, Gerhard Heilig, das Heilige, Ludwig, Systematisch-theologisch, in: Kasper, Walter (Hrsg.), LThK, 1273-1274.
[10] Siehe Marschütz, Gerhard, Heilig, das Heilige, Spirituell, in: Kasper, Walter (Hrsg.), LThK, 1274.
[11] Vgl. Marschütz, Gerhard, Heilig, das Heilige, Spirituell, in: Kasper, Walter (Hrsg.), LThK, 1274.