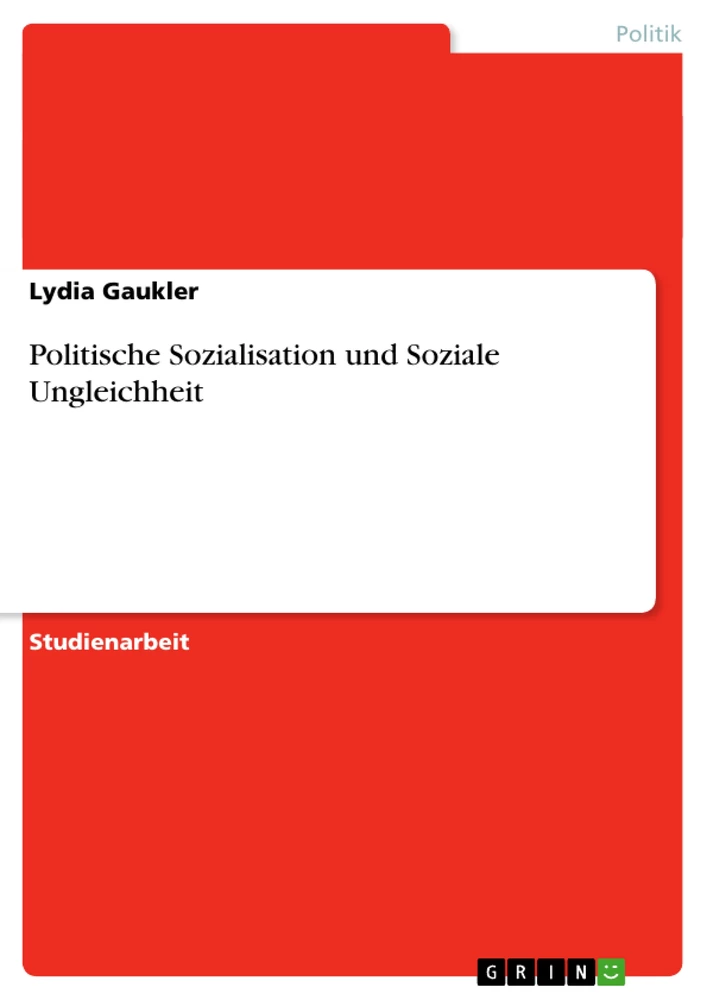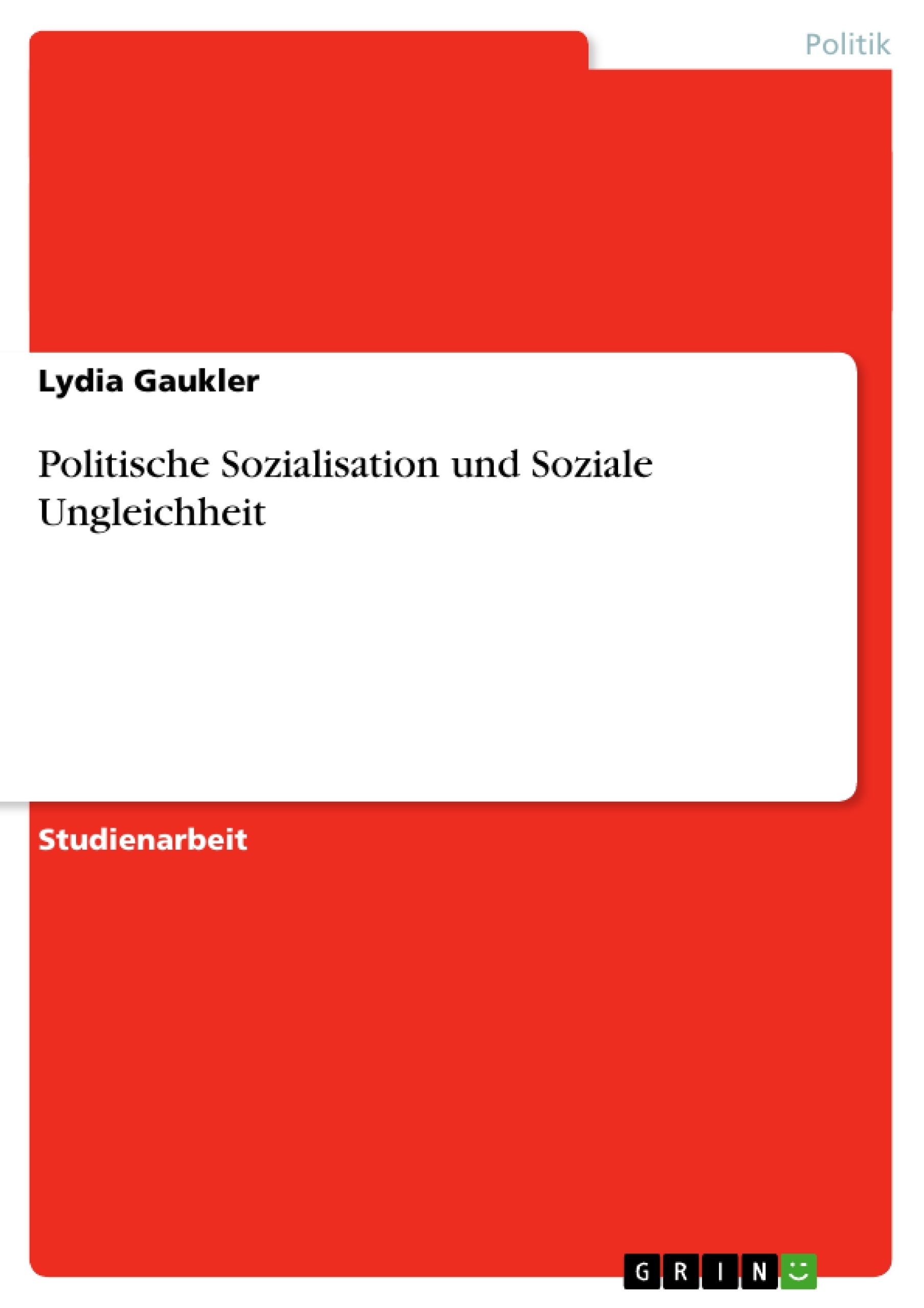Vor dem deutschen Gesetz sind Frauen und Männern gleichgestellt. Doch wie sieht es mit der Gleichstellung von Frauen und Männern in sozialer Hinsicht im Allgemeinen und in politischer Hinsicht im Besonderen aus? Dieser Frage widmet sich die folgende Arbeit. Im Mittelpunkt der Betrachtungen steht dabei die Bedeutung der Geschlechteridentität für die politische Sozialisation. Nach einer Begriffsdefinition und einem Überblick über die wichtigsten empirischen Befunde zur geschlechtsspezifischen politischen Partizipation geht es im vierten Abschnitt um einzelne Einflussfaktoren. Im fünften Abschnitt sollen dann Zusammenhänge der einzelnen Einflussfaktoren analysiert und erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretischer Hintergrund
2.1. Der Begriff der Sozialisation
2.2. Der Begriff der Politischen Sozialisation
2.3. Der Begriff der Sozialen Ungleichheit
3. Empirische Befunde zum Zusammenhang von Partizipation und Geschlecht
3.1. Geschlechterdifferenz und konventionelle Partizipationsformen
3.2. Geschlechterdifferenz und unkonventionelle Partizipationsformen
3.2.1. Frauen in der Politik
3.3. Zwischenfazit
4. Einflussfaktoren der geschlechtsspezifischen politischen Sozialisation
4.1. Geschlechtsspezifische Sozialisation in Kindheit und Jugend
4.1.1. Einflussfaktor Familie
4.1.2. Einflussfaktor tradierte Ideologien
4.1.3. Zum Zusammenhang der Einzelfaktoren I
4.2. Geschlechtsspezifische Sozialisation im Erwachsenenalter
4.2.1. Einflussfaktor Arbeit
4.2.2. Einflussfaktor Bildung
4.2.3. Einflussfaktor Einkommen
5. Zum Zusammenhang der Einzelfaktoren II
6. Fazit
Literaturverzeichnis
Ehrenwörtliche Erklärung
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Mitgliedschaft in einer politischen Partei
Abbildung 2: Mitgliedschaft in politischen Organisationen
Abbildung 3: Teilnahme an politischen Aktionen
Abbildung 4: Politische Diskussionen Zuhause
Abbildung 5: Politische Aktivität der Mutter
Abbildung 6: Politische Aktivität des Vaters
Abbildung 7: Die Geschlechtsrollenorientierung westdeutscher Jugendlicher
Abbildung 8: Gesellschaftliche Rolle von Frauen und Männern
Abbildung 9: Erwerbstätigkeit nach Geschlecht
Abbildung 10: Politische Teilhabe nach Beruflicher Stellung
Abbildung 11: Politische Teilhabe nach Bildungsstatus
Abbildung 12: Bildungschancen nach Geschlecht und sozialer Herkunft
Abbildung 13: Politische Teilhabe nach Einkommenslage
Abbildung 14: Das meritokratische Prinzip
Vor dem deutschen Gesetz sind Frauen und Männern gleichgestellt. Doch wie sieht es mit der Gleichstellung von Frauen und Männern in sozialer Hinsicht im Allgemeinen und in politischer Hinsicht im Besonderen aus? Dieser Frage widmet sich die folgende Arbeit. Im Mittelpunkt der Betrachtungen steht dabei die Bedeutung der Geschlechteridentität für die politische Sozialisation. Nach einer Begriffsdefinition und einem Überblick über die wichtigsten empirischen Befunde zur geschlechtsspezifischen politischen Partizipation geht es im vierten Abschnitt um einzelne Einflussfaktoren. Im fünften Abschnitt sollen dann Zusammenhänge der einzelnen Einflussfaktoren analysiert und erläutert werden.
1. Einleitung
In Artikel 20 des Grundgesetzes heißt es:
„Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.“[1]
Deutschland ist dem Gesetz nach eine Demokratie. Dies bedeutet, dass die Bürgerinnen und Bürger die Politik sowie ihre politischen und gesellschaftlichen Lebensverhältnisse selbst gestalten; allerdings nicht unmittelbar, sondern mittelbar, in Form von regelmäßigen Wahlen. Durch diese Wahlen werden die Regierung und ihre politischen Entscheidungsträger legitimiert.[2] Neben den periodischen Wahlentscheidungen gibt es zudem ein breites Angebot an weiteren politischen wie auch gesellschaftlichen Partizipationsformen. Diese ermöglichen es grundsätzlich jedem Deutschen, politisch aktiv zu werden und auf diese Weise sein politisches oder gesellschaftliches Umfeld zu gestalten. Das Ausmaß politischer oder gesellschaftlicher Beteiligung lässt Rückschlüsse auf die Lebendigkeit der Demokratie zu:[3] Je höher das Engagement, umso lebendiger ist das demokratische System, da es auf das Volk als Staatsgewalt angewiesen ist.
Die Möglichkeiten einzelner Gruppen, sich politisch oder sozial zu engagieren, können jedoch ungleich verteilt sein. Zwar sind laut Gesetz alle Bürger gleich, doch die Praxis sieht leider anders aus: So belegen empirische Untersuchungen, dass v.a. Bildungsniveau, sozioökonomische Herkunft und Geschlecht von zentraler Bedeutung für das Ausmaß der politischen Partizipation sind.
Folgende Arbeit konzentriert sich auf das Geschlechterverhältnis als eine elementare Form sozialer Ungleichheit. Dabei werden jedoch auch die Faktoren Bildung und Einkommen berücksichtigt werden. Ziel ist es, die Auswirkungen des Geschlechts bzw. der geschlechtsbedingten Ungleichheit auf die geschlechtsspezifische politische Sozialisation aufzuzeigen.
2. Theoretischer Hintergrund
2.1. Der Begriff der Sozialisation
„Sozialisation ist der ‚Prozess der Entstehung und Entwicklung der Persönlichkeit in wechselseitiger Abhängigkeit von der gesellschaftlich vermittelten sozialen und materiellen Umwelt’. Im Zentrum dieses Prozesses steht das Mitglied-Werden in einer Gesellschaft.“[4]
Ergänzend und präzisierend dazu definiert Hurrelmann Sozialisation als einen Prozess der Persönlichkeitsentstehung „in Abhängigkeit von und in Auseinandersetzung mit den sozialen und den dinglich-materiellen Lebensbedingungen [...], die zu einem bestimmten Zeitpunkt der historischen Entwicklung einer Gesellschaft existieren [und] in dessen Verlauf sich der mit einer biologischen Ausstattung versehene menschliche Organismus zu einer sozial handlungsfähigen Persönlichkeit bildet.“[5]
Hillmann verweist auf den Doppelaspekt der Sozialisation: Sie ist „zugleich ‚Vergesellschaftung’ des Menschen im Sinne der Übernahme und Internalisierung von soziokulturellen Werten, Verhaltenserwartungen und sozialen Rollen als auch Personalisation im Sinne von ‚Besonderung’ seiner individuell bestimmten Auseinandersetzung mit den Angeboten und Einflüssen seiner Gesellschaft.“[6]
Sozialisation bezeichnet also jenen Prozess, in dessen Folge das Individuum zu einem vollwertigen Teil der Gesellschaft wird, wobei es sich dabei einerseits an seine Umwelt und Kultur anpasst, indem es die allgemein in der Gesellschaft akzeptierten Meinungen, Rollen und Symbole verinnerlicht, gleichzeitig jedoch durch die Interaktion mit der Umwelt eine eigene und eigenständige Persönlichkeit entwickelt.
2.2. Der Begriff der Politischen Sozialisation
Die Politische Sozialisation ist eine spezielle Form der Sozialisation, welche sich auf „jenen Aspekt der Sozialisation [beschränkt], der sich auf das Hineinwachsen der zu soziokulturellen Persönlichkeiten heranreifenden Individuen in die politische Kultur ihrer Gesellschaft und sozialen Umwelt bezieht.“[7]
Politische Sozialisation bezeichnet genauer „die Gesamtheit der Prozesse, durch die Kenntnisse, Überzeugungen, Gefühlshaltungen, Werte, Normen und Symbole, die das politische Handeln regeln, dem Individuum vermittelt und von diesem internalisiert und übernommen werden.“[8]
Ergebnis und zugleich Ziel der politischen Sozialisation ist obigen Definitionen zufolge die Entwicklung einer „politisch handlungsfähigen Persönlichkeit“[9]. Das dabei entstehende politische Bewusstsein äußert sich in einem Komplex von Einstellungen und Gefühlen des Individuums gegenüber dem politischen System, seinen Politikern und Institutionen, die langfristige und verinnerlichte Bestandteile der Persönlichkeit werden.
2.3. Der Begriff der Sozialen Ungleichheit
„Unter sozialer Ungleichheit versteht man die asymmetrische Verteilung knapper und begehrter Güter auf gesellschaftliche Positionen und so entstehende vorteilhafte bzw. nachteilige Lebensbedingungen von Menschen.“[10]
Nach Kreckel ist soziale Ungleichheit die nicht intendierte Folge intentionalen menschlichen Handelns und als solche eine von Menschen veränderbare Grundtatsache gesellschaftlichen Lebens.[11] Er weist darauf hin, dass soziale Ungleichheit dabei sowohl von bloßer physischer Unterschiedlichkeit[12] als auch von sozialer Differenzierung[13] abzugrenzen ist: Obwohl zu ihrer ideologischen Rechtfertigung die physische Unterschiedlichkeit häufig herangezogen wird, zielt soziale Ungleichheit nicht auf die Verschiedenartigkeit biologischer Grundausstattungen ab, sondern meint vielmehr die gesellschaftlich verankerten Formen der Bevorrechtigung einiger und der Diskriminierung anderer. Ferner führen sozial verankerte Unterschiedlichkeiten nicht zwangsläufig zu einer Begünstigung oder Benachteiligung; eine soziale Differenzierung auf egalitärer Basis ist durchaus möglich.
Soziale Ungleichheit liegt demnach überall dort vor, „wo die Möglichkeit des Zugangs zu allgemein verfügbaren und erstrebenswerten sozialen Gütern und/oder sozialen Positionen, die mit ungleichen Macht- und/oder Interaktionsmöglichkeiten ausgestattet sind, dauerhafte Einschränkungen erfahren und dadurch die Lebenschancen der betroffenen Individuen, Gruppen oder Gesellschaften beeinträchtigt bzw. begünstigt werden.“[14]
3. Empirische Befunde zum Zusammenhang von Partizipation und Geschlecht
Leider gibt es zum Zusammenhang von politischer Partizipation und Geschlecht bisher nur sehr wenige empirische Studien. Treffend stellt Dennis in seiner Schrift ‚Problems of Political Research’ fest:
„There are many differences among various strata or groupings which have apparent political consequence; but only a few, including sex and social class, have been given attention in the published work on political socialization.“[15]
Auch Kulke kritisiert das Forschungsdefizit:
„Obgleich es heute als unbestritten gilt, dass das Geschlechterverhältnis ein Indikator für politische Diskriminierungsprozesse [...] ist, hat die Untersuchung von Geschlechterdifferenzen und Geschlechterrollenstereotypen offensichtlich in der für Politische Sozialisation relevanten [...] Forschung noch immer kaum Berücksichtigung gefunden. [...] Anscheinend wurde [...] die Geschlechterdimension zumeist schlicht ‚vergessen’ oder - genauer gesagt - es wird stillschweigend auch hier von einem ‚Normalfall’ Politischer Sozialisation ausgegangen, in dem das Männliche als Norm steht.“[16]
Trotz dieser Umstände gibt es einige Indikatoren, welchen den Zusammenhang der Geschlechteridentität und der politischen Partizipation belegen. Diese sollen im Folgenden vorgestellt werden.
3.1. Geschlechterdifferenz und konventionelle Partizipationsformen
Als ein erster Indikator der geschlechtsspezifisch-ungleichen Partizipation kann die Wahlbeteiligung der Bürgerinnen und Bürger zum 16. Bundestag 2005 herangezogen werden. Laut einer vom statistischen Bundesamt durchgeführten repräsentativen Wahlstatistik lag die Wahlbeteiligung der Frauen bei 77,4% und damit um 0,5 Prozentpunkte niedriger als die der Männer. Dabei ist jedoch festzustellen, dass sich die Differenz zwischen der Wahlbeteiligung der beiden Geschlechter zunehmend verringert. So geht aus Untersuchungen des Statistischen Bundesamtes hervor, dass die Wahlbeteiligung der Frauen bei den Bundestagswahlen 1957 insgesamt um 3,3 Prozentpunkte unter derjenigen der Männer lag - bei den folgenden Wahlen verringerte sich der Unterschied auf 0,8 Prozentpunkte im Jahr 1976.[17] Wie Abbildung 1 zeigt, ist außerdem nicht nur das Geschlecht, sondern auch das Alter entscheidend: Bei den 21 bis 60 Jährigen liegt der Frauenanteil an Stimmen sogar über jenem der Männer.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Mitgliedschaft in einer politischen Partei
Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf den Daten des Statistischen Bundesamtes (2004)
Wahlen sind jedoch nicht die einzige Form möglicher politischer Beteiligung. Aufgrund ihrer relativen Seltenheit und starken Standardisierung spiegeln Wahlen nur sehr eingeschränkt die tatsächliche politische Partizipation der Bürger und Bürgerinnen wider.[18] Als Datengrundlage für ein detaillierteres Bild der politischen Partizipation können Bevölkerungsbefragungen wie die „Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS)“ herangezogen werden.
Wie sich an Abbildung 2 erkennen lässt, engagieren sich Frauen im Durchschnitt weitaus seltener in Parteien und Gewerkschaften. Insofern scheint die Auffassung, dass sich Frauen weniger häufig an der Politik beteiligen, bestätigt. Allerdings ist die weibliche Mitwirkung in nicht-politischen Vereinen, wie beispielsweise in Umweltschutzorganisationen, mindestens ebenso hoch wie männliche. Eine denkbare Erklärung wäre meiner Meinung nach die Tatsache, dass Männer auch heute noch weitaus häufiger berufstätig sind. Möglicherweise treten sie daher eher Gewerkschaften oder Parteien bei, um ihre Interessen zu vertreten, während nicht-berufstätige Frauen dies als nicht notwendig erachten.
Frauen sind demnach ebenso politisch interessiert, sie artikulieren ihr Interesse nur auf andere Weise.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Mitgliedschaft in politischen Organisationen
Quelle: Darstellung nach Engels (2004, S. 10)
3.2. Geschlechterdifferenz und unkonventionelle Partizipationsformen
Diese These wird unterstützt, sobald man neben den konventionellen auch die unkonventionellen Partizipationsmöglichkeiten berücksichtigt. Wie in Abbildung 3 ersichtlich, ist die Differenz zwischen weiblicher und männlicher Partizipation weitaus geringer bei unkonventionellen politischen Aktionen.
Sowohl Frauen als auch Männer kommen ihren staatsbürgerlichen Pflichten demnach in ähnlicher Weise wahr: Sowohl bei Wahlen als auch bei unkonventionellen Formen der Beteiligung gibt es nur geringe Unterschiede. Allerdings gibt es eine große Diskrepanz bei der partei- und gewerkschaftsorientierten Partizipation: Hier sind Männer überdurchschnittlich stark vertreten.
Die Tatsache, dass Frauen in den sozialen Bewegungen (z.B. Umwelt- oder Friedensbewegungen) eine mindestens gleich hohe Bereitschaft zum Mitwirken aufweisen wie Männer legt die These nahe, dass sich Frauen von der männerdominierten Parteien- und Gewerkschaftslandschaft weniger angesprochen fühlen. Häufig wird gemutmaßt, dass die neuen sozialen Bewegungen für Frauen attraktiver seien als politischen Institutionen, da Frauen sich in persönlichen und informellen Organisationen wohler fühlen würden.[19] Meiner Auffassung nach ist dies nur ein möglicher Erklärungsgrund für den hohen Frauenanteil in nicht-politischen Organisationen. Eine sehr viel näher liegende Ursache könnten die von Geißel und Penrose angenommenen Diskriminierungserfahrungen in Parteien und Gewerkschaften liegen.[20] Da empirische Studien hierüber jedoch weitgehend fehlen, kann an dieser Stelle keine endgültige Klärung der unterschiedlichen geschlechtsspezifischen Partizipation erfolgen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Teilnahme an politischen Aktionen
Quelle: Darstellung nach Engels (2004, S. 11)
3.2.1. Frauen in der Politik
Der Frauenanteil im neu gewählten 16. Bundestag liegt laut dem baden-württembergischen Landesamt für Statistik bei 31,5 Prozent.[21] Somit sind die Frauen auch weiterhin stark unterrepräsentiert. Kulke stellt fest, dass weder gesetzliche Regelungen wie das Antidiskriminierungsgesetz oder die Quotierungsbeschlüsse der Parteien, noch der Einsatz von Frauenbeauftragen oder Frauenförderungsplänen die Ausgrenzung von Frauen aus der Politik wesentlich verringert hätten. Der politische Machtdiskurs werde nach wie vor von Männern bestimmt und frauenspezifische Interessen und Forderungen daher kaum berücksichtigt.[22] So kommt Kulke zu dem vernichtenden Ergebnis, dass „die patriarchalische Herrschaft [...] nicht allein die Frauen [...] sondern die gesamte Menschheit“[23] bedrohe.
[...]
[1] Grundgesetz (1999): S. 22
[2] Vgl. Engels (2004): S. 1
[3] Vgl. Engels (2004): S. 2
[4] Strohmeier (2005): S. 7
[5] Vgl. Hurrelmann (1998): S. 15
[6] Hillmann (1994): S. 805
[7] Hillmann (1994): S. 675
[8] Reinhold (2000): S. 604
[9] Strohmeier (2005), S. 7-8
[10] Reinhold (2000): S. 589 f.
[11] vgl. Kreckel (1992): S. 15 ff.
[12] Physisch bedingte Verschiedenheit bezieht sich u.a. auf Merkmale wie Geschlecht, Alter oder Rassenzugehörigkeit
[13] Soziale Differenzierung ergibt sich etwa aus der beruflichen Arbeitsteilung oder aus kulturellen, religiösen, nationalen und alters- oder geschlechtsspezifischen Besonderheiten
[14] Kreckel (1992): S. 17
[15] Dennis (1991): S. 105
[16] Kulke (1998): S. 597
[17] Statistisches Bundesamt (2004): Datenreport, S. 171
[18] Vgl. Engels (2004): S. 7
[19] Vgl. Geißel und Penrose (2003): S.12
[20] Vgl. Geißel und Penrose (2003): S.12
[21] Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2005)
[22] Vgl. Kulke (1998): S. 596
[23] Kulke (1998): S. 596