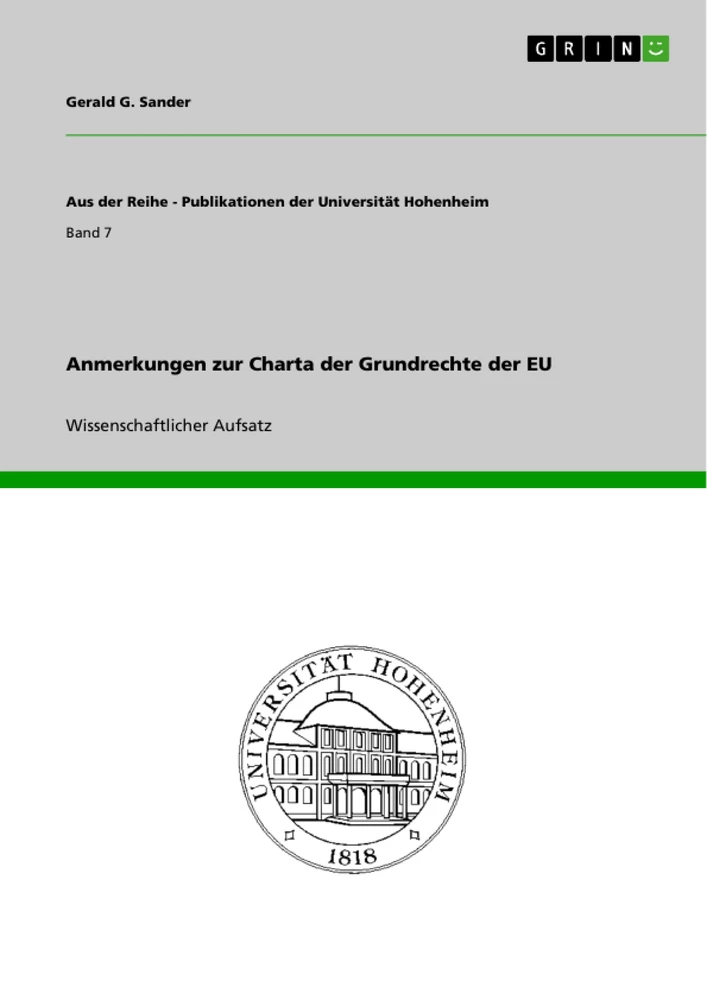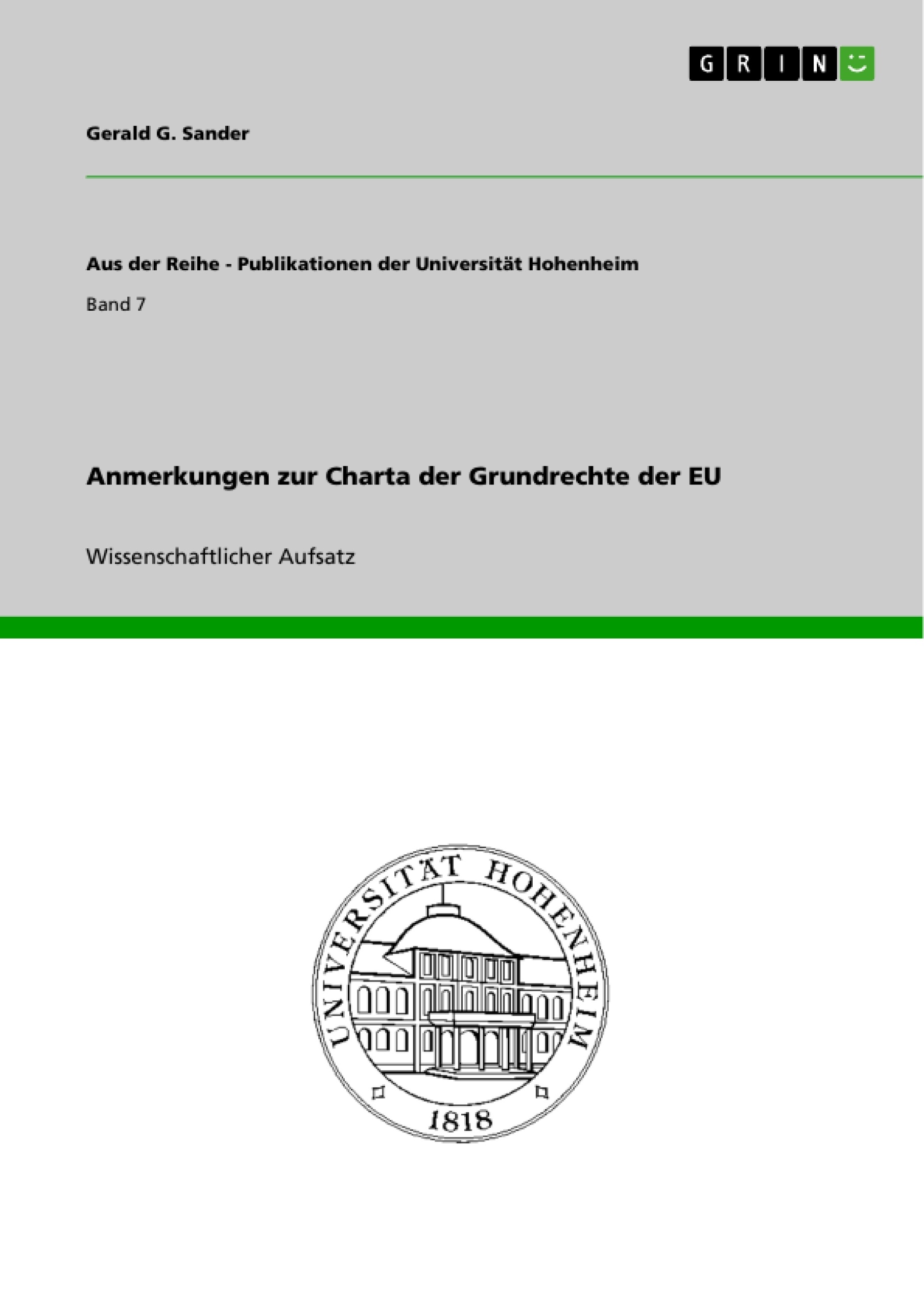Der Europäische Rat hatte auf seiner Tagung am 4./5. Juni 1999 in Köln die Erarbeitung einer
Charta der Grundrechte für notwendig erachtet, um diese Rechte für die Unionsbürger sichtbarer
zu gestalten.1 Er wies in diesem Zusammenhang außerdem darauf hin, dass die Charta
die Freiheits- und Gleichheitsrechte sowie die Verfahrensgrundrechte umfassen soll, wie sie
in der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
(EMRK) gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen
der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts ergeben. Die
Charta sollte nach Auffassung des Europäischen Rates ferner jene Grundrechte enthalten, die
lediglich den Unionsbürgern zustehen. Bei der Ausarbeitung der Charta seien zudem wirtschaftliche
und soziale Rechte zu berücksichtigen, wie sie in der Europäischen Sozialcharta
und in der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer enthalten sind
(Art. 136 EGV), soweit sie nicht nur Ziele für das Handeln der Union begründen.
Der Europäische Rat setzte am 16. Oktober 1999 ein Gremium aus 62 Mitgliedern ein,
das sich auf seiner konstituierenden Sitzung am 17. Dezember 1999 den Namen „Konvent“
gab, und aus Vertretern verschiedener Legitimationsquellen bestand: ein Mitglied der Kommission,
15 persönliche Beauftragte der Staats- und Regierungschefs, 16 Mitglieder des Europäischen
Parlaments und 30 Mitglieder der nationalen Parlamente. Es sollte innerhalb eines
Jahres einen Entwurf der Charta ausarbeiten. Den Vorsitz übernahm der ehemalige deutsche
Bundespräsident Roman Herzog.
Am 28. September 2000 legte der Konvent seinen Entwurf vor, der vom Europäischen
Rat während des Sondergipfels in Biarritz am 13./14. Oktober 2000 grundsätzlich begrüßt
wurde. Schließlich wurde die Charta der Grundrechte der Europäischen Union am
8. Dezember 2000 von den drei Organen der EU, das heißt dem Europäischen Parlament, dem
Rat und der Kommission, anlässlich des Europäischen Rates in Nizza feierlich proklamiert. [...]
Inhalt
A. Die Entstehung der Grundrechtscharta
B. Die Anerkennung von Grundrechten durch den EuGH
C. Gründe für die Schaffung der Grundrechtscharta
D. Der Inhalt der Charta
E. Grundrechtsträger und Grundrechtsverpflichtete
I. Grundrechtsträger
II. Grundrechtsverpflichtete
F. Zum Status der Charta
G. Das Verhältnis der Charta zur EMRK
H. Kritische Bemerkungen zur Charta
I. Die Charta als Teil einer künftigen Verfassung?
J. Schlusswort
A. Die Entstehung der Grundrechtscharta
Der Europäische Rat hatte auf seiner Tagung am 4./5. Juni 1999 in Köln die Erarbeitung einer Charta der Grundrechte für notwendig erachtet, um diese Rechte für die Unionsbürger sichtbarer zu gestalten.[1] Er wies in diesem Zusammenhang außerdem darauf hin, dass die Charta die Freiheits- und Gleichheitsrechte sowie die Verfahrensgrundrechte umfassen soll, wie sie in der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts ergeben. Die Charta sollte nach Auffassung des Europäischen Rates ferner jene Grundrechte enthalten, die lediglich den Unionsbürgern zustehen. Bei der Ausarbeitung der Charta seien zudem wirtschaftliche und soziale Rechte zu berücksichtigen, wie sie in der Europäischen Sozialcharta und in der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer enthalten sind (Art. 136 EGV), soweit sie nicht nur Ziele für das Handeln der Union begründen.
Der Europäische Rat setzte am 16. Oktober 1999 ein Gremium aus 62 Mitgliedern ein, das sich auf seiner konstituierenden Sitzung am 17. Dezember 1999 den Namen „Konvent“ gab, und aus Vertretern verschiedener Legitimationsquellen bestand: ein Mitglied der Kommission, 15 persönliche Beauftragte der Staats- und Regierungschefs, 16 Mitglieder des Europäischen Parlaments und 30 Mitglieder der nationalen Parlamente. Es sollte innerhalb eines Jahres einen Entwurf der Charta ausarbeiten. Den Vorsitz übernahm der ehemalige deutsche Bundespräsident Roman Herzog.
Am 28. September 2000 legte der Konvent seinen Entwurf vor, der vom Europäischen Rat während des Sondergipfels in Biarritz am 13./14. Oktober 2000 grundsätzlich begrüßt wurde. Schließlich wurde die Charta der Grundrechte der Europäischen Union am 8. Dezember 2000 von den drei Organen der EU, das heißt dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission, anlässlich des Europäischen Rates in Nizza feierlich proklamiert.
B. Die Anerkennung von Grundrechten durch den EuGH
Die Aufforderung des Europäischen Rates, die EMRK und die Verfassungen der Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung der einzelnen Grundrechte der Charta heranzuziehen, stützt sich auf die Formulierung in Art. 6 Abs. 2 EUV. Mit dieser Vorschrift wurde die Art der Herleitung der Grundrechte durch die Rechtsprechung des EuGH ausdrücklich anerkannt. Der Anwendungsvorrang des EG-Rechts verhindert nämlich, dass die europäische Rechtsmaterie an nationalen Grundrechten gemessen werden kann.[2] Der EG-Vertrag kennt zudem nur wenige Grundrechtspositionen, wie die Nichtdiskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit in Art. 12 EGV und die persönlichen Grundfreiheiten des Binnenmarktes.
Der EuGH sah sich deshalb veranlasst, einen eigenständigen europäischen Grundrechtsschutz richterrechtlich zu entwickeln. Hierfür bediente er sich ausdrücklich der EMRK und den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten. In der Rechtssache „Stauder“[3] aus dem Jahr 1969 formulierte er zum ersten Mal ein Grundrecht als allgemeinen Rechtsgrundsatz des Gemeinschaftsrechts. Im genannten Fall ging es um die Geheimhaltung persönlicher Daten. Seitdem hat der EuGH eine ganze Reihe weiterer Grundrechte, wie z.B. die Eigentums-, Berufs- und Vereinigungsfreiheit, den Schutz der Wohnung und der Familie oder das Gebot rechtlichen Gehörs und effektiven Rechtsschutzes, anerkannt.[4] Die Herleitung kann der EuGH jedoch nur fallbezogen vornehmen. Damit mangelt es aber an einer Grundrechtssystematik auf europäischer Ebene,[5] die durch eine Charta der Grundrechte nunmehr erreicht werden kann.
C. Gründe für die Schaffung der Grundrechtscharta
Verschiedene Gründe sprechen für die Ausarbeitung einer Grundrechtscharta. Zunächst dient sie der Stärkung des Schutzes der individuellen und kollektiven Grundrechte angesichts der wachsenden Hoheitsgewalt der EU-Organe gegenüber den Bürgern. Für die Legitimierung dieser Unionsgewalt ist die Verpflichtung zur Beachtung von Grundrechten notwendige Voraussetzung.[6] Weil sich die öffentliche Gewalt zunehmend von den Mitgliedstaaten auf die EU verlagert, ist es wichtig, dass auf europäischer Ebene Individualrechte nicht nur durch die Rechtssprechung des EuGH gesichert werden, sondern auch in einer Grundrechtscharta verdeutlicht werden.
Die Charta soll für die Bürger sichtbarer machen, dass Europa ihre Rechte sowohl garantiert als auch schützt und damit eine Gemeinschaft bildet, die sich nicht nur auf die territoriale Zugehörigkeit zu einem Wirtschaftsraum gründet, sondern ebenso auf die Teilhabe an einem Verbund gemeinsamer Wertvorstellungen wie Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Sicherheit und Achtung der Vielfalt.[7] Die Charta soll den Unionsbürgern zugleich Schutz vor den nachteiligen Auswirkungen eines rein auf die Wirtschaft fokusierten Handelns sichern. Mit der Charta können auch die Grundprinzipien der europäischen Identität nach außen dargestellt werden, damit sich die mittelosteuropäischen Beitrittskandidaten ein klares Bild vom Wesen der Union machen können, der sie bald selbst angehören möchten.[8]
[...]
[1] Erklärung des Europäischen Rates in Köln, abgedruckt in: Europäische Grundrechte-Zeitschrift 1999, S. 364 ff.
[2] Hierzu Sander, Europäischer Gerichtshof und nationale Verfassungsgerichtsbarkeit, in: Die Öffentliche Verwaltung 2000, S. 588 ff.
[3] EuGH Slg. 1969, S. 419 ff. – Rs. 29/69.
[4] Ausführlich zur Anerkennung von Grundrechten durch den EuGH Wetter, Die Grundrechtscharta des Europäischen Gerichtshofes, 1998.
[5] Losch/Radau, Grundrechtskatalog für die Europäische Union, in: Zeitschrift für Rechtspolitik 2000, S. 86.
[6] Lenz, Ein Grundrechtskatalog für die Europäische Gemeinschaft?, in: Neue Juristische Wochenschrift 1997, S. 3289.
[7] Hilf, Ein Grundrechtskatalog für die Europäische Gemeinschaft, in: Europarecht 1991, S. 26
[8] Zur Beitrittsfrage Sander, Die Teilhabe mittel- und osteuropäischer Staaten an wirtschaftlichen Integrationsräumen, am Beispiel der Tschechischen Republik in: Classen u.a. (Hrsg.): Festschrift für Thomas Oppermann, 2001, S. 312 ff.