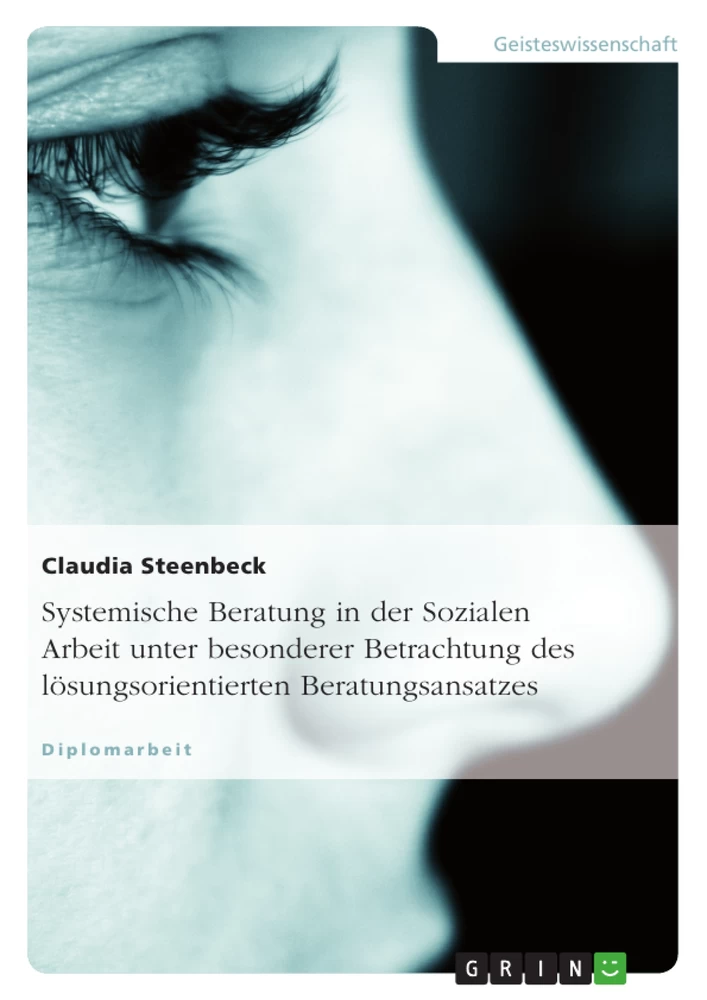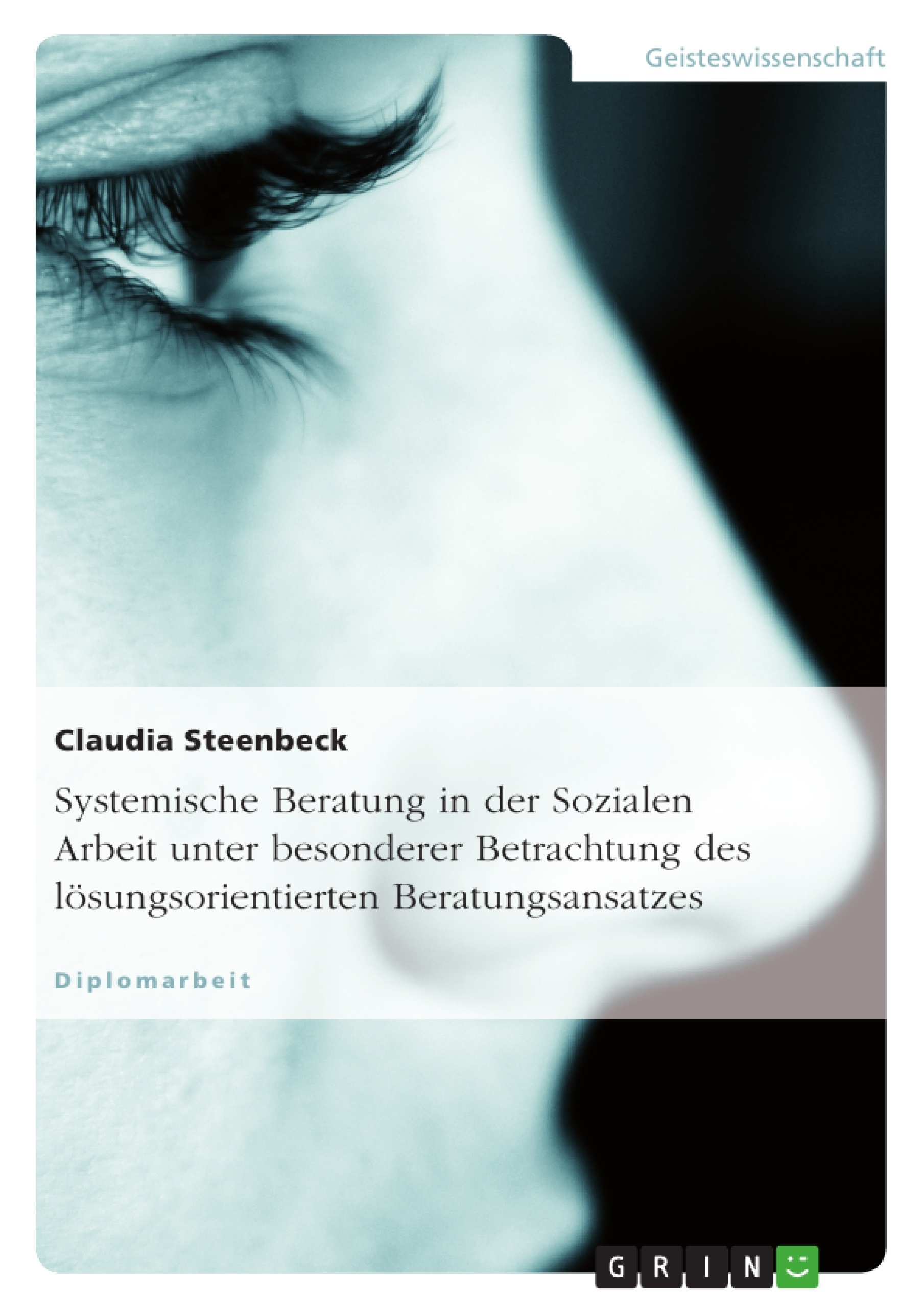Die Systemtheorie hat in unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen Eingang gefunden und ihre Grundgedanken haben sich in vielen theoretischen Modellen der Sozialpädagogik/Sozialarbeit verankert. Hervorgehoben wird in den systemischen Ansätzen die Erweiterung des Blicks der Sozialen Arbeit auf den sozialen Kontext der Klienten. In unzähligen Veröffentlichungen werden mittlerweile systemische Konzepte aufgezeigt. Damit einhergehend haben sich systemische Ansätze in den vergangenen Jahren immer mehr in den psychosozialen Arbeitsfeldern verbreitet und es kann ein Trend zu systemisch ausgelegten Zusatzqualifikationen beobachtet werden.
Die vorliegende Arbeit setzt sich einerseits mit systemtheoretischen Grundlagen und Grundbegriffen auseinander und schafft andererseits einen Bezug zur Anwendung der daraus resultierenden Erkenntnisse in Beratungskontexten der Sozialen Arbeit. In dieser Arbeit wird aufgezeigt, inwieweit in der Sozialen Arbeit systemtheoretische Erkenntnisse in Beratungskontexte eingearbeitet werden können. Dazu wird die Anwendbarkeit systemtheoretischer Ansätze in der Praxis der Sozialen Arbeit an der Darstellung des lösungsorientierten Beratungsansatzes dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Begriffsklärungen
3 Beratung in der Sozialen Arbeit
3.1 Der historische Ursprung psychosozialer Beratung
3.2 Die Etablierung professioneller Beratungsstellen in der Bundesrepublik Deutschland
3.3 Die historische Entwicklung von Beratung und Psychotherapie
3.4 Beratung in Abgrenzung zur Psychotherapie
4 Systemtheoretische Grundlagen
4.1 Systemtheorie
4.2 Was ist ein System?
4.3 Systemtypen
4.4 Der Mensch als Systemakteur
4.5 Die Autopoiesis von Systemen
4.6 Kybernetik und Zirkularität
4.7 Konstruktivismus: „Was ist wirklich Wirklichkeit?“
4.8 Das systemtheoretische Verständnis von Problemen
4.9 Historische Entwicklung der systemischen Beratung in der Sozialen Arbeit
5 Kommunikationstheoretische Grundlagen nach Paul Watzlawick
6. Der lösungsorientierte Beratungsansatz
6.1 Zur Entstehungsgeschichte des lösungsorientierten Beratungsansatzes
6.2 Anwendungsgebiete der lösungsorientierten Beratung
6.3 Das Menschenbild in der lösungsorientierten Beratung
6.4 Grundprinzipien und Ziele im Rahmen der lösungsorientierten Beratung
6.5 Haltung und Gesprächsführung des Beraters
6.6 Der Berater als Beobachter
6.7 Bedeutung des Kontextes und der Prozessgestaltung
Systemische Beratung in der Sozialen Arbeit unter besonderer Betrachtung des lösungsorientierten Beratungsansatzes
6.8 Methoden und Techniken (Auswahl)
6.8.1 Ressourcenorientierte Interventionen
6.8.2 Die Identifizierung und Nutzung von Ausnahmen
6.8.3 Skalierungen
6.8.4 Paradoxe Interventionen
6.8.5 Zirkuläres Fragen
6.8.6 Wunderfragen
6.9 Kritische Betrachtung des lösungsorientierten Beratungsansatzes
6.9.1 Die Problemanalyse in der lösungsorientierten Beratung
6.9.2 Probleme (auf)lösen?
7 Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Systemische Beratung in der Sozialen Arbeit unter besonderer Betrachtung des lösungsorientierten Beratungsansatzes
1 Einleitung
Die Systemtheorie hat in unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen Eingang gefunden und ihre Grundgedanken haben sich in vielen theoretischen Modellen der Sozialpädagogik/ Sozialarbeit1 verankert. Hervorgehoben wird in den systemischen Ansätzen die Erweiterung des Blicks der Sozialen Arbeit auf den sozialen Kontext der Klienten. In unzähligen Veröffentlichungen werden mittlerweile systemische Konzepte aufgezeigt. Damit einhergehend haben sich systemische Ansätze in den vergangenen Jahren immer mehr in den psychosozialen Arbeitsfeldern verbreitet und es kann ein Trend zu systemisch ausgelegten Zusatzqualifikationen beobachtet werden.
Die vorliegende Arbeit setzt sich einerseits mit systemtheoretischen Grundlagen und Grundbegriffen auseinander und schafft andererseits einen Bezug zur Anwendung der daraus resultierenden Erkenntnisse in Beratungskontexten der Sozialen Arbeit. In dieser Arbeit wird aufgezeigt, inwieweit in der Sozialen Arbeit systemtheoretische Erkenntnisse in Beratungskontexte eingearbeitet werden können. Dazu wird die Anwendbarkeit systemtheoretischer Ansätze in der Praxis der Sozialen Arbeit an der Darstellung des lösungsorientierten Beratungsansatzes dargestellt.
Die Beratung von Klienten stellt eine zentrale Tätigkeit in der Sozialen Arbeit dar, jedoch existiert keine einheitliche Theorie der sozialpädagogischen Beratung (vgl. Beck 1991, S. 39). Vielmehr bestehen eine Vielzahl von Beratungsansätzen, wie beispielsweise die klientenzentrierte Beratung, die psychoanalytisch orientierte Beratung, die kognitiv-behavioral orientierte Beratung oder die systemische Beratung. Im Anschluss an diese Einleitung wird sich daher, nach der Definition von grundlegenden Begriffen im zweiten Kapitel, im dritten Kapitel zunächst unter Einbeziehung von historischen Entwicklungen, das Handlungsfeld der Beratung und ihre Etablierung in der Sozialen Arbeit dargestellt. Darauf folgend wird die Beratung als eine Interventionsform der Sozialen Arbeit in Abgrenzung zur Psychotherapie erörtert, da in beiden Arbeitsfeldern Ähnlichkeiten unter anderem im Bereich der Theorien, Methoden und Techniken bestehen und die Begriffe in der Literatur immer wieder synonym verwendet werden.
Im vierten Kapitel erfolgt eine Erläuterung systemtheoretischer Theorien, Erkenntnismodelle und Begriffe. In unserer Alltagssprache benutzen wir häufig den Systemische Beratung in der Sozialen Arbeit unter besonderer Betrachtung des lösungsorientierten Beratungsansatzes Begriff des Systems, wir sprechen unter anderem vom Sozialsystem oder Bildungssystem. Gegenstand der Ausführungen ist es daher, den Systembegriff zu erläutern und wesentliche Merkmale von Systemen darzustellen. Die Besonderheiten unterschiedlicher Systemtypen werden herausgearbeitet und für die systemische Beratung relevante Erkenntnisse der Systemtheorie werden dargestellt. Da der Gegenstand der Sozialen Arbeit die Bearbeitung sozialer Probleme ist, wird zudem das systemische Verständnis von Problemen erläutert. Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit der Darstellung der historischen Entwicklung der systemischen Beratung in der Sozialen Arbeit.
Das fünfte Kapitel setzt sich mit kommunikationstheoretischen Grundlagen auseinander, da diese zum theoretischen Fundament eines jeden Beraters beziehungsweise einer jeden Beraterin zählen sollten. Dabei wird sich auf die Kommunikationstheorie von Paul Watzlawick, Janet H. Beavin und Don D. Jackson (2000) bezogen.
Dem Anschließend wird im sechsten Kapitel der lösungsorientierte Beratungsansatz genauer betrachtet. Zunächst wird ein Überblick über die Entstehungsgeschichte dieses Ansatzes gegeben und es werden mögliche Anwendungsgebiete aufgezeigt. Der nächste Abschnitt dieses Kapitels setzt sich mit dem Menschenbild des lösungsorientierten Ansatzes auseinander, so dass ein Einblick in die systemische Sichtweise von den Wesenszügen des Menschen gegeben wird. Im Anschluss daran wird auf verschiedene Grundprinzipien und Ziele eingegangen, die im lösungsorientierten Beratungsansatz von zentraler Bedeutung sind. Hierauf aufbauend wird auf wichtige Aspekte der Beraterrolle beziehungsweise der Beraterinnenrolle und der Prozessgestaltung eingegangen, die im Beratungsverlauf beachtet werden müssen. Des Weiteren wird eine Auswahl möglicher Fragetechniken und Methoden, die innerhalb der lösungsorientierten Beratung angewendet werden können, vorgestellt. Abschließend wird der lösungsorientierte Beratungsansatz und seine Anwendung in der Sozialen Arbeit kritisch betrachtet.
Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass sich die systemtheoretischen Ausführungen auf Systeme beziehen, denen Menschen des christlich-abendländischen Kulturkreises angehören. Die sozialen Systeme anderer Kulturkreise unterliegen nicht dem Kenntnisstand der Verfasserin, so dass darüber in diesen Ausführungen keine Aussagen getätigt werden können.
Systemische Beratung in der Sozialen Arbeit unter besonderer Betrachtung des lösungsorientierten Beratungsansatzes Zur Erleichterung des Leseflusses wird in dieser Arbeit darauf verzichtet, beide Geschlechter ausdrücklich anzusprechen. Es soll jedoch betont werden, dass generell sowohl Frauen als auch Männer gemeint sind. Mit der maskulinen Form im Singular und Plural wird sich daher immer auf beide Geschlechter bezogen. Die Fußnoten werden in der vorliegenden Arbeit dazu verwendet, dem Leser Anmerkungen der Verfasserin sowie ergänzende Informationen zukommen zu lassen.
Systemische Beratung in der Sozialen Arbeit unter besonderer Betrachtung des lösungsorientierten Beratungsansatzes
2 Begriffsklärungen
Im Folgenden werden grundlegende Begriffe erläutert, die in dieser Arbeit verwendet werden. Dazu werden die Begriffe Soziale Arbeit, Sozialarbeit und Sozialpädagogik definiert, um zu verdeutlichen, wie diese Begriffe in den vorliegenden Ausführungen zu verstehen sind. Mit der gleichen Intention werden zudem die Begriffe Theorie, Konzept, Methode, Technik und Intervention definiert.
Der Begriff Soziale Arbeit wird in dieser Arbeit in Anlehnung an Lüssi (1998, S. 48) als Oberbegriff für die Handlungsfelder der Sozialarbeit und Sozialpädagogik benutzt. Soziale Arbeit ist in diesen Ausführungen als Bezeichnung eines Berufsfeldes zu verstehen. Dieses Berufsfeld wird sowohl von der Sozialpädagogik als auch von der Sozialarbeit bedient. Sozialpädagogen nehmen an der Lebenswelt und dem Alltag ihrer Klienten teil. Ziel der Sozialpädagogik ist es, (…) die Klienten persönlich zu beeinflussen und ihre Lebenswelt so zu gestalten, dass sie sich sozial bestmöglich entwickeln können. Das hat in einen Falle (z.B. bei Kindern) einen überwiegend erzieherischen, im andern Falle (z.B. bei erwachsenen Geistigbehinderten) einen mehr betreuerischen Charakter. (a.a.O., S. 50)
Im Gegensatz dazu ist der Sozialarbeiter
(…) ambulant tätig, und er beschäftigt sich nur mit Problemen der Leute. Er hat seinen Sitz in einer Institution (Sozialdienst, Beratungsstelle, Fürsorgeamt etc.), nicht in der Lebenswelt der Klienten. Diese kommen zu ihm oder er geht zu ihnen (das ambulante Moment), aber er teilt weder hier noch dort den Alltag mit ihnen, sondern behandelt dabei ein Problem, das sie haben. (a.a.O., S. 51)
Die vorliegende Arbeit hat ihren Schwerpunkt auf das Handlungsfeld der Beratung gesetzt. Den vorgestellten Definitionen folgend wird sich daher dem Tätigkeitsfeld eines Sozialarbeiters zugewendet.
Der Begriff Theorie wird in dieser Arbeit als ein Gedankenmodell verstanden, das aus Erkenntnisbildung heraus entstanden ist. Theorien dienen dem Erklären von Erscheinungen und Realität. Zudem ermöglicht eine theoretisch fundierte Vorgehensweise im Feld der Sozialen Arbeit zukunftsorientiertes Handeln (vgl. Müller 2002, S. 970).
Unter Konzept wird in dieser Arbeit anlehnend an Geißler und Hege (2001, S. 23) ein Handlungsmodell verstanden, in dem die Ziele, Inhalte, Techniken und Methoden in Systemische Beratung in der Sozialen Arbeit unter besonderer Betrachtung des lösungsorientierten Beratungsansatzes einen Sinnzusammenhang gebracht werden, der das Handlungsmodell begründet und rechtfertigt.
Der Begriff Methode wird in dieser Arbeit als ein Arbeitsprinzip verstanden (Ehrhardt 2002, S. 639). Methoden werden demnach eingesetzt, um im Umgang mit einem sozialen Problem ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Somit stellen Methoden ein Handlungsinstrumentarium dar, das professionelles Handeln von intuitivem Handeln durch eine geplante Vorgehensweise- unterscheiden lassen. Methoden stellen zudem Teilaspekte von Konzepten dar (vgl. Geißler/Hege 2001, S. 24).
Techniken (Verfahren) sollen in dieser Arbeit als konkrete Vorgehensweisen verstanden werden und stellen somit Einzelelemente des methodischen Handelns dar (vgl. Ehrhardt 2002, S. 639). Techniken stehen ebenso wie Methoden in einem engen Zusammenhang mit den Zielen und Inhalten (vgl. Geißler/Hege 2001, S. 29).
Wird in dieser Arbeit von Interventionen gesprochen, so sind diese als ein helfendes Handeln, das auf Strukturen und Prozesse der Mikroebene (Klienten) ausgerichtet ist, zu verstehen (vgl. a.a.O., S. 16). Die Verwendung der Begriffe Intervention und Interventionsform ist in dieser Arbeit nicht mit der in Kapitel 6 erwähnten Definition von Lüssi (1998, S. 415f) zu vereinbaren. Nach Lüssi stellt die sozialarbeiterische Intervention eine bestimmte Handlungsart in Bezug auf eine spezifische Problematik dar.
3 Beratung in der Sozialen Arbeit
Beratung ist eine zentrale Tätigkeit innerhalb der Sozialen Arbeit2. Die häufigste Form ist die Alltagsberatung. Diese findet im eigenen sozialen Umfeld statt, das heißt unter anderem in der Familie, bei Freunden oder bei Bekannten.
Professionelle Beratung ist im Gegensatz zur Alltagsberatung eine personenzentrierte soziale Dienstleistung und findet dort ihren Anwendungsbereich, wo die Alltagsberatung an ihre Grenzen gelangt ist. Verschiedenste Angebote professioneller Beratung haben sich in den letzten Jahren in der Sozialen Arbeit in der Bundesrepublik Deutschland etabliert (vgl. Abschnitt 3.2). Als älteste Beratungsform ist die pädagogische Beratung (Erziehungsberatung) zu nennen (vgl. Nussle-Stein 2006, S. 76).
Gekennzeichnet ist die professionelle Beratung durch eine Hinterlegung und Begründung der Zielsetzung der Beratung und des Beratungshandelns mit wissenschaftlichen und konzeptionellen Ansätzen (vgl. Belardi 2002, S. 327ff).
Dem Beratungsverständnis der Deutschen Gesellschaft für Beratung folgend (DGfB)3 fördern Beratungsfachkräfte auf Grundlage einer professionellen Beratungsbeziehung
(…) das verantwortungsvolle Handeln einzelner Personen und Gruppen in individuellen, partnerschaftlichen, familialen (!), beruflichen, sozialen, kulturellen, organisatorischen,ökologischen und gesellschaftlichen Kontexten. (vgl. Deutsche Gesellschaft für Beratung/German Association for Counseling e.V. 2003, Kapitel 2)
Nestmann et al. (2004, S. 599) definieren Beratung als
(…) eine vielgestaltige, sich ständig verändernde und durch viele interne und externe Einflussfaktoren bestimmte professionelle Hilfeform. Sie unterstützt in variantenreichen Formen bei der Bewältigung von Entscheidungsanforderungen, Problemen und Krisen und bei der Gestaltung individueller und sozialer Lebensstile und Lebensgeschichten.
Beide Definitionen machen auf eine Vielzahl von Anlässen, Aufgaben und Zielen der Beratung aufmerksam. Beratungsangebote der Sozialen Arbeit können als Reaktion auf die durch gesellschaftliche Veränderungen hervorgerufene Pluralisierung der Lebensformen angesehen werden. Insbesondere die zunehmende Komplexität und vermehrte Unsicherheit in den Bereichen Familie, Schule und Beruf sowie Tendenzen der Individualisierung und Entsolidarisierung erschweren für viele Menschen ein krisenfreies und selbstbestimmtes Leben (vgl. Belardi 2002, S. 327).
In der vorliegenden Arbeit wird vorwiegend die psychosoziale Beratung Beachtung finden, da als Ursache für die Inanspruchnahme professioneller Beratung in der Sozialen Arbeit in der Regel psychosoziale Probleme anzusehen sind. Diese sind durch lebenspraktische, psychische, physische und wirtschaftliche Schwierigkeiten gekennzeichnet. Im Vordergrund der Beratung stehen somit personale, soziale undökonomische Faktoren (vgl. a.a.O., S. 329).
Aufgabe der psychosozialen Beratung ist es, Lösungswege für Probleme zu erarbeiten, die in der sozialen Umwelt des Klienten wahrnehmbar sind, gegebenenfalls dort auch entstehen und die dieser als persönliche Probleme erlebt. Psychosoziale Beratung ist demnach eine Interventionsform, die der psychosozialen Versorgung zugeordnet werden kann (vgl. Großmaß 1997, S. 114).
Großmaß (2004, S. 100) bezeichnet psychosoziale Beratung als ein (…) professionelles psychosoziales Handeln, das Orientierungshilfe bei der Klärung individueller Probleme bietet, die aus sozialen Anforderungen entstehen und den persönlichen, intimen Bereich der Personen betreffen und irritieren.
Im Rahmen psychosozialer Beratung werden demzufolge psychische und soziale Befindlichkeiten des Klienten in Verbindung zu seinem sozialen Kontext (Lebens- und Umweltbedingungen) betrachtetet. Dementsprechend wird nach dem Einfluss des sozialen Kontextes auf die Befindlichkeit von Individuen gefragt. Die gesellschaftlichen Ansprüche, Normen und Werte werden in ihrem Zusammenhang mit persönlichen Bedürfnissen und Motiven betrachtet (vgl. Nussle-Stein 2006, S. 84). „Der psychosoziale Ansatz von Beratungsverständnis ist als Systemansatz zu verorten und bezieht den Faktor der Ressourcen mit ein“ (a.a.O., S. 85). Das Ziel der psychosozialen Beratung ist in der Abstimmung zwischen Individuum und Umwelt zu sehen. Es wird daher der Austausch zwischen Individuum und Umwelt betrachtet, auf dessen systemische Bedeutung im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch eingegangen wird (vgl. ebd.).
Im Folgenden wird zunächst ein kurzer Überblick über das Social Case Work4 als klassische Methode der Sozialen Arbeit gegeben, da in dieser Methode der Ursprung psychosozialer Beratung liegt. Daraufhin wird ein historischer Einblick in die Entwicklung der Etablierung professioneller Beratungsstellen in der Bundesrepublik Deutschland gegeben werden, um zu verdeutlichen, wie sich Beratungsangebote in der Sozialen Arbeit herausbildeten. Aufgrund der in der einschlägigen Literatur vielfach diskutierten Nähe zwischen den Interventionsformen Beratung und Psychotherapie wird im Anschluss ein Einblick in die Entwicklungsphasen beider Arbeitsfelder gegeben, um abschließend Möglichkeiten der Abgrenzung aufzuzeigen.
3.1 Der historische Ursprung psychosozialer Beratung
Psychosoziale Arbeit kann in der Geschichte der professionellen Sozialarbeit weit zurückverfolgt werden. Nach Bernler und Johnsson (1997, S.16) ist unter ihr die vorbeugende und behandelnde Arbeit mit Familien, Gruppen und Individuen zu verstehen. Der Ursprung sozialarbeiterischer Beratung liegt im amerikanischen Social Case Work5 (vgl. ebd.):
Die historischen Wurzeln sozialarbeiterischer Beratung liegen bei der Fallarbeit (social case work) nordamerikanischer und europäischer Hausbesucherinnen in den Wohnungen von Familien, die um soziale Unterstützung und Hilfe nachgesucht hatten. (Belardi u.a. 2005, S. 9f)
Die Anfänge des Social Case Work sind in der Sozialarbeit von großen amerikanischen Wohlfahrtsorganisationen zu Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts zu finden. Als Begründerin des Social Case Work ist Mary Richmonds (1861-1928) anzusehen. Richmond war in der Charity Organization Society (COS)6 in Baltimore tätig und arbeitete eng mit der Johns Hopkins University, an der unter anderem Medizin gelehrt wird, zusammen. Richmonds orientierte sich insbesondere an medizinischen und psychologischen Modellen. Der medizinische Einfluss wird vor allem daran deutlich, dass Richmond Armut als disease bezeichnete. Viele Studenten der Johns Hopkins Universität arbeiteten ehrenamtlich als friendly visitors bei der Wohlfahrtsorganisation. Die friendly visitors sollten als soziale Ärzte im Rahmen von Hausbesuchen Armut heilen (vgl. Bernler/Johnsson 1997, S. 17). Die Hausbesucher waren ermittelnd, beratend und vermittelnd in Familien tätig, die soziale Unterstützung und Hilfe suchten (vgl. Belardi u.a. 2005, S. 10).
Richmond veröffentlichte 1917 das Buch Social Diagnosis, in dem sie ihre Sozialarbeitsmethode vorstellte, welche dann später als Social Case Work bezeichnet wurde. Die soziale Diagnose soll den Klienten unter Einbeziehung seiner Persönlichkeit und seiner sozialen Situation darstellen und beurteilen. Demzufolge kann Richmonds Vorgehensweise als Vorläufer psychosozialer Arbeit bezeichnet werden, auch wenn sie diese Formulierung nicht selber verwendete (vgl. Bernler/ Johnsson 1997, S. 17f).
In Deutschland veröffentlichte Alice Salomon 1926 ihr Buch Soziale Diagnose und machte damit die Methode der Sozialen Einzelhilfe bekannt. Durch mehrere Reisen waren Salomon die Entwicklungen der amerikanischen Sozialen Arbeit vertraut. Ihr Buch trägt nicht nur den gleichen Titel wie Richmonds Werk, Salomon lehnte sich in ihren Ausführungen auch teilweise an dieses an, erhielt allerdings damals mit ihrer Veröffentlichung keine gleichwertige Anerkennung (vgl. Galuske 2003, S. 74).
Seit Anfang der 30er Jahre entwickelte sich das Social Case Work in den USA zu einer Form der „Minitherapie“7 (Belardi u.a. 2005, S. 191) für die ärmere Bevölkerung. Einfluss auf die amerikanische Sozialarbeit hatten in dieser Zeit sowohl die Psychiatrie als auch die Psychoanalyse. Die Sozialarbeit wurde damals dementsprechend von psychoanalytischen Konzepten beeinflusst. Fachliche Auseinandersetzungen führten in den USA auch während des zweiten Weltkrieges zur Weiterentwicklung des Social Case Work und zur Ausdifferenzierung unterschiedlicher Ansätze. Beispielsweise können im Feld der sozialen Einzelhilfe der psychosoziale Ansatz, der funktionale Ansatz und der problemlösende Ansatz voneinander unterschieden werden. Diese unterschiedlichen Konzepte weisen Differenzen hinsichtlich der Ansatzpunkte sozialarbeiterischen Handelns auf (vgl. Galuske 2003, S. 74ff).
In der Bundesrepublik Deutschland (BRD)8 hatte das Social Case Work seine Hochkonjunktur erst nach dem zweitem Weltkrieg. Dieses ist darin zu begründen, dass die Weiterentwicklung der Methode zu Zeiten des Nationalsozialismus weitgehend stagnierte. Durch Austauschprogramme, Studienaufenthalte und Fort- sowie Weiterbildungsangebote von Fachkräften, die teilweise aufgrund des Krieges zuvor nach Amerika emigriert waren, fanden die amerikanischen Vorgehensweisen in Deutschland zunehmend Interesse, so dass es zu einem regsamen Methodentransfer kam. Da das Social Case Work jedoch eine psychotherapeutisch orientierte Arbeitsmethode darstellte und sich weitgehend an medizinischen und psychoanalytischen Modellen orientierte, fand diese Arbeitsmethode in Deutschland allerdings starke Ablehnung durch die katholische Kirche, da diese die Psychoanalyse von Freud (1856-1939)9 als religionskritisch ansah. Zudem beruhte die zu dieser Zeit noch geringe Ausdifferenzierung in Deutschland auf den im Vergleich zu den USA vorliegenden unterschiedlichen strukturellen Rahmenbedingungen. In den USA war eine fachliche Ausdifferenzierung der Arbeitsmethoden unter anderem aufgrund der dortigen geringeren Fallzahlen und der vorherrschenden Abstinenz vor eingreifenden Handlungen einfacher, so dass sich neue individuell-therapeutische Konzepte verbreiteten konnten (vgl. Galuske 2003, S.74f).
In der Nachkriegszeit trat in den Mittelpunkt des Denkens die Klient-Sozialarbeiter- Beziehung. So wurden beispielsweise Übertragungsphänomene innerhalb der Case Work Arbeit beobachtet. Zudem rückte in der Sozialen Arbeit die Stärkung des Ich in den Vordergrund (vgl. Neuffer 2005, S.40). Die Soziale Einzelhilfe richtet sich grundsätzlich an einzelne Individuen. Die Probleme der Klienten werden dabei als in seiner Person liegend angesehen (vgl. Galuske 2003, S. 77). In dieser klassisch, psychoanalytisch fundierten Ausprägung des Case Work werden die Probleme der Klienten zwar auch als solche angesehen, die sich ebenso in seiner Umwelt und in seiner Alltagsbewältigung ausdrücken. Sie sollen jedoch durch die Arbeit mit dem Inneren des Klienten, das heißt durch eine Stärkung des Ich, direkt behandelt werden. Das Individuum steht daher immer im Mittelpunkt des Handelns. Bezieht der Sozialarbeiter die Umwelt des Klienten mit ein, so wird dies als indirektes sozialarbeiterisches Handeln gewertet. Es soll dadurch nicht die soziale Situation des Klienten begünstigend beeinflusst werden, sondern eine Stärkung des Ich bewirkt werden (vgl. Lüssi, 1998, S. 59f).
Der Hilfeprozess wurde in dieser Zeit in die drei Phasen Anamnese, psychosoziale Diagnose und Behandlung eingeteilt. Die Soziale Arbeit wollte sich weiter professionalisieren, so dass insbesondere über Lehrfälle die Erweiterung von Fachwissen, methodischem Können und die Einnahme einer professionelleren Haltung angestrebt wurde. Kritisiert wurde diese Entwicklung Ende der 1960er Jahre. Vor allem die Individualisierung von gesellschaftlich hervorgerufenen Problemen, die Verbindung von Arbeitsmethode und Beratungsziel als auch das eklektische Nutzen wissenschaftlicher Annahmen ist kritisch betrachtet worden. Bemängelt wurde das Fehlen einer mehrdimensionalen Sichtweise (Einbeziehung von Gemeinwesen/ Stadtteil,ökonomischen Kriterien sowie institutionelle Vorgaben) in Bezug auf die Probleme der Klienten. Therapeutische Konzepte beeinflussten im Anschluss weiterhin das Case Work über Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und die geforderte systemische Betrachtungsweise prägte die psychosoziale Beratung nachhaltig (vgl. Neuffer 2005, S.40f).
3.2 Die Etablierung professioneller Beratungsstellen in der Bundesrepublik Deutschland
Seit Ende des 19. Jahrhunderts etablierten sich Beratungsangebote im Bereich der Familien- und Jugendfürsorge (vgl. Belardi u.a. 2005, S. 94). Nach Inkrafttreten des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes (RJWG) von 1923 verankerten sich in Deutschland die ersten Beratungsstellen für Erziehungsfragen und mit dem RJWG war eine gesetzliche Grundlage für die Einrichtung von Jugendämtern geschaffen, in deren Ermessen es lag, „Beratung in Angelegenheiten der Jugendlichen“ (ebd.) anzubieten. Neben den Jugendämtern, die ausgegliederte Erziehungsberatungsstellen anboten, kam es in den 1930er Jahren auch zur Gründung freier und kirchlicher Erziehungsberatungsstellen. Zu dieser Zeit hatte Beratung die Funktion der Informationsvermittlung, Aufklärung und der Sicherung von gesellschaftlichen Norm- und Wertvorstellungen10 (vgl. Nußbeck 2006, S. 13ff).
Durch das Gesetz über die Einrichtung der Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung (1927) etablierte sich die staatliche Berufsberatung, die ihren Auftrag in der Lehrstellen- und Arbeitsplatzvermittlung sah und später auch gesellschaftliche und individuelle Problematiken in ihre Arbeit mit einbezog (vgl. a.a.O., S. 15).
Zu Zeiten des zweiten Weltkrieges wurden die Beratungsstellen teilweise geschlossen, so dass es nach Kriegsende zu Neugründungen oder Neugestaltungen kam. Mit Beginn der 1950er Jahre waren es vor allem die kommunalen und kirchlichen Träger, die zahlreiche Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und deren Eltern gründeten.
Die Beratung diente im Sinne des damaligen autoritären Fürsorgesystems weiterhin noch der Sicherung von gesellschaftlichen Norm- und Wertvorstellungen (vgl. Nußbeck 2006, S. 15).
Seit den 1960er Jahren etablierte sich die Bildungsberatung, die der Verwirklichung individueller und gesellschaftlicher Bildungsziele diente. Als Weiterführung dieser und als Antwort auf das breit gefächerte und immer weiter ausdifferenzierte Fächerangebot der Hochschulen sind zudem Studienberatungsstellen entstanden (vgl. a.a.O., S. 15f). Die 1968er Studentenbewegung führte dann unter anderem zum weiteren Ausbau der Beratungslandschaft im psychosozialen Bereich. Nahezu zeitgleich begann innerhalb von Deutschland die Psychologisierung des Alltagslebens. Rückblickend spricht man heute diesbezüglich vom Psychoboom. Diese Entwicklung beeinflusste langfristig das Arbeitsfeld Beratung (vgl. Belardi 2002, S. 327). „Die Vermittlung von Informationen und das Anpassen an Wertvorstellungen der Gesellschaft traten in den Hintergrund und Beratung rückte in die Nähe von psychotherapeutischen Verfahren“ (Nußbeck 2006, S. 15).
In den 1970er Jahren wurde in Deutschland deutlich, dass sozial schwächere Bevölkerungsgruppen im psychosozialen Bereich unterversorgt waren. Daraus entwickelte sich zunächst die Unterschichtberatung und es etablierten sich verschiedene Selbsthilfegruppen. Ihr folgten weitere spezialisierte Beratungsangebote wie beispielsweise Migrantenberatung, Jugendberatung oder Trennungsberatung. Insbesondere die Anzahl der Erziehungsberatungsstellen nahm mit Beginn der 1970er Jahre deutlich zu (vgl. Belardi 2002, S. 327). Die ersten Drogen- und Suchtberatungsstellen entstanden als Reaktion auf die ansteigende Drogenproblematik und seit 1976 kam es zur Beratungspflicht im Bereich der Schwangerschaftskonfliktberatung, so dass auch in diesem Bereich ein Ausbau der Beratungsangebote stattfand (vgl. Nußbeck 2006, S.16).
Weiteren Einfluss auf die zunehmende Etablierung von psychosozialen Beratungsangeboten hatten die ineffektiven Verfahrensweisen der damaligen geschlossenen Institutionen. Durch Prävention, Beratung und Nachsorge sollten Einweisungen vermieden werden (vgl. Belardi 2002, S. 327). Beispielsweise entstanden als Reaktion auf die Psychiatrie Enquête11 (1975) neue Beratungsstellen, die sich auf die Problematiken psychisch erkrankter Menschen spezialisierten.
Rückblickend ist zu erkennen, dass sich die Beratung in den 1960er und 1970er Jahren immer mehr an den Klienten mit ihren individuellen Problemen und Bedürfnissen orientiert hat. Durch die fortlaufende Entwicklung hin zu einem auch psychologisch fundierten Hilfsangebot wuchs die Nähe der Beratung zu therapeutischen Verfahren. Insbesondere die humanistische12 Psychologie trat in das Interesse der Fachkräfte. Zunehmend wurden verschiedene Techniken der klientenzentrierten (nicht-direktiven13 ) Gesprächsführung14 angewandt und durch die sich verbreitende systemische Sichtweise änderte sich die Betrachtung der Klienten und ihrer Probleme. Klienten wurden nicht mehr abgesondert von ihrem sozialen Gefüge betrachtet. Dies hatte zur Folge, dass heute nicht nur der einzelne Klient im Vordergrund der Beratung steht, sondern auch das System, in dem dieser lebt und welches er mitgestaltet (vgl. Nußbeck 2006, S. 15).
Die Sozialarbeit schien von therapeutischen Maßnahmen nahezu fasziniert. In den 1980er Jahren spiegelte sich dies durch eine Vielfalt an Zusatzausbildungen und Spezialisierungen in diesem Bereich wider. Mit dem Zerfall von stützenden Strukturen wurden neue Problematiken deutlich, die beispielsweise in der Etablierung von Trennungs- und Scheidungsberatungsstellen, Sozialberatungsstellen oder von Schuldnerberatungsstellen ihren Ausdruck fanden (vgl. Mühlum 1999, S. 2f).
In den 1990er Jahren prägte dann das systemische Denken die Sozialarbeit. Ausdruck findet dies zum Beispiel in Peter Lüssis (1991) systemischer Sozialberatung oder im handlungstheoretischen Ansatz von Silvia Staub-Bernasconi (1995). Es wird nicht mehr von einer psychosozialen Diagnose, sondern vom Assesment als Form der flexibleren Einschätzung gesprochen und es wird versucht, alle Aspekte, die den Klienten in seiner Situation berühren, in die Beratung einzubeziehen (vgl. ebd.).
Mit dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) vom 26. Juli 1990 kam es zu einer weiteren Veränderung im Beratungsverständnis. Die verschiedenen Lebensentwürfe der Klienten wurden akzeptiert und die Jugendhilfe stellte sich dem Anspruch, Beratung als Hilfe zur Konfliktlösung zu verstehen (vgl. Nußbeck 2006, S. 15f).
Der aufgezeigte historische Einblick in die Entwicklung der Etablierung von professionellen Beratungsstellen macht deutlich, dass Beratung heute in den unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern und mit den unterschiedlichsten Adressaten stattfindet. Neben den erwähnten Erziehungs-, Schwangerschaftskonflikt-, Trennungs- und Scheidungs-, Schuldner-, Sucht-, Bildungs-, oder Studienberatungsstellen haben sich unter anderem die Partnerschafts-, die Migranten- oder die Frauenberatungs- stellen etabliert. Durchgeführt wird die Beratung entweder von einzelnen Beratern oder innerhalb eines Beraterteams. Spezielle Beratungsinstitutionen deröffentlichen oder freien Trägerschaft sowie Praxen beziehungsweise (interdisziplinäre) Praxis- gemeinschaften bieten heute professionelle Beratung an (vgl. Deutsche Gesellschaft für Beratung/German Association for Counseling e.V. 2003, Kapitel 2).
Bis heute gibt es allerdings keine einheitlichen Ausbildungsrichtlinien für Berater in Deutschland. Bisher existieren lediglich verschiedene weiterbildende oder berufs- begleitende Studiengänge. Allerdings ist die Tendenz zu einem einheitlichen und qualitativ anspruchsvollen Profil der Beratungsberufe zu erkennen. Insbesondere die DGfB beschäftigt sich mit Themen wie Qualitätssicherung, Verbraucherschutz, Förderung wissenschaftlicher Fundierung von Beratung oder Lobbyarbeit.
Im Gegensatz zu Deutschland weist Beratung (Counseling) in den USA, Kanada, Großbritannien und Australien ein autarkes professionelles Selbstverständnis auf (vgl. Engel et al. 2004, S. 36). Counseling ist beispielsweise in den USA seit den 1980er Jahren zu einer eigenständigen Disziplin geworden, die sich auch innerhalb der Psychologiewissenschaft und der psychologischen Profession weiterentwickelt hat. Berater und Beratungspsychologen arbeiten in den USA in den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern und haben sich dementsprechend spezialisiert. Es existieren mehr als 400 Ausbildungs- und Anerkennungsprogramme für Beratung an den amerikanischen Universitäten und Colleges. Davon sind über 50 Beratungsausbildungsprogramme an Universitäten mit Doktorabschluss von der American Counseling Association (ACA) genehmigt. Als größter Beratungsverband hat die ACA ca. 60.000 Mitglieder. Die ACA hat verschiedene Beratungsspezialisierungen, wie beispielsweise community counseling oder mental health counseling, offiziell anerkannt. Zudem gibt es in den USA eine gesetzlich verankerte Lizenzierung und zahlreiche Zertifizierungs- möglichkeiten anöffentlichen oder privaten Instituten (vgl. Nestmann 1997, S. 161).
3.3 Die historische Entwicklung von Beratung und Psychotherapie
Betrachtet man Beratung und Psychotherapie unter dem Gesichtspunkt der historischen Entwicklung, so ist die Nähe dieser beiden Interventionsformen schon in ihren einzelnen Entwicklungsphasen zu erkennen.
Sowohl Psychotherapie als auch Beratung entstanden Ende des 19. Jahrhunderts. In den 1920er Jahren erlebten diese beiden Arten der psychosozialen Hilfe ihre erste Blütezeit. Zum einem war nach dem ersten Weltkrieg soziale und psychische Not weit verbreitet und es fehlte an gesellschaftlicher Infrastruktur, zum anderen zog der mit der Weimarer Republik (1919-1933) neu errungene Bürgerstatus für die Soziale Arbeit Reformbereitschaft nach sich. Psychotherapie und Beratung entwickelten sich in dieser Zeit noch relativ abgegrenzt voneinander. Die Psychotherapie setzte Konzepte von Freud, Jung (1875-1961)15 und Adler (1870-1937)16 um, die Beratung hatte als Mittelpunkt dagegen die Aufklärung beispielsweise über Verhütung, berufliche Möglichkeiten, Erziehung oder Partnerschaft (vgl. Großmaß 2004, S. 91).
Zu Zeiten der Weimarer Republik begann die Institutionalisierung. Es entstanden unter anderem psychotherapeutische Abteilungen in den Krankenhäusern und Beratungsstellen für Erziehung oder Sexualität. Diese Entwicklungen kamen jedoch, insbesondere in Deutschland, durch den auch sozialpolitisch umgesetzten Faschismus des Dritten Reiches, weitgehend zum erliegen. Im Vergleich entwickelte sich in den Vereinigten Staaten die Professionalisierung in Psychotherapie und Beratung fortdauernd weiter (vgl. ebd.).
In der Bundesrepublik Deutschland begann in der Nachkriegszeit zunächst die Wiederherstellung des vorigen Gesundheits- und Sozialsystems. Die Psychotherapie war somatisch und psychiatrienah orientiert, die Beratung wurde weiterhin als Methode zur Sicherung gesellschaftlicher Norm- und Wertvorstellungen verstanden (vgl. ebd.).
Durch die dann folgende Etablierung des Sozialstaates in der Bundesrepublik Deutschland und dem anschwellenden Interesse der Bevölkerung an psychologischem und psychotherapeutischem Wissen wurden vermehrt die neuen Arbeitsweisen der amerikanischen Psychologie beachtet. Diese Entwicklung förderte weiter die Nähe der Beratung zur Psychotherapie.
Vor allem Fachkräfte aus Amerika, die zum Teil aufgrund des Dritten Reiches zuvor emigriert waren, kamen nach Deutschland (zurück) und gaben Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen. Deutsche Sozialarbeiter gingen im Rahmen von Austauschprogrammen in die USA, um sich mit dem dortigen Stand der Sozialen Arbeit auseinander zu setzen (vgl. Galuske 2003, S.75).
Insbesondere in den 1960er und 1970er Jahren verdichtete sich die Infrastruktur der Beratungsstellen. Psychologische Methoden werden in der psychosozialen Beratung seit den 1960er Jahren verwendet, wodurch auch die Problematik der Abgrenzung zur Psychotherapie hervorgerufen wurde. Es stellte sich in Fachkreisen zunehmend die Frage, was noch als Beratung und was schon als Therapie verstanden werden müsse. Psychoanalytische Zusatzausbildungen rückten immer mehr in das Interesse der Beratungsfachkräfte.
Die psychosoziale Beratung entwickelte sich so zu einem Angebot, das sich an den Bedürfnissen der Klienten orientiert. Beispielsweise wurde die klientenzentrierte Gesprächsführung zu einer grundlegenden Qualifikation von Psychologen und Sozialarbeitern. Zudem wurde mit Beginn der 1970er Jahre in den Beratungsstellen damit begonnen, zunehmend humanistische Verfahren einzusetzen (vgl. Großmaß 2004, S. 92).
In den 1970er und 1980er Jahren lehnte sich die Beratung dementsprechend eng an therapeutische Konzepte an. Vor allem tiefenpsychologische, lerntheoretische, humanistische und erlebnisaktivierende Beratungsangebote verbreiteten sich. Die Umsetzung im Rahmen der Beratung war jedoch weitgehend pragmatisch eklektisch (vgl. Engel et al. 2004, S. 39). „Dieser Eklektizismus überstand auch die Wende zu systemischen Ansätzen, die die Familie ins Zentrum des Beratungsinteresses rückten. Beratung ohne systemische Implikationen ist heutzutage kaum mehr denkbar“ (vgl. ebd.).
3.4 Beratung in Abgrenzung zur Psychotherapie
Die Interventionsformen Beratung und Psychotherapie weisen auf den ersten Blick kaum Unterschiede auf und bei genauerer Betrachtung wird erkennbar, dass die Nähe sowohl auf der fachlichen und als auch auf der methodischen Ebene groß ist. Beide Interventionsformen haben als Gegenstand ihrer Arbeit emotionale Belastungen, Krisen und Konflikte der Klientel. Der Beginn ist jeweils durch das professionelle Gespräch gekennzeichnet, welches die aktuelle Gemütslage und die persönlichen Erlebnisse des Klienten zum Thema macht. Im weiteren Beratungs- und Therapieverlauf werden zudem ähnliche Methoden eingesetzt. Auch wird sich in der wissenschaftlichen Fundierung dieser Interventionsformen auf die gleichen ausschlaggebenden Persönlichkeiten, wie beispielsweise Freud, Adler oder Rogers bezogen (vgl. Großmaß 2004, S. 89f).
Beratung und Therapie weisen zudem beide in der Regel eine Komm-Struktur auf, was bedeutet, dass der Klient aufgefordert ist, die Institution aufzusuchen. Um die Komm- Struktur der Beratungsstellen wird aktuell viel diskutiert. Teilweise wird sich bemüht, die Zugangsbarrieren und Hemmschwellen zu verringern und die Beratungsarbeit niedrigschwellliger anzubieten. In vielen Beratungsstellen ist beispielsweise eine vorherige Anmeldung nicht zwingend erforderlich. Die Möglichkeit der Beratung im sozialen Umfeld des Ratsuchenden, zum Beispiel bei ihm zu Hause (Geh-Struktur), ist mittlerweile vermehrt in den Konzepten von Beratungsangeboten wieder zu finden (vgl. Belardi 2002, S. 329).
Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Interventionsformen Beratung und Psychotherapie liegt in der Eingebundenheit in unterschiedliche Denkmodelle. Psychotherapie orientiert sich weitgehend am medizinischen Modell und ihr Handlungsfeld ist dementsprechend durch eine somatische Abklärung gekennzeichnet (vgl. Engel et al. 2004, S. 36f). Sie ist thematisch am Klienten orientiert. Die Erstellung einer Diagnose sowie die Anamnese einer Störung stehen im Vordergrund und sind Vorraussetzung für den professionellen psychotherapeutischen Prozess bis hin zur Erreichung des Behandlungszieles. Die Klienten der Psychotherapie fühlen sich erkrankt und überbelastet sowie in für sie wichtigen Bereichen des Lebens gestört (vgl. Großmaß 2004, S. 90). Das zu lösende Problem ist bei Therapiebeginn nicht immer vom Klienten bereits definiert worden und muss in diesen Fällen im Laufe der Therapie erst erarbeitet werden.
Beratung hingegen wird von Engel et al. (2004, S. 37) als ein (…) auf Inklusion verschiedenster Felder und Klientel orientiertes präventives und entwicklungsorientiertes Unterstützungsangebot - eine in Lebensweltkontexte eingebundene offen eklektische orientierungs-, Planungs-, Entscheidungs- und Bewältigungshilfe beschrieben. Sie ist als eine alltags-, lebenswelt-, und ressourcenorientierte Intervention zu verstehen.
Engel et al. (2004, S. 37) weisen darauf hin, dass die professionellen Interaktionen im Rahmen von Beratung oder Therapie übereinstimmen können. In einem solchen Fall ergibt sich die Zuordnung zu Beratung oder Therapie aus der jeweils vorliegenden Eingebundenheit in eine Institution sowie der professionell theoretischen Fundierung. Weiter heben die Autoren (a.a.O., S. 37) hervor, dass durch die Eingebundenheiten der Interventionsformen in unterschiedliche Denkmodelle und Logiken das Potential zu einem positiven Verhältnis zueinander zu sehen ist. Beratung kann demnach auch einen benennbaren Teil der Psychotherapie ausmachen und Psychotherapie kann ebenso ein benennbarer Teil der Beratung sein. Beide können füreinander Wegbereiter sein oder sich gegenseitig ergänzen (vgl. ebd.).
Ein weiterer erheblicher Unterschied zwischen diesen beiden Interventionsformen ist darin zu sehen, dass die Psychotherapie im Gegensatz zur Beratung durch eine Heilbehandlung gekennzeichnet ist. Diese wird von Experten durchgeführt, die eine entsprechende Legitimierung dafür innehaben. Es muss ein Krankheitswert vorhanden sein, der mit Hilfe der Therapie behandelt werden soll. Therapietheorien sind somit im Gegensatz zu den eher salutogenetisch orientierten Beratungstheorien überwiegend pathogenesezentriert.
Paragraph 1 Absatz 3 Satz 1 des Psychotherapeutengesetzes (PsychThG)17 definiert Psychotherapie wie folgt:
Ausübung von Psychotherapie im Sinne dieses Gesetzes ist jede mittels wissenschaftlich anerkannter psychotherapeutischer Verfahren vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Störungen mit Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist. (Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 2006, S. 2).
Pfeifer-Schaupp (1995, S. 140f) weist darauf hin, dass die Sozialarbeit seit jeher das „Gesunde und Normale“ fokussiert und gemeinsam mit dem Klienten dementsprechend eine andere Handlungsweise entwirft. In das PsychThG wurde durch den als Ausschlusskriterium formulierten Satz 3 in Absatz 3 des Paragraphen 1 versucht, die Abgrenzung zu anderen Tätigkeitsfeldern wie der psychosozialen Beratung zu verdeutlichen:
Zur Ausübung von Psychotherapie gehören nicht psychologische Tätigkeiten, die die Aufarbeitung und Überwindung sozialer Konflikte oder sonstige Zwecke außerhalb der Heilkunde zum Gegenstand haben. (Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 2006, S. 2).
Zwecke, die außerhalb der Heilkunde anzusiedeln sind, zählen demnach nicht zum Psychotherapiebereich. Zu den psychologischen Tätigkeiten außerhalb der Heilkunde zählen beispielsweise kirchliche und gemeinnützige Beratungsstellen oder pädagogisch-therapeutische Leistungen der Jugendhilfe. Diese Regelung des PsychThG hebt hervor, dass auch Beratung mit psychologischen Elementen ein autarkes professionelles Profil aufweist (vgl. Barabas 2004, S. 1209).
In der Medizin gibt es allerdings keine allgemein gültige Krankheitsdefinition, da Ärzte oder Psychotherapeuten einen allgemeingültigen Krankheitsbegriff nicht für notwendig erachten. Lediglich die Krankenkassen, die als Kostenträger fungieren, haben Interesse an einer Definition. Durch Rechtssprechung des Bundessozialgerichtes wurde Krankheit im Sinne der gesetzlichen Krankenversicherung als „(…) ein regelwidriger körperlicher oder geistiger Zustand, der entweder Behandlungsbedürftigkeit oder Arbeitsunfähigkeit oder beides zur Folge hat (…)“ (ebd.) beschrieben. In der Abgrenzungsdebatte zwischen Psychotherapie und Beratung ist daher bedeutsam, dass nicht alle psychischen Störungen als Krankheit anzusehen sind. Beispielsweise werden Legasthenie oder Neurosen sowie individuelle Wesenseigenschaften (z.B.: Reizbarkeit oder Eifersucht) nicht als Krankheit deklariert.
Dies gilt auch für Erziehungs-, Familien-, Partnerschaftsstörungen, soweit diese nicht als Folge einer seelischen oder körperlichen Erkrankung zu verstehen sind. Lebensprobleme, Partnerschaftskonflikte, Reifungskrisen sind im Allgemeinen nicht als seelische Erkrankungen zu werten [auch wenn sie die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen]. (Barabas 2004, S. 1210)
Die durch das PsychThG zunächst eindeutig wirkende Abgrenzungsformulierung führt demnach nicht zu einer Aufhebung der Abgrenzungsproblematik, da trotz der gesetzlich vorliegenden Ausgrenzungsformulierung die Abgrenzung in der Praxis häufig weiter schwer durchzuführen bleibt. Dies wird beispielsweise daran deutlich, dass der Gegenstand beider Interventionsformen persönliche Krisen der Klienten sind. In Krisen liegen jedoch Gesundheit und Krankheit unter Umständen nahe beieinander. Die jeweilige Verarbeitungsweise des Klienten ist ausschlaggebend dafür, ob seine Krise als ein vorübergehender Entwicklungsprozess betrachtet werden kann, oder ob die Krise zu einer langfristigen seelischen Beeinträchtigung führt. Beratung kann von Psychotherapie dadurch unterschieden werden, dass sie die Aufgabe hat, die gesunde Verarbeitung von Krisen zu fördern und langfristige seelische Beeinträchtigungen zu verhindern. Dabei befindet sich die Beratung nicht im Bereich der Behandlung von Erkrankungen und grenzt sich somit von der Psychotherapie ab. Vielmehr setzt Beratung in Risikosituationen an und hat demnach Risikofaktoren zum Gegenstand (vgl. Großmaß 1997, S. 115).
Neben den bisher beschriebenen Unterscheidungskriterien weisen Beratung und Therapie ungleiche Zielsetzungen18 auf. Das Ziel der Psychotherapie ist nach Definition des PsychThG die Heilung oder Linderung einer diagnostizierten Störung. Das Ziel der Beratung hingegen liegt nach Lüssi (1998, S. 394) darin, „(…) Klarheit zu schaffen darüber, worin das Problem besteht, und den Klienten zu befähigen, sich so zu verhalten, dass es gelöst wird.“ Dabei stellt das oberste Ziel des Case Work die Ich- Stärkung des Klienten (vgl. Abschnitt 3.1) und somit die Befähigung zur Bewältigung der Probleme eine zentrale Absicht für den beratenden Sozialarbeiter dar. Die Psyche des Klienten wird in der Beratung nie isoliert von den problematischen sozialen Umständen betrachtet (vgl. a.a.O., S. 394f). Im Umkehrschluss kann daher festgestellt werden, dass eine Therapie sich mehr auf die Persönlichkeit eines Klienten konzentriert und weniger das soziale Umfeld einbezieht. Sie ist somit eher auf die Veränderung individueller Identität ausgerichtet, wogegen Beratung vordergründig der Begründung von lebenspraktischen Entscheidungen dient und sich insbesondere auf eine Problemlage richtet, die über das Problem des Individuums hinausgeht (vgl. Pfeifer-Schaupp 1995, S. 19).
Psychotherapie setzt nach dem PsychThG eine Approbation des Psychotherapeuten voraus und wird über die Krankenkassen19 finanziert. Im Gegensatz dazu wird Beratung meist vonöffentlicher oder kirchlicher Trägerschaft angeboten und ihre Inanspruchnahme ist in der Regel kostenlos (vgl. Nußbeck 2006, S. 22). Daraus ergibt sich, dass für den Ratsuchenden die Zugangsbarrieren zum niedergelassenen Psychotherapeuten größer sind als die einer Beratungsstelle. Die Erstellung eines ärztlichen Gutachtens, die einzuholende Überweisung, lange Wartezeiten auf einen Therapieplatz und die notwendige Genehmigung einer Therapie durch den Kostenträger verlängern den Weg des Hilfesuchenden.
In der Fachliteratur, die sich mit Beratung in der Sozialen Arbeit auseinandersetzt, werden im Zuge der Abgrenzungsproblematik von Beratung und Therapie häufig auch die unterschiedliche Ausbildung der Fachkräfte und das Maß, in dem die Erfahrungen der Klienten aus ihrer Vergangenheit betont werden, als weitere Abgrenzungskriterien herangezogen. So wird beispielsweise von Rechtien (2004, S. 33) aufgeführt, dass Berater in der Regel „(…) eine andere, weniger langdauernde und weniger die Grundlagen betreffende Ausbildung (…)“ genossen haben. Zudem wird in der Literatur mehrfach als Abgrenzungskriterium herangezogen, dass die Beratung eher die Gegenwart betrachtet als die Geschichte des Problems.
Abschließend ist festzustellen, dass die Abgrenzung zwischen Beratung und Psychotherapie als unbefriedigend anzusehen ist. Die Formulierung des PsychThG kann die Realität der Praxis nicht zufrieden stellend erfassen. Häufig wird erst im Laufe einer Beratung deutlich, dass der Klient psychische Störungen aufweist. In diesen Fällen ist nach Gesetzeslage eine Verweisung beispielsweise an einen ansässigen geeigneten Therapeuten notwendig.
Ratsuchende in einer Krise werden kein Verständnis dafür haben, wenn ihre Berater plötzlich versuchen, in der Beratungssituation bestimmte Themen und Prozesse zu vermeiden, zur rechtlichen Absicherung einen Arzt hinzuziehen oder sie sogar an eine andere Institution verweisen möchten. (vgl. Belardi u.a. 2005, S. 200)
Das Aufsuchen und Annehmen der Beratung stellt zudem meist eine Hürde für die Klienten dar. Ein Verweis an andere Institutionen kann demnach auch einen Rückzug aus der psychosozialen Versorgung zur Folge haben. Sozialarbeiter, die sich nicht in diesem Grenzbereich befinden wollen, müssen daher die Heilpraktikerprüfung ablegen. Diese verlangt allerdings lediglich rechtliche Kenntnisse und Wissen über das, was sie als Heilpraktiker ausüben dürfen und was nicht. Sie verlangt keine beraterischen oder psychotherapeutischen fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten (vgl. ebd.).
4 Systemtheoretische Grundlagen
In diesem Kapitel wird ein grundlegender Einblick in systemtheoretische Erkenntnisse unter Berücksichtigung verschiedener Ansätze und Theorien gegeben. Dazu wird einführend auf die Interdisziplinarität der Systemtheorie eingegangen, um sich anschließend mit der Frage auseinanderzusetzen, was unter einem System zu verstehen ist. An dieser Stelle erfolgt auch eine Erläuterung von unterschiedlichen systemtheoretisch relevanten Begrifflichkeiten, die zum Verständnis dieser Theorie grundlegend sind.
Unterschiedliche Systemtypen und deren theoretische Bedeutung werden nachfolgend dargestellt, um im Anschluss auf die Bedeutung der Eingebundenheit des Menschen in soziale Systeme einzugehen. Der in den systemischen Ansätzen besonders bedeutsame Aspekt der Autopoiese wird darauf folgend beleuchtet und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Soziale Arbeit werden herausgearbeitet. Diesen Ausführungen schließt sich eine Auseinandersetzung mit kybernetischen Theorien an, die eng mit der Systemtheorie verbunden sind. Im gleichen Abschnitt findet auch die Bedeutung der Zirkularität in menschlichen Systemen Berücksichtigung. Im Anschluss daran wird der Frage nachgegangen was systemtheoretisch unter Wirklichkeit zu verstehen ist. Dazu erfolgt eine Vorstellung der Erkenntnistheorie des radikalen Konstruktivismus, die unter Betrachtung des sozialen Konstruktionismus kritisch erörtert wird. Daran anschließend wird auf das systemtheoretische Verständnis von Problemen eingegangen, da diese Gegenstand Sozialer Arbeit und Anlass für die Inanspruchnahme einer Beratung sind.
Abschließend wird dieses Kapitel einen Überblick über die historische Entwicklung des systemischen Denkens in der Sozialen Arbeit geben.
4.1 Systemtheorie
Der Systembegriff ist um 1950 durch die Allgemeine Systemtheorie des Biologen Ludwig von Bertalanffy20 (1901-1972) zu einem zentralen Begriff geworden. Auf Grundlage seiner Allgemeinen Systemtheorie, die physikalische, biologische, gesellschaftliche, kulturelle und Bewusstseinsphänomene erfassen will, wurde die Systemtheorie als Wissenschaftslehre eingeführt (vgl. Müller 1996, S. 65). Bertalanffy wollte grundlegende interdisziplinär anwendbare Aussagen über Systeme treffen. Das Systemkonzept unterliegt dabei der Grundannahme, dass Systeme wesentliche Eigenschaften besitzen, die auf unterschiedliche Systemtypen übertragbar sind (vgl. Miller 1999, S. 26f). In Deutschland wurde der Systembegriff von dem Bielefelder Soziologen Niklas Luhmann21 (1927-1998) zur Systemtheorie entwickelt (vgl. Schilling 1997, S. 229).
Systeme werden von diversen wissenschaftlichen Disziplinen auf unterschiedliche Weise betrachtet. Beispielsweise analysiert die Psychologie psychische Systeme, die Ingenieurwissenschaft Maschinensysteme, die Biologie organische Systeme und die Soziologie soziale Systeme (vgl. Willke 2000, S. 3). Die Anwendungsbereiche der Systemtheorie sind unter anderem in der Organisationsberatung, der Therapie oder im Bereich der Sozialen Arbeit anzutreffen. In der Sozialen Arbeit kann die Systemtheorie für das Erkennen und Verstehen von Hintergründen, Beziehungen und Bezügen dienlich sein, jedoch keine Rezepte oder Universallösungen für die Praxis liefern.
Da systemtheoretische Ansätze interdisziplinär existieren, kann die Systemtheorie nicht als eine eigenständige und einheitliche Disziplin angesehen werden. Eine allgemeine Begriffsbestimmung existiert nicht (vgl. Miller 1999, S. 28).
Außerhalb ihrer technischen Anwendungsgebiete hat die Systemtheorie nicht den Charakter einer in sich geschlossenen Theorie, sondern den einer allgemeinen Modellvorstellung, die in verschiedene auch sozialwissen- schaftliche Theorien Eingang findet. (Hollstein-Brinkmann 1993, S. 20)
Die Anwendung der Systemtheorie in den einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen ist durch eine bestimmte Art zu denken und zu reden gekennzeichnet, in deren Rahmen verschiedene Themen mit unterschiedlichen Begriffen wie beispielsweise Autopoiesis, Rückkopplung, Systemgrenze oder Subsystem angegangen werden. Sie wird verwendet um die Organisation, Funktion und den inneren Aufbau (Systemstruktur) von Systemen beschreiben zu können und um darzustellen, wie diese sich mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Somit ist die Systemtheorie ein umfangreiches Modell, das in der Sozialen Arbeit dazu herangezogen werden kann, um die Realität zu verstehen (vgl. Lüssi 1998, S. 57).
Systemische Handlungsansätze betrachten als Grundelemente ebenso wie die Theorieansätze der Sozialen Arbeit Individuen. Die Betrachtung der Systemzugehörigkeit eines Menschen sowie die der jeweils vorliegenden Systemstruktur und Systemfunktion ermöglicht eine umfassende Darstellung menschlicher Lebenskontexte und schließt dabei individuelle Aspekte der Klienten nicht aus (vgl. Hollstein-Brinkmann 1993, S. 197).
4.2 Was ist ein System?
Der Begriff System stammt aus dem griechischen (to systema) und bedeutet Zusammenstellung, Vereinigung. An der Begriffsbedeutung wird schon eine Orientierung an den Verhältnissen von einzelnen Teileinheiten (Systemelementen) zueinander deutlich (vgl. Brunner 2004, S. 655).
Bertalanffy begreift ein System als Anzahl von Elementen, die miteinander in Wechselwirkung stehen. Diese Definition berücksichtigt jedoch nicht die Beziehung der Elemente zum System selbst und vernachlässigt ebenfalls die Beziehungen der Elemente zum Umweltsystem (vgl. Lüssi 1998, S. 56).
Ropohl (zit. nach Hollstein-Brinkmann 1993, S. 23)22 hingegen berücksichtigt in seiner Definition des Systembegriffes drei wesentliche Aspekte:
Ein System ist dann eine geordnete Ganzheit, die (a) gewisse Funktionen als Beziehungen zwischen bestimmten Attributen (Inputs, Zustände, Outputs) aufweist, die (b) aus Elementen bzw. Subsystemen besteht, die durch Relationen miteinander zu einer Struktur verknüpft sind und die (c) auf einen bestimmten Rang von ihrer Umgebung abgegrenzt bzw. aus einem Supersystem ausgegrenzt wird.
Diese Definition berücksichtigt auch den funktionalen Systemaspekt, wodurch Verhaltensaspekte des jeweiligen Systems einbezogen werden. Zudem greift diese Definition auf, dass Hierarchien23 vorhanden sind. Damit wird Bezug genommen auf die Tatsache, dass ein System oder ein Systemelement auch Teil anderer Systeme ist. Letztlich wird in dieser Definition aufgegriffen, dass Systeme sich voneinander abgrenzen (vgl. a.a.O, S. 24).
[...]
1 In der Sozialarbeit gibt es keine einheitliche Theorie. Vielmehr existieren verschiedene theoretische Ansätze nebeneinander (vgl. Schilling 1997, S. 197).
2 In der Sozialen Arbeit kann der methodische Beratungsbegriff in Rechtsberatung und Lebensberatung differenziert werden (vgl. Schilling 1997, S. 283). In dieser Arbeit wird die Rechtsberatung nicht weiter verfolgt, da diese als Haupttätigkeit des Beraters größtenteils (direktive) Informationsvermittlung beinhaltet. Vielmehr wird die nicht-direktive (vgl. Abschnitt 3.2) Beratungstätigkeit beleuchtet werden, die in diesen Ausführungen als ein unterstützendes, auf den Hilfeprozess bezogenes Gespräch verstanden wird.
3 Insgesamt 27 Fach- und Berufsverbände aus unterschiedlichen anerkannten Beratungsbereichen haben im September 2004 den Dachverband Deutsche Gesellschaft für Beratung/German Association for Counseling e.V. gegründet (vgl. Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie e.V. 16.09.2004, Presseerklärung).
4 Um in dieser Arbeit eine einheitliche Schreibweise beizubehalten, welche in der Fachliteratur nicht vorzufinden ist, wird „Social Case Work“ (Kurzform: Case Work) durchgehend großgeschrieben.
5 In Deutschland wurde Social Case Work unterschiedlich übersetzt: meist wörtlich als soziale Einzelfallhilfe; seit den 60er Jahren ist jedoch eine Tendenz zu dem Begriff der sozialen Einzelhilfe zu beobachten. Begründet wird dies damit, dass die helfende Beziehung im Zentrum steht und nicht der jeweilige Fall (vgl. Galuske 2003, S. 73).
6 Die COS wurde 1877 gegründet und hatte zum Ziel, die Angebote der freien Wohltätigkeit zu koordinieren sowie sinnvoller und effizienter zu gestalten. Aufgabe war es, die Hilfesuchenden an geeignete Hilfsorganisationen weiterzuleiten (vgl. Galuske 2003, S. 73).
7 In Deutschland hat das amerikanische Social Case Work die Sozialarbeit in dieser Form in den 1960er Jahren beeinflusst (vgl. Belardi u.a. 2005, S. 191).
8 Die historischen Entwicklungen in der Deutschen Demokratischen Republik und in den heute neuen Bundesländern werden in dieser Arbeit nicht erörtert.
9 Sigmund Freud gilt als Begründer der Psychoanalyse (vgl. Großmaß 2004, S. 89). Eine zentrale und bedeutende Entdeckung von ihm lag darin, dass die frühe Kindheit für die weitere Entwicklung des Menschen entscheidend ist (vgl. Stemmer-Lück 2004, S.1).
10 Die Soziale Arbeit wurde in Deutschland vordergründig unter normativen Aspekten entwickelt und nicht wie in den USA unter empirischen Aspekten (vgl. Galuske 2003, S. 74).
11 Der Bericht über die Lage der Psychiatrie in der BRD wurde 1975 vom Deutschen Bundestag veröffentlicht und spiegelte den Zustand der Psychiatrie in der BRD wieder. Das Ergebnis des Berichtes war, dass in den Landeskrankenhäusern teils menschenunwürdige Zustände vorherrschten, so dass auch Empfehlungen für die Neuordnung der Versorgung ausgesprochen und angegangen wurden (vgl. Dörner et al. 2002, S. 29f).
12 Aus humanistischer Perspektive strebt der Mensch nach Wachstum und Entwicklung seines Potentials. Seine Fähigkeit, rational entscheiden zu können und dadurch ein unbegrenztes Potential inne zu haben, wird betont (vgl. Zimbardo/ Gerrig 2004, S. 15).
13 Interventionen des Beraters sollen nicht-direktiv und frei von Fremdbestimmung sein. Der Berater ist als Klärungs- und Entscheidungshelfer zu verstehen und nicht wie in der direktiven Beratung als ein Experte, welcher vorwiegend Empfehlungen, Hinweise und Ratschläge gibt. Linear-kausale UrsacheWirkungszusammenhänge werden vom Berater im Rahmen der nicht-direktiven Beratung nicht unterstellt (vgl. Pallasch/Kölln 2002, S.29).
14 Die klientenzentrierte Gesprächsführung geht auf Carl R. Rogers (1902-1987) zurück, der die Klientenzentrierte Psychotherapie (Client-centered Therapy) ab 1942 entwickelt hat. Von dem Hamburger Psychologen Reinhard Tausch wurde diese in Deutschland als Gesprächspsychotherapie, beziehungsweise Klientenzentrierte Psychotherapie eingeführt (vgl. Weinberger 1992, S. 29).
15 Carl Gustav Jung war ein Schweizer Psychologe und Psychiater und gilt als Begründer der analytischen Psychologie. Zudem arbeitete er bis 1912 mit Sigmund Freud zusammen. Als Hauptwerke können „Über die Archetypen des kollektiven Bewusstseins“ (1935) und „Analytische Psychologie“ (1934) genannt werden (vgl. Grosses Wörterbuch Psychologie 2004, S. 165).
16 Alfred Adler war Arzt und Psychotherapeut und gilt als Begründer der Individualpsychologie (vgl. Großmaß 2004, S. 89).
17 Das Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten wurde 1998 verabschiedet. Durch das PsychThG wurden in Deutschland zwei neue Berufe eingeführt die den Ärzten und akademischen Heilberuflern gleichgestellt sind: Der psychologische Psychotherapeut und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut (vgl. Barabas 2004, S. 1209).
18 Einige Autoren machen keinen Unterschied zwischen diesen Interventionsformen, da sie in der Zielsetzung nicht differenzieren. Beide Formen haben die Problemlösung als Ziel. Vertreter dieser Betrachtung sehen den Unterschied lediglich in der Prozessdauer und Beratung wird dem folgend von ihnen als „kleine Therapie“ eingestuft (vgl. Nußbeck 2006, S. 21).
19 Durch Approbation erlangt ein nichtärztlicher Psychotherapeut lediglich die fachrechtliche Zulassung, welche jedoch nicht gleich auch mit einer sozialrechtlichen Zulassung, und dadurch mit dem Anspruch auf Kostenübernahme durch die Krankenkassen einhergeht. Die sozialrechtliche Zulassung ist nur für die Richtlinienverfahren (Psychoanalyse, Verhaltenstherapie) möglich und an die Genehmigung (Antragsverfahren) durch die Kassenärztliche Vereinigung (KV) gebunden. Ärzte und Heilpraktiker sind zur Ausübung von Psychotherapie berechtigt, soweit sie eine entsprechende Zusatzausbildung nachweisen können. Die sozialrechtliche Zulassung muss von dieser Gruppe ebenfalls bei der KV beantragt werden (vgl. Dentler 2006, S. 33).
20 Ludwig von Bertalanffy gilt als Begründer der modernen Systemtheorie. Er verfasste unter anderem 1956 die „General System Theory“ (vgl. Müller 1996, S. 4, 17).
21 Niklas Luhmann gilt als einer der bedeutendsten deutschen Soziologen der Nachkriegszeit und als einer der Begründer der soziologischen Systemtheorie. Er verfasste unter anderem 1984 „Soziale Systeme. Grundriß (!) einer allgemeinen Theorie“ (vgl. Stichweh 1999, S. 206ff).
22 Hollstein-Brinkmann bezieht sich auf die von Günther Ropohl 1980 erschienene Veröffentlichung „Ein systemtheoretisches Beschreibungsmodell des Handelns“.
23 Der Begriff der Hierarchie ist an dieser Stelle nicht im Sinne von Machtausübungsoptionen, sondern als Aufbau- beziehungsweise Ordnungsbegriff zu verstehen.