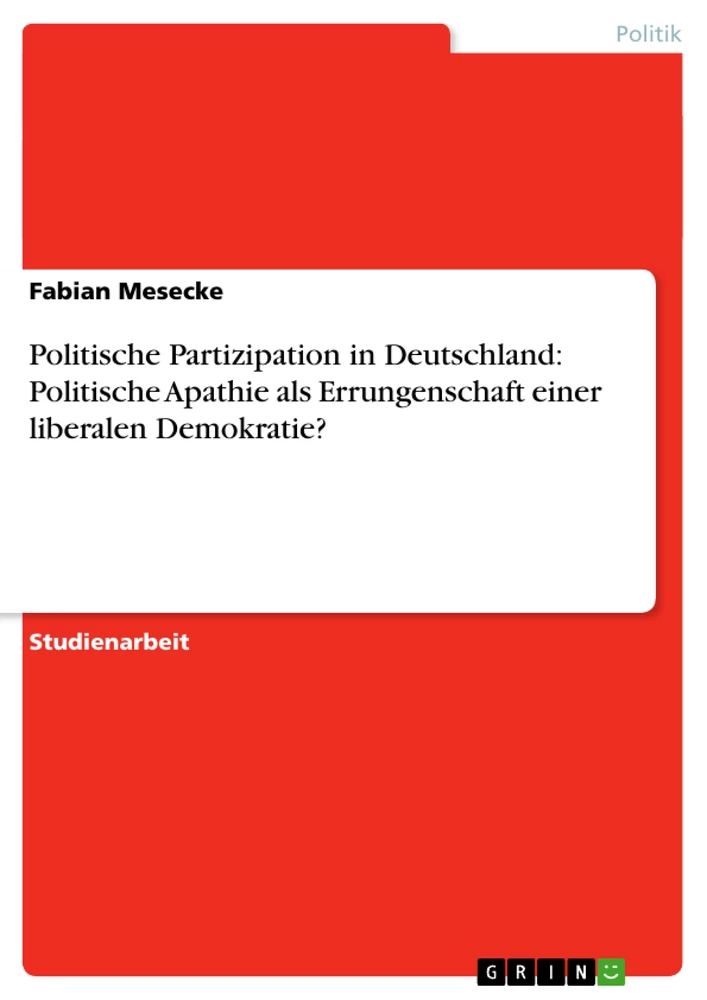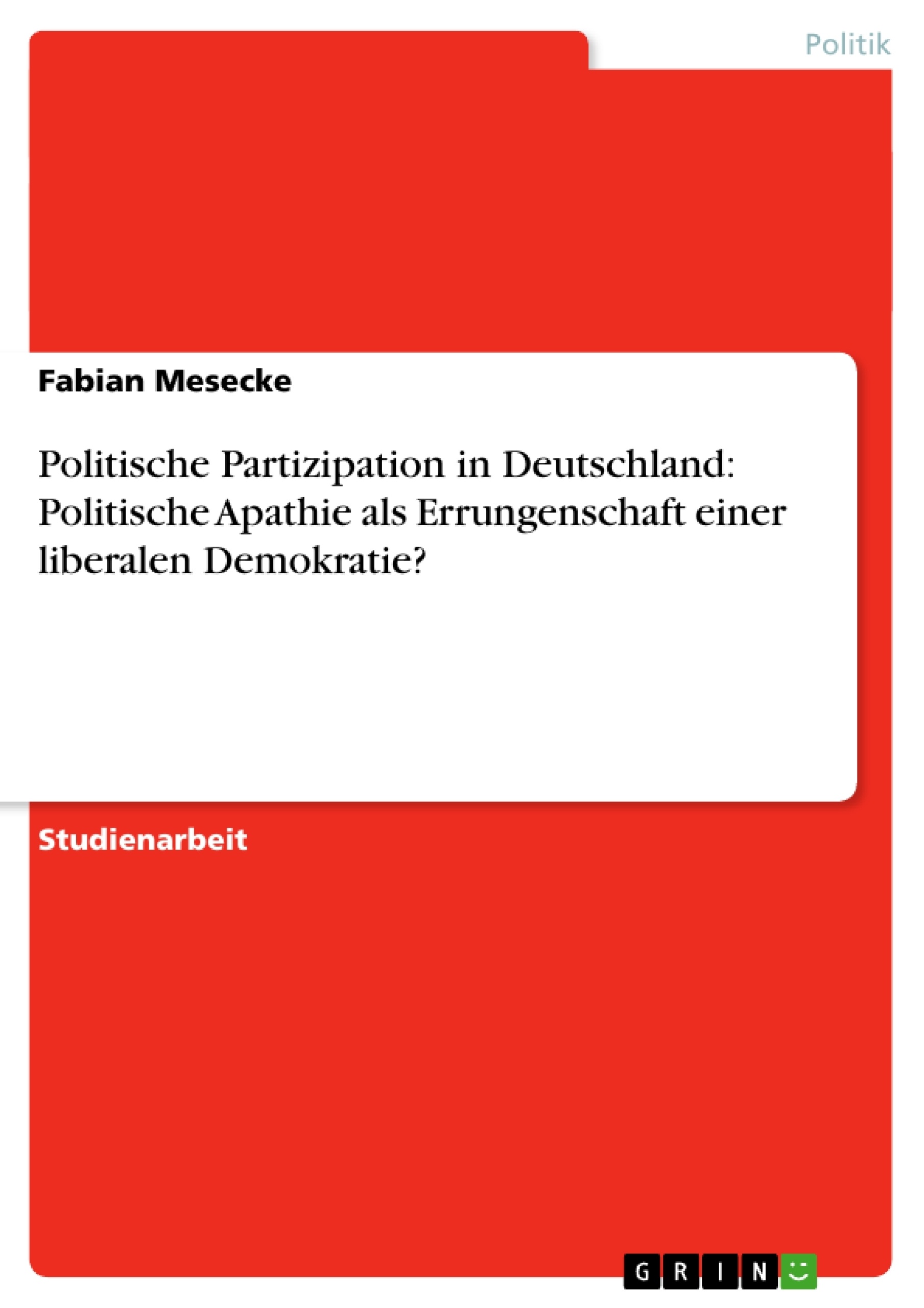Im Jahr 2006 fanden in der Bundesrepublik Deutschland fünf Landtagswahlen statt. Die Wahlbeteiligung lag bei keiner der fünf Wahlen über 60% (Bartsch 2006). In Sachsen-Anhalt gaben nur 44,4% der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Damit war zum ersten Mal bei einer Landtagswahl die Gruppe der Nichtwähler größer als die der Wahlberechtigten, die ihre Stimme abgaben (ebd.). In Baden-Württemberg lag im gleichen Jahr die Wahlbeteiligung bei 53,4%. Dieser Wert stellt die niedrigste Wahlbeteiligung dar, die je bei einer Landtagswahl in den alten Bundesländern gemessen wurde. Von einem spezifisch ostdeutschen Problem lässt sich also kaum sprechen. Vielmehr spiegelt diese Momentaufnahme des Jahres 2006 in Deutschland die Entwicklung in vielen westeuropäischen Staaten wieder. Bei den beiden letzten Parlamentswahlen in Großbritannien wurden die beiden niedrigsten Wahlbeteiligungsraten seit 1918 gemessen. Bei den letzten Wahlen zum österreichischen Nationalparlament wurde ebenfalls ein historischer Tiefstand erreicht. Das Gleiche gilt für die französischen Präsidentschaftswahlen im Jahre 20022. Die vier genannten Staaten können ohne Zweifel als postmoderne, hochgradig individualisierte Gesellschaften bezeichnet werden. Geht mit fortschreitender Individualisierung nun eine sinkende Partizipationsbereitschaft einher? Ulrich Beck sieht einen solchen Zusammenhang. Er bezeichnet politische Apathie als eine mögliche Folge von Individualisierungsprozessen. Für Benjamin Barber sind der Liberalismus und die damit verbundene Betonung von individuellen Freiheitsrechten die Ursachen für die sinkende Bereitschaft der Bürger zur Beteiligung an politischen Prozessen. Einen Kontrast zur eingangs angedeuteten Entwicklung bilden die Ergebnisse des Zweiten Volksentscheid Rankings der Initiative Mehr Demokratie. In diesem heißt es, dass die Zahl von Volksinitiativen und Volksbegehren in der Bundesrepublik kontinuierlich wachse. Ein klares Bild von der Höhe der Motivation der Bürger zur Beteiligung ist auf den ersten Blick also nicht zu erkennen.
Daher wird im Rahmen dieser Arbeit untersucht, wie sich die politische Partizipation in Deutschland insgesamt entwickelt hat und ob die von Kommunitariern wie Benjamin Barber attestierte politische Apathie in der Bundesrepublik heute wirklich vorzufinden ist.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theorien politischer Partizipation
2.1 Politische Partizipation und das liberale Gesellschaftsmodell
2.1.1 Liberalismus nach John Rawls
2.1.2 Die kommunitaristische Kritik am Liberalismus
2.2 Bestimmungsfaktoren politischer Partizipation
2.3 Formen politischer Partizipation
3. Empirische Befunde zur politischen Partizipation
in Deutschland
3.1 Die Entwicklung konventioneller Partizipationsformen
3.2 Die Entwicklung unkonventioneller Partizipationsformen
3.3 Zusammenfassung
4. Fazit
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
Im Jahr 2006 fanden in der Bundesrepublik Deutschland fünf Landtagswahlen statt. Die Wahlbeteiligung lag bei keiner der fünf Wahlen über 60% (Bartsch 2006). In Sachsen-Anhalt gaben nur 44,4% der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Damit war zum ersten Mal bei einer Landtagswahl die Gruppe der Nichtwähler größer als die der Wahlberechtigten, die ihre Stimme abgaben (ebd.). In Baden-Württemberg lag im gleichen Jahr die Wahlbeteiligung bei 53,4%. Dieser Wert stellt die niedrigste Wahlbeteiligung dar, die je bei einer Landtagswahl in den alten Bundesländern gemessen wurde (ebd.). Von einem spezifisch ostdeutschen Problem lässt sich also kaum sprechen. Vielmehr spiegelt diese Momentaufnahme des Jahres 2006 in Deutschland die Entwicklung in vielen westeuropäischen Staaten wieder. Bei den beiden letzten Parlamentswahlen in Großbritannien wurden die beiden niedrigsten Wahlbeteiligungsraten seit 1918 gemessen (vgl. Becker 2005). Bei den letzten Wahlen zum österreichischen Nationalparlament wurde ebenfalls ein historischer Tiefstand erreicht[1]. Das Gleiche gilt für die französischen Präsidentschaftswahlen im Jahre 2002[2]. Die vier genannten Staaten können ohne Zweifel als postmoderne, hochgradig individualisierte Gesellschaften bezeichnet werden. Geht mit fortschreitender Individualisierung nun eine sinkende Partizipationsbereitschaft einher? Ulrich Beck (1983: 52) sieht einen solchen Zusammenhang. Er bezeichnet politische Apathie als eine mögliche Folge von Individualisierungsprozessen (ebd.). Für Benjamin Barber sind der Liberalismus und die damit verbundene Betonung von individuellen Freiheitsrechten die Ursachen für die sinkende Bereitschaft der Bürger zur Beteiligung an politischen Prozessen (vgl. Rees-Schäfer 1994: 88). Einen Kontrast zur eingangs angedeuteten Entwicklung bilden die Ergebnisse des Zweiten Volksentscheid Rankings der Initiative Mehr Demokratie. In diesem heißt es, dass die Zahl von Volksinitiativen und Volksbegehren in der Bundesrepublik kontinuierlich wachse[3]. Ein klares Bild von der Höhe der Motivation der Bürger zur Beteiligung ist auf den ersten Blick also nicht zu erkennen. Daher wird im Rahmen dieser Arbeit untersucht, wie sich die politische Partizipation in Deutschland insgesamt entwickelt hat und ob die von Kommunitariern wie Benjamin Barber attestierte politische Apathie in der Bundesrepublik heute wirklich vorzufinden ist. Diese Arbeit besteht aus einem theoretischen Abschnitt (Kapitel 2) und einem empirischen Abschnitt (Kapitel 3). Zunächst erstelle ich in Kapitel 2.1 das ideengeschichtliche Fundament dieser Arbeit, indem ich Partizipation im Rahmen der Liberalismus-Kommunitarismus Debatte betrachte. Anschließend werden in Kapitel 2.2 die wesentlichen Bestimmungsfaktoren der politischen Partizipation erläutert. Kapitel 2.3 beinhaltet die Darlegung der Formen der politischen Teilhabe. In Kapitel 3.1 und 3.2 zeige ich die Entwicklung dieser Formen in der Bundesrepublik Deutschland auf. Ein bilanzierender Ausblick bildet mit Kapitel 4 den Schluss dieser Arbeit.
2. Theorien politischer Partizipation
Allgemein umfasst politische Partizipation Handlungen, die dem Ziel dienen, Einfluss auf die politische Willensbildung und Entscheidungsfindung auszuüben (vgl. Uehlinger 1988: 2). Ein demokratisches System wie das der Bundesrepublik Deutschland basiert auf der Beteiligung der Bürger an den politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen (vgl. Hoecker 2006: 3). In welchem Maße ein stabiles und gerechtes System auf die Beteiligung der Bürger angewiesen ist, ist in der politischen Philosophie umstritten. So stellt diese Frage einen elementaren Bestandteil der Liberalismus-Kommunitarismus Debatte dar. Die Grundlagen beider Strömungen sowie die Bedeutung dieser als Theorien der politischen Partizipation werden in Kapitel 2.1 erörtert. In Kapitel 2.2 verlasse ich die normative Ebene und betrachte die Determinanten der politischen Partizipation. In Kapitel 2.3 werden schließlich die konkreten Formen politischer Beteiligung aufgezeigt. Ich unterscheide dabei aus analytischen Gründen zwischen konventionellen und unkonventionellen Ausprägungen der Bürgerbeteiligung.
2.1 Politische Partizipation und das liberale Gesellschaftsmodell
Die normativen Vorstellungen über die Formen und den Grad der Beteiligung der Bürger an politischen Prozessen variieren mit dem jeweils gewählten Demokratiemodell. Wegen des empirischen Bezugs der Arbeit auf die Bundesrepublik Deutschland beschränke ich mich auf das liberale Modell. Aufgrund seiner Relevanz innerhalb der politischen Philosophie konzentriere ich mich auf John Rawls Variante des Liberalismus. Diese formulierte er in seinem Hauptwerk „A Theory of Justice“, das 1971 erschien. In Kapitel 2.1.2 gehe ich auf die kommunitaristische Idee ein. Diese stellt keine eigene Theoriegattung dar, sondern versteht sich als Korrektiv des Liberalismus (vgl. Reese-Schäfer 1994: 9). Unter dem Sammelbegriff des Kommunitarismus finden sich unterschiedliche Arten dieser Idee wieder. Ich beschränke mich auf Benjamin Barbers Beitrag zu diesem Diskurs, den er in seinem Hauptwerk „Strong Democracy“ beschreibt. Da die politische Beteiligung der Bürger den Kern seiner äußerst praktischen Ausführungen darstellt, drängt er sich mir mit seinen Überlegungen geradezu auf.
2.1.1 Liberalismus nach John Rawls
Der amerikanische Philosoph John Rawls sorgte mit der Veröffentlichung von „A Theory of Justice“ im Jahre 1971 für eine Wiederbelebung der politischen Philosophie (vgl. Meyer 1996: 1). Sein Gerechtigkeitsverständnis, das er mit diesem Werk postuliert, bildet einen Kontrast zu der in der politischen Philosophie der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts vorherrschenden Theorie des Utilitarismus (vgl. Meyer 1996: 13). Im Sinne dieser Idee kann eine Gesellschaft dann als gerecht bezeichnet werden, wenn ihre Institutionen so gestaltet sind, dass sie den maximalen Nutzen für die größtmögliche Zahl der Mitglieder der Gesellschaft erzeugen (ebd.). Diese Idee impliziert somit die Hinnahme der Ausgrenzung von Minderheiten zu Gunsten einer Mehrheitsgesellschaft. Im Gegensatz dazu beinhaltet Rawls’ Entwurf einer gerechten Gesellschaft die Herstellung der bestmöglichen Ausgangsposition für die am schlechtesten gestellten Mitglieder der Gesellschaft (vgl. Höffe 1998: 9). Das bedeutet, dass privilegierte Gesellschaftsteile die Interessen der Benachteiligten wahrnehmen müssen. Da Rawls den Individuen innerhalb seines Modells eine rationale Handlungsorientierung unterstellt (vgl. Kersting 2004: 121), kann ein solches Verhalten von den besser gestellten Akteuren allerdings nicht erwartet werden. Um dieses Problem zu umgehen, schafft er eine fiktive Situation, die gedanklich der konstituierten Gesellschaft vorgelagert ist (ebd.). In diesem Urzustand erfolgt die Einigung aller Mitglieder der Gesellschaft auf eine Grundordnung (ebd.). Rawls Theorie basiert aufgrund dieser Idee im Kern auf vertragstheoretischen Überlegungen (vgl. Meyer 1996: 10). Um einen möglichst fairen Aushandlungsprozess zu erreichen, ist den Individuen die Position, die sie später in der konstituierten Gesellschaft einnehmen werden, unbekannt (vgl. Rawls 2003: 141). Jeder einzelne stellt einen potenziell Benachteiligten dar. Dies sorgt für die Einhaltung der Maximin-Regel unter den Beteiligten. Das größtmögliche Glück der am schlechtesten gestellten Person steht nun im Zentrum des Handelns der Akteure (vgl. Kersting 2004: 45). Aus Mangel an Informationen entsteht im Urzustand für alle Akteure eine faire Ausgangsposition. Sie treffen im Urzustand Entscheidungen unter einem Schleier der Nichtwissens (vgl. Rawls 2003: 139). Die getroffenen Vereinbarungen beinhalten zwei Gerechtigkeitsprinzipien. Das erste Prinzip besteht aus dem Recht jedes Individuums auf eine maximal mögliche Ausstattung an gleich verteilten Grundfreiheiten. Zu diesen zählen: Einkommen, Vermögen, Rechte und Chancen (vgl. Rawls 2003: 80). Sie dienen als Basis für die Verwirklichung der individuell verschiedenen Vorstellung von einem guten Leben. Rawl spricht in diesem Zusammenhang von einer Konzeption des Guten (vgl. Rawls 2003: 135). Als zweites Prinzip nennt Rawls das Differenzprinzip. Nach diesem Grundsatz seien soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten nur dann legitim, wenn sie den am schlechtesten gestellten Mitgliedern der Gesellschaft dienen würden (vgl. Rawls 2003: 78). Außerdem müsse der Zugang zu allen Ämtern und Positionen, mit denen soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten einhergehen, unter gerechter Chancengleichheit erfolgen (ebd.). Das erste Gerechtigkeitsprinzip besitzt dabei Vorrang vor dem Differenzprinzip (ebd.). Rawls trennt in seiner Theorie drei verschiedene Gesellschaftszustände. Er unterscheidet die reale Gesellschaft von der fiktiven Gesellschaft im Urzustand (vgl. Rawls 2003: 139). Die wohlgeordnete oder konstituierte Gesellschaft ist das Resultat aus der im Urzustand erreichten Gerechtigkeit und den Vereinbarungen über eine institutionelle Grundstruktur (vgl. Rawls 2003: 56). Eine Verbindung zwischen Urzustand und realer Gesellschaft ist ebenfalls vorgesehen. Die im fiktiven Urzustand getroffenen Vereinbarungen dienen als Handlungsorientierung für die Bürger in der realen Gesellschaft (vgl. Rawls 2003: 162). Die vertraglichen Vereinbarungen und das reale Handeln, oder Gerechtigkeitsprinzipien und Gerechtigkeitsurteile, sind dabei durch gegenseitige Annäherung in Einklang zu bringen (vgl. Rawls 2003: 162). Am Ende dieses Prozesses wird ein Zustand des Gleichgewichtes erreicht, den Rawls als Überlegungsgleichgewicht bezeichnet (ebd.). Rawls Theorie beinhaltet also durchaus praktische Bezüge. In späteren Arbeiten versteht Rawls seine Theorie der Gerechtigkeit weniger als eine umfassende Moraltheorie. Vielmehr diene sie als politische Konzeption, die sich nur noch auf den öffentlichen Lebensbereich der Individuen beziehe (vgl. Kersting 2004: 188). Dabei trägt er dem Umstand Rechnung, dass in pluralistischen Gesellschaften differierende Moralvorstellungen und Weltbilder nebeneinander existent sind. Ein einheitliches und umfassendes Gerechtigkeitsideal sei daher nicht herstellbar (vgl. Rawls 2003: 131). Stabilität wird in einer pluralistischen Gesellschaft durch einen überlappenden Konsens, den man sich als eine Art Schnittmenge verschiedener moralischer Überzeugungen im politischen Bereich vorstellen kann, gesichert (vgl. Kersting 2004: 192). Die Beteiligung der Bürger beschränkt sich in diesem Modell auf die aktive Akzeptanz des gemeinschaftlich geschaffenen Systems und seiner Regeln.
2.1.2 Die kommunitaristische Kritik am Liberalismus
In den 80er Jahren etablierte sich die Idee des Kommunitarismus in der politischen Philosophie. Einen maßgeblichen Anteil daran hatte Michael Sandel mit der Veröffentlichung von „Liberalism and the Limits of Justice“ im Jahre 1982. Sein Werk erschien als Reaktion auf John Rawls „Theory of Justice“ und stellt eine massive Kritik an dieser dar. Sandel stellt darin vor allem die Idee des Urzustandes und die damit verbundene Konzeption des ungebundenen Selbst in Frage (vgl. Reese-Schäfer 1994: 116). Ein freies und ungebundenes Individuum würde keinerlei Verpflichtungen gegenüber Gemeinschaften eingehen, deren Mitgliedschaft nicht auf Freiwilligkeit beruht (ebd.). Damit werde die Bedeutung von nationalen Gemeinschaften untergraben (ebd.). Die zweite Hauptkritik Sandels richtet sich auf das Differenzprinzip (vgl. Kapitel 2.1.1) Es basiert auf der Solidarität privilegierter Gesellschaftsteile mit den benachteiligten Mitgliedern der Gesellschaft. Ohne einer Gemeinschaft verpflichtet zu sein, könne keine Solidarität entstehen (vgl. Reese-Schäfer 1994: 17). Sandel leitete mit seinem Werk einen philosophischen Diskurs ein, der nicht nur in Opposition zu Rawls Gerechtigkeitstheorie steht, sondern auch einen Kontrast zu dem in den 80er Jahren in der politischen Praxis vorherrschendem Neoliberalismus bildete. Die wissenschaftlichen Diskussionen um den Wertewandel und die Individualisierung, die in dieser Zeit begannen, leisteten ihren unterstützenden Beitrag dazu. Dem Kommunitarismus lassen sich zahlreiche Vertreter zuordnen, deren Vorstellungen zum Teil stark differieren. Ein gemeinsamer Kern dieser Überzeugungen lässt sich allerdings bestimmen. So untergrabe die zunehmende Bedeutung des Individuums den Zusammenhalt einer Gesellschaft und leite letztlich das Ende der liberalen Demokratie ein (vgl. Reese-Schäfer 1994: 8). Durch die Reaktivierung von gemeinschaftsbezogenen Werten soll der Zusammenhalt und damit die Stabilität einer Gesellschaft gestärkt werden. Dies geschieht nicht zuletzt mit der Absicht, die Freiheit des Einzelnen und damit eine liberale Gesellschaftsordnung zu sichern. Politische Partizipation bildet hierbei die Basis für die Sozialisation in eine Gemeinschaft. Barber setzt mit seinem 1984 erschienenen Hauptwerk „Strong Democracy“ genau an dem letztgenannten Punkt an. Ein ausgeprägter Individualismus führe seiner Meinung nach innerhalb eines Systems vermittelter Beteiligung zur politischen Apathie (vgl. Reese-Schäfer 1994: 88). Die repräsentative Demokratie leide an strukturellen Schwächen, die er anhand dreier Dispositionen bestimmt. In der anarchistischen Disposition streben die Individuen den Erhalt ihrer freiheitlichen Rechte an. Politische Beteiligung dient dabei als Hilfsmittel, mit dem die politischen Prozesse entsprechend gesteuert werden können (vgl. Barber 1984: 36). Das politische System wird als Gegenpol zur individuellen Freiheit gesehen. Daher wird es mit möglichst wenig Einfluss auf die Individuen ausgestattet. Zwischen den Extremen von Freiheit und Macht sei im Liberalismus allerdings kein Platz für Gemeinwesen (vgl. Barber 1984: 37). Um ein Zusammenleben der Individuen zu ermöglichen, ist die Ausübung von Gewalt durch eine zentrale Staatsmacht notwendig. Darauf zielt die realistische Disposition der Politik ab. Einer zentralisierten Macht werde dabei der Vorrang vor demokratischem Wildwuchs gewährt (vgl. Barber 1984: 65). Staatliche Bürokratien würden Konflikte unterdrücken (vgl. Reese-Schäfer 1994: 91). Durch Anreize und Sanktionen werde das Verhalten der Bürger zwar kontrolliert, ein öffentliches Bewusstsein werde aber nicht geschaffen (vgl. Barber 1984: 46). Um die Balance zwischen Einzelinteresse und politischer Macht zu wahren, also um sowohl Anarchie als auch Despotien zu verhindern, werden in der minimalistischen Disposition Konflikte toleriert (vgl. Barber 1984: 81). Dieses Gleichgewicht schütze allerdings nicht vor politischem Extremismus (vgl. Barber 1984: 88). Zudem werde es mit politischem Stillstand erkauft (vgl. Barber 1984: 83). Insgesamt bezeichnet er die liberale Demokratie als eine magere Demokratie. Dieser stellt er sein Konzept einer starken Demokratie gegenüber. Mit diesem demokratietheoretischen Entwurf schlägt er eine Aufwertung der liberalen indirekten Demokratie durch direktdemokratische Elemente vor. Dadurch soll eine „sich selbst regierende Gemeinschaft von Bürgern“ entstehen (vgl. Barber 1984: 99). Der im Liberalismus bestehende Antagonismus zwischen Bürgern und politischen Eliten löst sich in Barbers Bürgergesellschaft auf (vgl. Barber 1984: 214). Die Mitglieder der Gesellschaft sind in seinem Modell in Nachbarschaften eingebunden. Diese Gemeinschaften verbinde die gemeinsame aktive Beteiligung an politischen Prozessen (ebd.). Das politische Verhalten sei von Kooperation geprägt (ebd.). Kontrolle werde durch Respekt und Empathie ersetzt (ebd.). Konflikte werden nicht durch Aushandlung gelöst, sondern durch Dialog. An die Stelle eines fiktiven Gesellschaftsvertrages trete die gemeinschaftliche Gestaltung von politischen Entscheidungsprozessen (vgl. Barber 1984: 214). Private Interessen werden dabei in gemeinwohlorientierte Interessen umgewandelt. Neben dieser theoretischen Darlegung seines Modells macht Barber praktische Vorschläge zur Umsetzung seines Konzeptes. Die starke Demokratie soll durch ein zwölf Punkte umfassendes Programm institutionalisiert werden (vgl. Reese-Schäfer 1994: 101/102). Insgesamt sollen die Kommunikationen innerhalb der Bürgerschaft, Information der Bürger, Gemeinwesenarbeit, öffentliche Fürsorge und plebiszitäre Verfahren unterstützt und organisiert werden (ebd.).
[...]
[1] vgl. Wikipedia, Wahlbeteiligung, 14.2.2007, unter http://de.wikipedia.org/wiki/Wahlbeteiligung, 20.2.2007
[2] vgl. Französische Botschaft, Frankreich - Info, 31.1.2005,
unter: http://test.botschaft-frankreich.de/IMG/pdf/wahlen.pdf, 20.2.2007
[3] vgl. Mehr Demokratie e.V., Zweites Volkentscheid Ranking, Januar 2007,
unter: http://mehr-demokratie.de/ranking.html, 20.2.2007