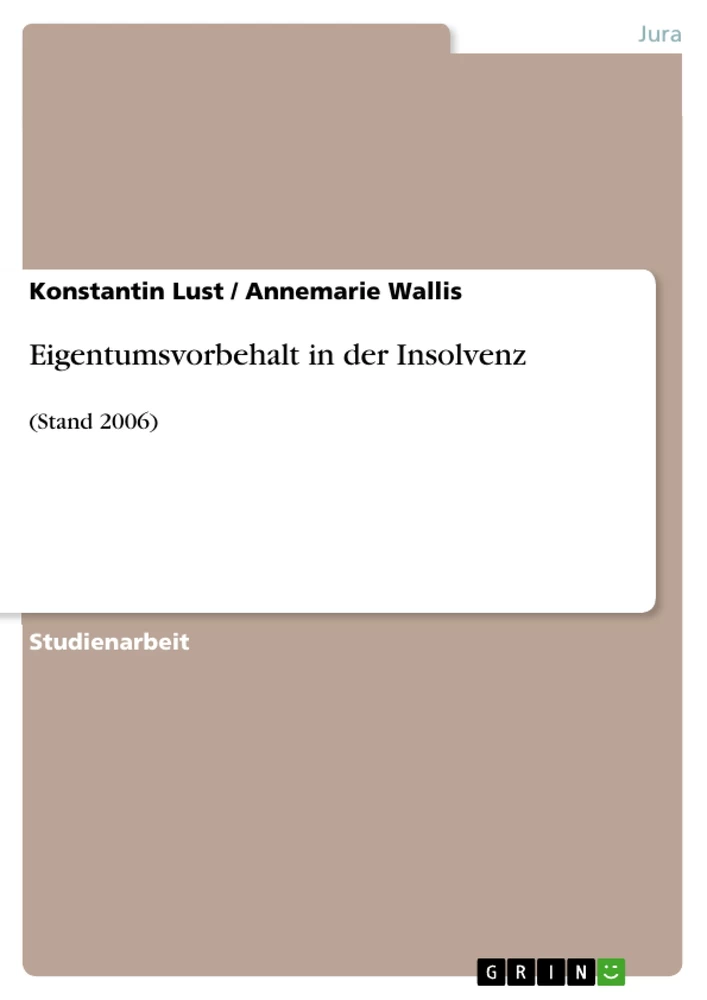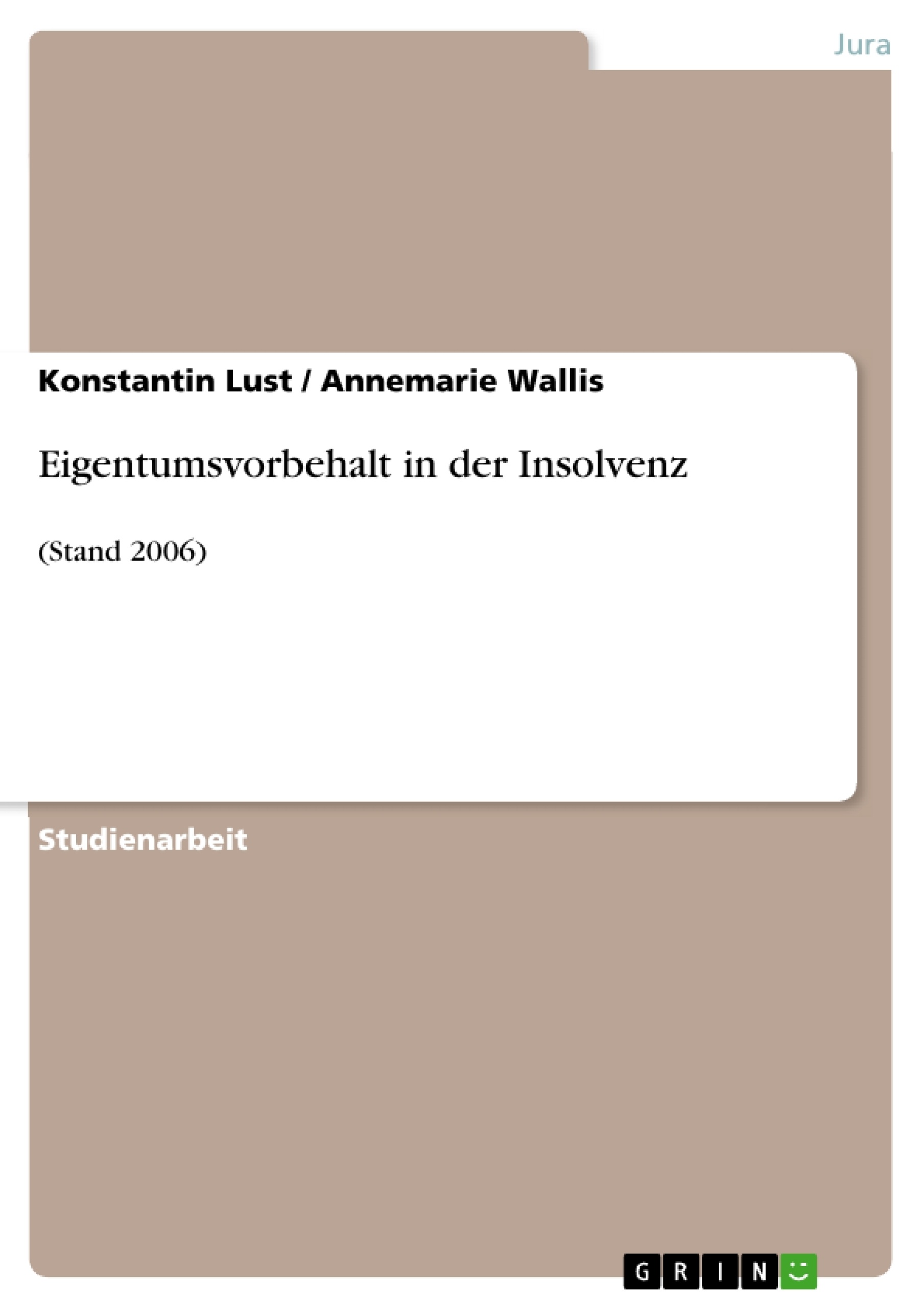Obwohl sich die wirtschaftliche Lage langsam entspannt, ist die Zahl der Unternehmen, die Insolvenz anmelden mussten zwar rückläufig, aber immer noch beträchtlich. So gab es im Zeitraum vom Januar bis August 2006 immer noch 21.011 Unternehmensinsolvenzen. Ein aktuelles und sehr bekanntes Beispiel stellt dabei das Unternehmen BenQ Mobile dar. Aufgrund der angespannten Wirtschaftslage ist es kaum vorstellbar, dass geschäftliche Kontakte nur mit ausgesuchten, besonders liquiden Partnern getätigt werden. Daher kann keiner ausschließen, dass im Geschäftsverkehr Partner zahlungsunfähig sind oder werden können. Für alle Unternehmen ergibt sich dadurch ein erhöhtes Risiko, da die Gegenstände bei insolventen Betrieben in der Insolvenzmasse..........
Inhaltsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Anlage
A. Einleitung
B. Allgemeines
I. Wesensmerkmale des Eigentumsvorbehalts
II. Wirkung der Insolvenzeröffnung
C. Insolvenz des Vorbehaltskäufers
I. Der einfache Eigentumsvorbehalt als Aussonderungsrecht
II. Das Wahlrecht des Insolvenzverwalters
1. Tatbestandsvoraussetzungen des § 103
2. Rechtsfolgen
a) Allgemeines
aa) Das Wahlrecht
bb) Die Aufforderung zur Wahlrechtsausübung
cc) Schonfrist des § 107 Abs. 2 S. 1 InsO
(1) Voraussetzungen des § 107 Abs. 2 InsO
(2) Sinn und Zweck und Rechtsfolgen des § 107 Abs. 2 S. 1 InsO
b) Erfüllungswahl
c) Erfüllungsablehnung
aa) Allgemeines
bb) Forderung wegen Nichterfüllung
(1) Rechtsnatur
(2) Anspruchsinhalt und Berechnung
III. Wahlrecht contra Rücktrittsrecht
D. Insolvenz des Vorbehaltsverkäufers
I. Allgemeines
II. Tatbestandsvoraussetzungen
III. Rechtsfolgen des § 107 Abs. 1 InsO
IV. Bedeutung des § 107 Abs. 1 S. 2 InsO
V. Gegenleistung des Vorbehaltskäufers
E. Sonderformen des Eigentumsvorbehalts
I. Der verlängerte Eigentumsvorbehalt
1. Verarbeitungsklausel
2. Vorausabtretungsklausel
II. Der erweiterte Eigentumsvorbehalt
1. Kontokorrentvorbehalt
III. Der weitergeleitete Eigentumsvorbehalt
IV. Der nachgeschaltete Eigentumsvorbehalt
F. Fazit
Literaturverzeichnis
Andres, Dirk/ Leithaus, Rolf/ Dahl, Michael: Kommentar zur Insolvenzordnung, München 2006
Beck, Siegfried/ Depre `: Praxis der Insolvenz – Ein Handbuch für die Beteiligten und ihre Berater, München 2003
Becker, Christoph: Insolvenzrecht, Köln, Berlin, München 2005
Braun, Eberhard: Kommentar zur Insolvenzordnung, 2. Aufl., München 2004
Gottwald, Peter (Hrsg.) : Insolvenzrechts-Handbuch, 3. Aufl., München 2006
Breuer, Wolfgang: Insolvenzrecht, 2. Aufl., München 2003
Brox, Hans/ Walker, Wolf-Dietrich: Besonderes Schuldrecht, 30. Aufl., München 2005
Bork, Reinhard: Einführung in das Insolvenzrecht, 4. Aufl., Tübingen 2005
Foerste, Ulrich, Insolvenzrecht, 3. Aufl., München 2006
Gogger, Martin: Insolvenzrecht, München 2005
Häsemeyer, Ludwig, Insolvenzrecht, 3. Aufl., Köln, Berlin, Bonn, München 2003
Kreft, Gerhart /Marotzke, Wolfgang /Kirchhof, Hans-Peter , u.a.: Heidelberger Kommentar zur Insolvenzordnung, 4. Aufl., Heidelberg, München, Landsberg, Berlin 2006
Hess, Harald: Insolvenzrecht, 6. Auflage, Köln 2003
Ders. / Weis, Michaela: Insolvenzrecht, 3. Auflage, Heidelberg 2005
Keller, Ulrich: Insolvenzrecht, München 2006
Kuhn, Georg/ Uhlenbruck, Wilhelm: Kommentar zur Insolvenzordnung, 11 Auflage, München 1994
Marotzke, Wolfgang: Gegenseitige Verträge im neuen Insolvenzrecht, 3. Aufl., Neuwied, Kriftel , Berlin 2002
Kirchhof, Hans-Peter /Lwowski Hans-Jürgen /Stürner, Rolf: Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, Band 2: § 103-269, München 2005
Nerlich, Jörg/ Kreplin, Georg (Hrsg.): Anwaltshandbuch Sanierung und Insolvenzrecht, München 2006
Palandt, Otto: Kommentar zum BGB, 6. Auflage, München 2006
Runkel, Hans (Hrsg.): Anwalts-Handbuch Insolvenzrecht, Köln 2005
Smid, Stefan: Grundzüge des Insolvenzrechts, 4. Aufl., München 2002
Uhlenbruck, Wilhelm,: Kommentar zur Insolvenzordnung, 12 Aufl., München 2003
Wimmer, Klaus (Hrsg.): Frankfurter Kommentar zur Insolvenzordnung, 3. Aufl., Neuwied, Kriftel, Berlin 2002
N.N.: Insolvenzen Deutschland, Statistisches Bundesamt vom 03.11.2006 (http://www.destatis.de/indicators/d/lrins01ad.html)
Anlage
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Insolvenzen
Deutschland
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1) Beispielsweise als Gesellschafter oder Mithafter.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aktualisiert am 03.11.2006
Im Netz finden Sie diese Informationen hier:
/daten1/stba/html/indicators/d/ins110ad.htm
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
A. Einleitung
Obwohl sich die wirtschaftliche Lage langsam entspannt, ist die Zahl der Unternehmen, die Insolvenz anmelden mussten zwar rückläufig, aber immer noch beträchtlich. So gab es im Zeitraum vom Januar bis August 2006 immer noch 21.011 Unternehmensinsolvenzen.[1] Ein aktuelles und sehr bekanntes Beispiel stellt dabei das Unternehmen BenQ Mobile dar. Aufgrund der angespannten Wirtschaftslage ist es kaum vorstellbar, dass geschäftliche Kontakte nur mit ausgesuchten, besonders liquiden Partnern getätigt werden. Daher kann keiner ausschließen, dass im Geschäftsverkehr Partner zahlungsunfähig sind oder werden können. Für alle Unternehmen ergibt sich dadurch ein erhöhtes Risiko, da die Gegenstände bei insolventen Betrieben in der Insolvenzmasse untergehen und die Gläubigerbefriedigung sehr zweifelhaft ist. Dieses hat zur Folge, dass Sicherungsmittel unerlässlich sind. Eine große wirtschaftliche Bedeutung im Warenverkehr hat hierbei der Kauf unter Eigentumsvorbehalt, § 449 BGB, mit all seinen Erscheinungsformen und Erweiterungsmöglichkeiten.[2]
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich überwiegend mit dem so genannten materiellen Insolvenzrecht, genauer gesagt mit dem Eigentumsvorbehalt in der Insolvenz, wobei gewisse verfahrensrechtliche Elemente auch eine Rolle spielen werden. Als erstes werden unter Punkt B die Wesensmerkmale des Eigentumsvorbehalts erläutert. Weiterhin werden die Wirkungen der Eröffnung des Insolvenzverfahrens geschildert. Das Augenmerk dieser Arbeit liegt auf den nachfolgenden Punkten C und D. Hier wird die Insolvenz des Vorbehaltskäufers sowie des Vorbehaltsverkäufers näher betrachtet, eine zentrale Rolle in der Käuferinsolvenz spielt das Wahlrecht des Insolvenzverwalters. Im Punkt E wird auf die Sonderformen des Eigentumsvorbehalts in der Insolvenz eingegangen, hier werden die Rechtsfolgen sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer dargestellt, wobei für diesen das Absonderungsrecht von großer Bedeutung ist. Unter dem letzten Punkt F. werden die gewonnen Erkenntnisse der Arbeit zusammengeführt.
B. Allgemeines
I. Wesensmerkmale des Eigentumsvorbehalts
Die Käufer wollen häufig Kaufgegenstände erhalten und nutzen ohne dabei den Kaufpreis sofort und vollständig bezahlen zu müssen. Um eine größere Anzahl von Waren abzusetzen, sind die Verkäufer meistens bereit auf diesen Wunsch einzugehen. Der Kaufpreis wird kreditiert. Die Verkäufer wollen jedoch dabei keine oder nur möglichst geringe Risiken eingehen und diese Kreditierung absichern.[3] Eine Möglichkeit die Wünsche beider Seiten zu berücksichtigen stellt der Kauf bzw. Verkauf unter Eigentumsvorbehalt dar.
Eigentumsvorbehalte stellen klassische Kreditsicherungen für Lieferungen mobiler Gegenstände dar, ohne dass der Kaufpreis vollständig bezahlt wurde.[4] Die nach 449 BGB wesentliche Eigenschaft des Eigentumsvorbehalts ist die aufschiebend bedingte Übereignung der Sache gem. §§ 929, 158 Abs. 1 BGB bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises.[5] Das schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft selbst ist ohne Bedingung geschlossen. Der Verkäufer muss den Gegenstand übergeben, ist aber lediglich zur bedingten Übereignung und zur Stundung des Kaufpreises verpflichtet.[6] Der Verkäufer darf gem. § 160 BGB den Eintritt der Bedingung nicht verhindern. Der Käufer erhält eine dingliche Anwartschaft, die der Verkäufer nach § 161 Abs. 1 BGB nicht mehr einseitig zerstören kann.[7] Mit dem Eintritt der Bedingung, also der vollständigen Kaufpreiszahlung, erhält der Käufer das Vollrecht Eigentum, § 158 Abs. 1 BGB.[8] Zahlt der Käufer jedoch nicht oder nicht rechtzeitig, so kann der Verkäufer unter Umständen vom Vertrag zurücktreten und den Gegenstand wieder zurückverlangen, § 449 Abs. 2 BGB, mit der Folge, dass das Rechtsverhältnis nach §§ 346 ff. BGB rückabgewickelt wird.[9]
II. Wirkung der Insolvenzeröffnung
In einen Grundsatzurteil hat der IX. Zivilsenat des BGH klargestellt, dass die Eröffnung des Insolvenzverfahrens keine Auswirkungen auf den Bestand der noch offenen Erfüllungsansprüche aus einem gegenseitigen Vertrag hat.[10] Zu den gegenseitigen Verträgen zählt auch der unter Eigentumsvorbehalt geschlossene Kaufvertrag. Mit dieser Entscheidung hat der Senat seine seit 1988 ständige Rechtsprechung, die besagte, dass die beiderseitigen Erfüllungsansprüche mit Eröffnung des Verfahrens erlöschen und erst durch das Erfüllungsverlangen des Insolvenzverwalters neu entstehen ("Erlöschenstheorie"), aufgegeben.[11] Er sagt jetzt, dass die Ansprüche auch nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens weiter bestehen. Allerdings verlieren diese aufgrund der beiderseitigen Nichterfüllungseinreden der Vertragspartner aus § 320 BGB, soweit es sich nicht um Ansprüche auf die Gegenleistung für schon erbrachte Leistungen handelt, ihre Durchsetzbarkeit.[12]
Sollte der Verkäufer, der unter Eigentumsvorbehalt verkauft hat, bereits vor der Insolvenzeröffnung des Schuldners teilweise Leistungen erbracht haben, d.h. beispielsweise Waren geliefert haben, so ist er mit dem Anspruch auf die Gegenleistung gemäß § 105 S. 1 InsO nur Insolvenzgläubiger. Er ist jedoch immer noch Eigentümer der Ware und kann daher wegen seines Anspruchs aus § 985 BGB trotz des § 105 S. 2 InsO diese nach §§ 47, 48 InsO aussondern.[13] Hat dagegen der Schuldner teilweise Leistungen erbracht, so kann der Insolvenzverwalter gemäß § 94 InsO mit seinem Gegenleistungsanspruch, die dem Verkäufer eventuell zustehenden Insolvenzforderungen, z.B. aus § 103 Abs. 2 S. 1, aufrechnen.[14]
C. Insolvenz des Vorbehaltskäufers
Der in der Praxis weitaus häufig vorkommende Fall ist die Insolvenz des Vorbehaltskäufers. Die für diesen Fall entscheidenden Normen sind § 103 Abs. 1 und § 107 Abs. 2 InsO.
I. Der einfache Eigentumsvorbehalt als Aussonderungsrecht
Bei dem Kauf unter einfachem Eigentumsvorbehalt hat der Verkäufer unter Umständen das Recht die verkaufte Ware aus der Masse des Käufers auszusondern, § 47 InsO.[15] Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Sache, da der Kaufvertrag, der unter der aufschiebenden Bedingung vollständiger Kaufpreiszahlung geschlossen wurde, durch den Käufer definitiv nicht erfüllt werden kann.[16]
Unter Aussonderung versteht man die Handlungen, die dingliche oder persönliche Rechte Dritter, in diesem Fall das dingliche Recht Eigentum, davor bewahren, mit der Insolvenzmasse zu verschmelzen und zum Vorteil der Insolvenzgläubiger verwertet zu werden. Dieses hat zur Folge, dass die Eigentümer Dritter aus der „Istmasse“, wie diese vom Insolvenzverwalter festgestellt wird, ausgegliedert sind, da sie keine Bestandteile der „Sollmasse“ nach § 35 InsO darstellen. Die Aussonderungsberechtigten sind somit keine Insolvenzgläubiger.[17] Aussonderungsrechte müssen gemäß § 47 Satz 2 InsO außerhalb des Insolvenzverfahrens geltend gemacht werden, d.h. dass ein Aussonderungsberechtigter seine Ansprüche autonom von den Hinderungen des Insolvenzverfahrens geltend machen kann. Damit haben die Aussonderungsberechtigten die stärkste Position unter den Gläubigern. Die Ansprüche müssen gegenüber dem Insolvenzverwalter, der Besitzer ist, geltend gemacht werden und zwar so, wie es das materielle Recht erfordert. Also hat der Aussonderungsberechtigte Herausgabe gemäß § 985 BGB zu verlangen.[18]
Allerdings darf der Verkäufer die Sache nur dann aussondern, wenn der Insolvenzverwalter nicht auf die Erfüllung des Vertrages besteht, §§ 103, 107 Abs. 2 InsO oder aber der Fall eintritt, dass der Verkäufer gemäß §§ 455, 326 BGB wirksam von dem Kaufvertrag zurücktritt.[19] Somit steht dem Käufer weder das Anwartschaftsrecht gem. § 160 BGB noch das Besitzrecht gem. § 986 BGB an der gekauften Sache mehr zu. Der gekaufte Gegenstand ist eben nicht in das Eigentum des Käufers übergegangen und somit greift § 105 S. 2 InsO, der zum Nichtbestehen des Aussonderungsrechts geführt hätte, nicht ein.[20]
Hat der Insolvenzverwalter den Besitz an einem Gegenstand nach § 148 I InsO, der unter einfachem Eigentumsvorbehalt verkauft wurde, so ist er nicht zur Verwertung berechtigt. Obwohl der Vorbehaltsverkäufer zur Aussonderung befugt ist, darf er diese nicht sogleich durchsetzen, § 103 Abs. 2 S. 2 i.V.m. § 107 Abs. 2 S. 1 InsO.[21]
Veräußert der Schuldner vor der Insolvenzeröffnung oder der Insolvenzverwalter nach der Insolvenzeröffnung den Gegenstand, der hätte ausgesondert werden können, unberechtigt weiter, dann kann der Aussonderungsberechtigte die Abtretung des Rechts auf Gegenleistung verlangen, falls diese noch ausstehen sollte. Er kann auch die Gegenleistung selbst verlangen, soweit diese in der Masse unterscheidbar vorhanden ist, § 48 InsO, so genannte Ersatzaussonderung. Hat der Insolvenzverwalter als Gegenleistung Bargeld angenommen, so ist dieses ununterscheidbar vermischt, jedoch besteht Miteigentum am Barbestand, was ebenfalls zum Ersatzaussonderungsrecht führt. Bei einer Gutschrift auf ein Konto ist die Unterscheidbarkeit unproblematisch gegeben, da die Gutschrift auf einem Kontoauszug separat erscheint.
Bei der Verfügung muss es sich um eine rechtsgeschäftliche und entgeltliche Verfügung gehandelt haben. Ist dies nicht der Fall, so kann der Berechtigte dem Dritten gegenüber seine dinglichen Rechte durchsetzen oder die Sache herausverlangen, § 816 Abs. 1 S. 2 BGB.[22]
II. Das Wahlrecht des Insolvenzverwalters
1. Tatbestandsvoraussetzungen des § 103
Vorraussetzung des § 103 InsO ist ein gegenseitiger Vertrag im Sinne der §§ 320 ff. BGB, es handelt sich also um einen vollkommen zweiseitig verpflichtenden Vertrag, dessen Merkmal die synallagmatische Verbindung der Hauptleistungspflichten ist.[23] Hierunter fallen besonders Kaufverträge.[24] Eine weitere Voraussetzung des § 103 ist, dass der Vertrag im Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung, § 27 Abs. 2 Nr. 3 InsO, vom Schuldner und vom anderen Teil nicht oder nicht voll erfüllt ist. Ein Vertrag ist dann vollständig erfüllt, wenn die laut Vertragsvereinbarung geschuldete Leistung erbracht wurde, §§ 362 Abs. 1, 267, 269 ff. BGB. Entscheidend ist hierbei der Eintritt des Leistungserfolgs im Sinne des § 362 BGB und nicht schon die Vornahme der Leistungshandlung.[25] Der Erfüllung stehen die vom BGB anerkannten Erfüllungssurrogate, wie beispielsweise die Aufrechnung nach § 389 BGB oder die Annahme an Erfüllung statt gemäß § 364 Abs. 1 BGB, gleich. Erfüllt auch nur eine Partei gänzlich ihre geschuldeten Leistungen wird § 103 unanwendbar, wird dagegen auch nur ein kleiner Teil von verhältnismäßiger Geringfügigkeit, § 320 Abs. 2 BGB, nicht erbracht, darunter fallen auch Nebenleistungspflichten, fehlt es an der vollständigen Erfüllung.[26]
Ein Kaufvertrag, der unter Eigentumsvorbehalt abgeschlossen ist, ist auf beiden Seiten noch nicht vollständig erfüllt. Seitens des Käufers mangelt es an einer vollständigen Erfüllung aufgrund des noch nicht komplett bezahlten Kaufpreises.
Zweifelhaft kann sein, ob der Verkäufer durch die Übergabe der Sache unter Eigentumsvorbehalt seine Verpflichtungen vollständig erbracht hat, denn laut dem Kaufvertrag schuldet dieser nur die tatsächlich bewirkte bedingte Übereignung des Gegenstandes. Diese bedingte Übereignung ist allerdings für den Erfüllungsbegriff des § 103 nicht ausreichend, da es wie oben erwähnt, gerade auf den Eintritt des Leistungserfolges ankommt. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises fehlt es an der Übereignung, mit der Folge, dass der Leistungserfolg nicht eingetreten ist.[27]
2. Rechtsfolgen
a) Allgemeines
aa) Das Wahlrecht
Ist ein gegenseitiger Vertrag im Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens vom Schuldner und vom anderen Teil nicht oder nicht vollständig erfüllt, so kann der Insolvenzverwalter sein Wahlrecht uneingeschränkt ausüben.[28] Der Begriff Wahlrecht sagt aus, dass der Insolvenzverwalter entscheiden kann, ob er den Vertrag anstelle des Schuldners erfüllt und somit auch die Erfüllung seitens der anderen Vertragspartei fordern kann, oder ob er es bei der Nichterfüllung des Vertrages belässt.[29] Ob der Insolvenzverwalter sich für die eine oder die andere Alternative entscheidet, liegt in seinem Ermessen.[30] Dabei soll er sein Wahlrecht zum Vorteil der Gesamtheit der Gläubiger ausüben.[31]
[...]
[1] N.N., http://www.destatis.de/indicators/d/ins110ad.htm.
[2] Keller, Insolvenzrecht, Rdn. 1173; Huber, in: Gottwald,
Insolvenzrechtshandbuch, § 36 Rdn.14.
[3] Brox/Walker, Besonderes Schuldrecht, § 7 Rdn. 21.
[4] Häsemeyer, Insolvenzrecht, Kap. 18 Rdn. 30.
[5] Putzo, in: Palandt, Kommentar zum BGB, § 449, Rdn. 8; Medicus; Schuld-
recht II, Rdn. 120 ff.
[6] Putzo, in: Palandt, Kommentar zum BGB, § 449 Rdn. 8; Huber, in: Gottwald,
Insolvenzrechtshandbuch, § 36 Rdn. 13.
[7] Putzo, in: Palandt, Kommentar zum BGB, § 449 Rdn. 8 f.; Keller, Insolvenz
recht, Rdn. 1294.
[8] Putzo, in: Palandt, Kommentar zum BGB, § 455 Rdn. 6; Brox/Walker,
Besonderes Schuldrecht, § 7 Rdn. 25 f.
[9] Häsemeyer, Insolvenzrecht, Kap.18 Rdn. 30.
[10] BGHZ 353, 359 = ZIP 2002, 1093 ff., 1094.
[11] BGHZ 250, 252, 254.
[12] Andres, in: Andres/Leithaus, Kommentar zur InsO, § 103 Rdn. 2; Kroth, in:
Braun, Kommentar zur InsO, § 103 Rdn. 9.
[13] Keller, Insolvenzrecht, Rdn. 1297.
[14] Keller, Insolvenzrecht, Rdn. 1225; Dahl, in: Runkel, Anwaltshandbuch,
§ 7 Rdn. 51.
[15] Uhlenbruck in: Uhlenbruck, Kommentar zur InsO, § 47 Rdn. 42; Hess,
Insolvenzrecht, Rdn. 618; Marotzke, in: Heidelberger Kommentar zur InsO,
§ 107 Rdn. 12; Becker, Insolvenzrecht, § 22 Rdn. 982; kritisch zur
systematischen Einordnung des Eigentumsvorbehalts als Aussonderungs- statt
als Absonderungsrecht: Häsemeyer, Insolvenzrecht, Kap. 11 Rdn.10.
[16] Gottwald, in: Gottwald, Insolvenzrechtshandbuch, § 43 Rdn.7; Foerste,
Insolvenzrecht, § 23 Rdn. 348.
[17] Häsemeyer, Insolvenzrecht, Kap.18 Rdn.30; Keller, Insolvenzrecht,
Rdn. 382; Bork, Insolvenzrecht, Rdn. 236; Hess, Insolvenzrecht, Rdn. 740;
Breuer, Insolvenzrecht, Rdn. 359; Drees, in: Runkel, Anwaltshandbuch, § 6
Rdn. 17ff.
[18] Keller, Insolvenzrecht, Rdn. 382; Dahl, in: Runkel, Anwaltshandbuch, § 6
Rdn. 19.
[19] Gottwald, in: Gottwald, Insolvenzrechtshandbuch, § 43 Rdn.7, Foerste,
Insolvenzrecht, § 23 Rdn. 348.
[20] Keller, Insolvenzrecht, Rdn.1300.
[21] Hess, Insolvenzrecht, Rdn.796; Drees, in: Runkel, Anwaltshandbuch, § 6
Rdn. 17 ff.
[22] Keller, Insolvenzrecht, Rdn. 394.
[23] Kroth, in: Braun, Kommentar zur InsO, § 103 Rdn.11; Huber, in:
Münchener Kommentar zur InsO, § 103 Rdn. 55 Huber, in: Gottwald,
Insolvenzrechtshandbuch, § 36 Rdn. 15 ; Keller, Insolvenzrecht,
Rdn. 1178; Dahl, in: Runkel, Anwaltshandbuch, § 7 Rdn. 15.
[24] Marotzke, in: Heidelberger Kommentar zur InsO, § 103 Rdn. 5; Kroth, in:
Braun, Kommentar zur InsO, § 103 Rdn.13; Dahl, in: Runkel, Anwaltshand-
buch, § 7 Rdn. 16; Keller, Insolvenzrecht, Rdn. 1179.
[25] BGHZ 87, 156, 162; Huber, in: Münchener Kommentar zur InsO, § 103
Rdn. 122; Kroth, in: Braun, Kommentar zur InsO, § 103 Rdn. 25; Keller,
Insolvenzrecht, Rdn.1194 ff.
[26] Kroth, in: Braun, Kommentar zur InsO, § 103 Rdn. 24; Huber, in: Münchener
Kommentar zur InsO, § 103 Rdn. 123; Keller, Insolvenzrecht, Rdn. 1194 ff.;
Dahl, in: Runkel, Anwaltshandbuch, § 7 Rdn. 20 ff.; Andres, in: Andres/
Leithaus, Kommentar zur InsO, § 103 Rdn. 12.
[27] Huber, in: Gottwald, Insolvenzrechtshandbuch, § 36 Rdn. 16; Keller,
Insolvenzrecht, Rdn. 1199.
[28] Keller, Insolvenzrecht, Rdn. 1279; Dahl, in: Runkel, Anwaltshandbuch, § 7
Rdn. 29.
[29] Huber, in: Münchener Kommentar zur InsO, § 103 Rdn. 148; Ott, in:
Münchener Kommentar zur InsO, § 107 Rdn.17; Marotzke, in: Heidelberger
Kommentar zur InsO, § 107 Rdn.18; Dahl, in: Runkel, Anwaltshandbuch, § 7
Rdn. 29.
[30] Dahl, in: Runkel, Anwaltshandbuch, § 7 Rdn. 29.
[31] BGHZ 129, 336, 340.