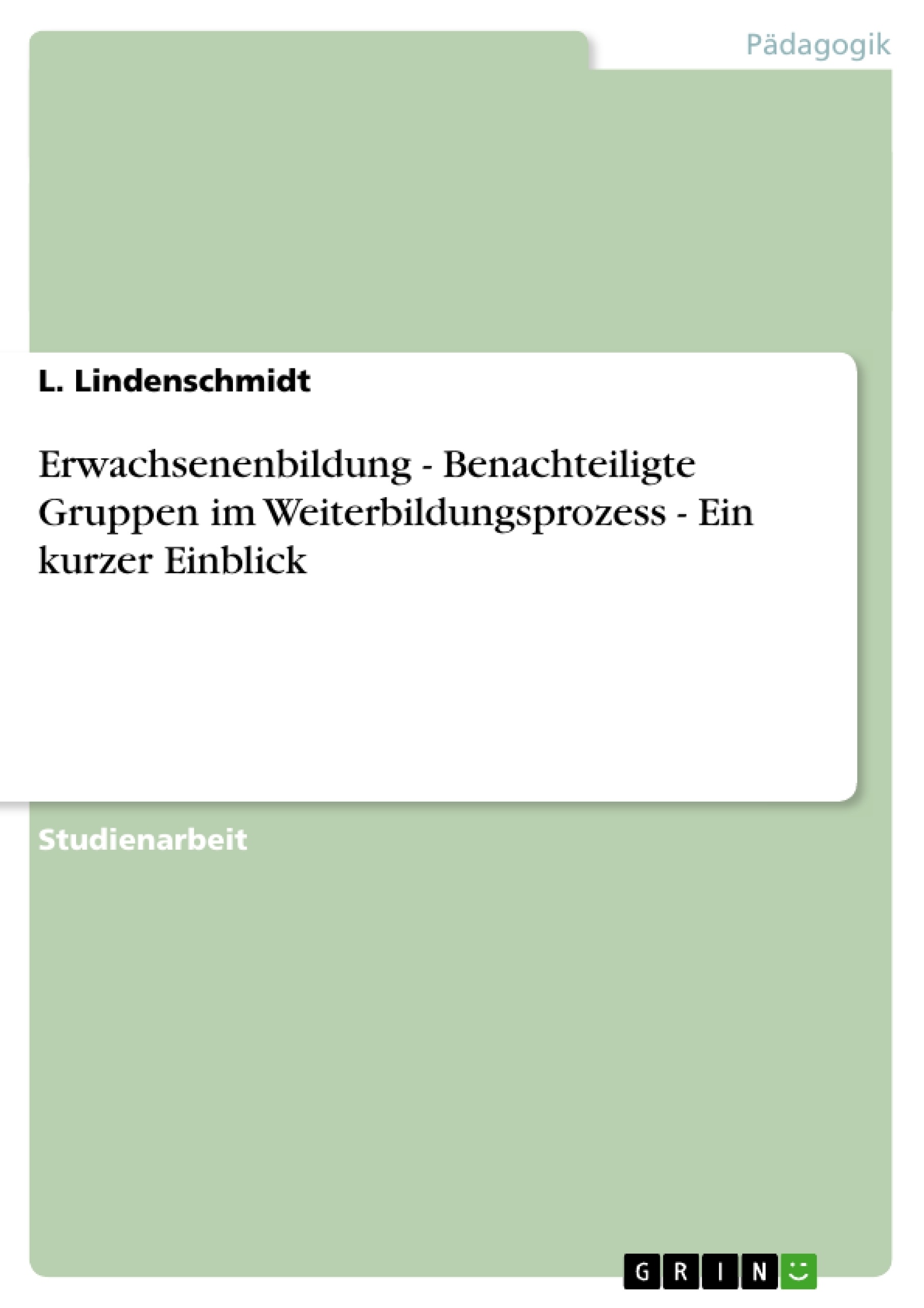Vorliegender Aufsatz soll einen kurzen Einblick in die Probleme und die Hintergründe benachteiligter Gruppen liefern. Er erhebt keinesfalls den Anspruch den gesamten Themenkomplex oder etwa das weite Feld der Weiterbildung erschöpfend zu behandeln. Dies ist schon aufgrund der formalen Beschränkungen nicht möglich. Dennoch soll er zur Klärung einiger Fragen beitragen und in gewisser Weise thesengenerierend wirken.
Wie von der Dozentin des begleitenden Seminars, Kirsten Lehmkuhl, gewünscht, orientiert sich der Aufsatz stark an einem Buch, welches mir im Rahmen der Literaturrecherche zum Seminar, beziehungsweise zu einem Referat über einen Text von Anke Grotlüschen aufgefallen ist. Die zentralen Aussagen sind dem Buch >>Benachteiligte und Bildungsferne – Empfehlungen für die Weiterbildung<< von Gerhild Brüning und Helmut Kuwan (siehe auch Literaturverzeichnis) entnommen. Natürlich werden zusätzlich Informationen aus Sekundärliteratur benutzt und verarbeitet.
Mit diesem Handwerkszeug ausgerüstet, soll versucht werden die benachteiligten Gruppen und damit die benachteiligten Personen zu charakterisieren.
Kann die These vom >>katholischen Arbeitermädel vom Lande<<, welches quasi den Prototyp einer bildungsspezifisch benachteiligten Person in Deutschland darstellt, auch wirklich vertreten werden oder gehört dieses eher in den Bereich der Vorurteile und anekdotischen Evidenzen? Nach einleitenden Begriffsdefinitionen und dem thematischen Hauptteil, soll diese Frage im Fazit beantwortet werden.
Erwachsenenbildung - Benachteiligte Gruppen im Weiterbildungsprozess - Ein kurzer Einblick
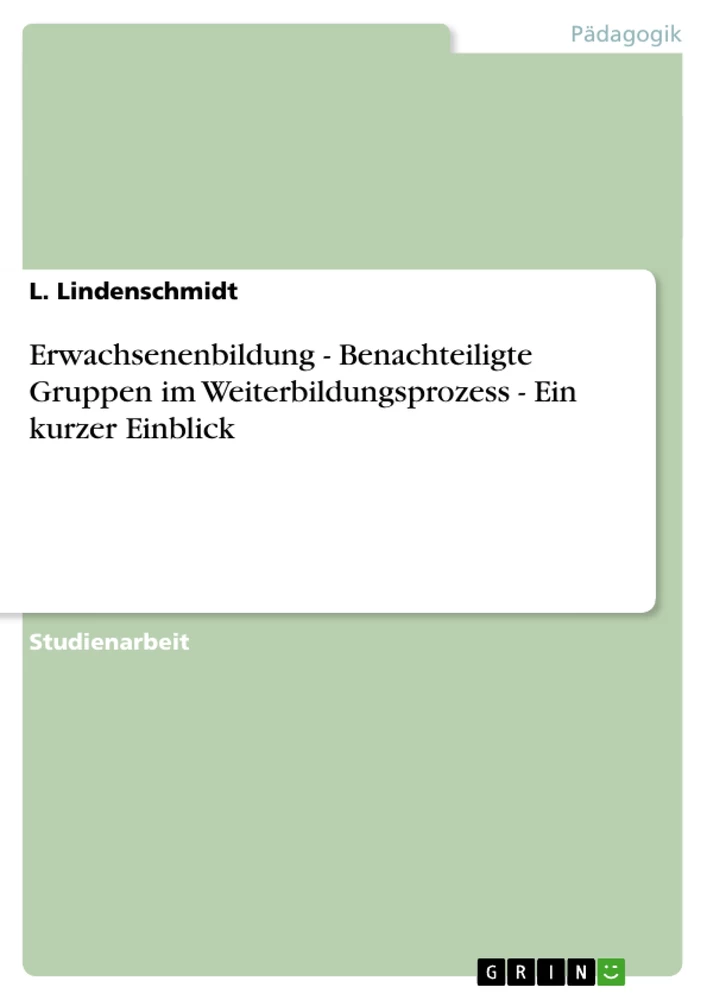
Seminararbeit , 2006 , 11 Seiten , Note: 2,3
Autor:in: Dipl.Päd. L. Lindenschmidt (Autor:in)
Pädagogik - Erwachsenenbildung
Leseprobe & Details Blick ins Buch